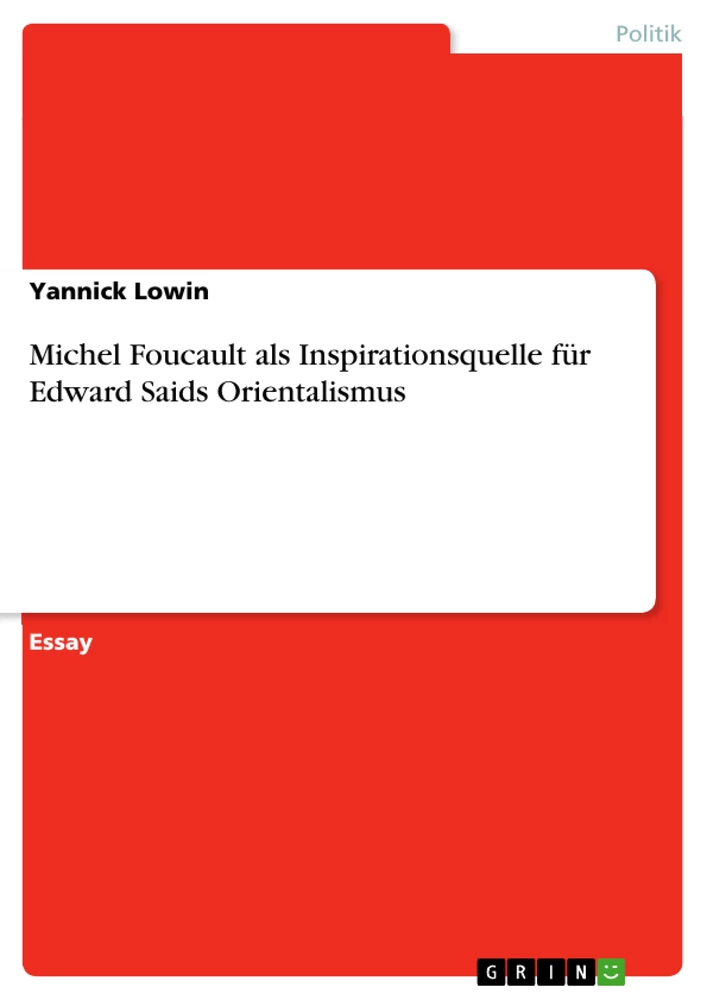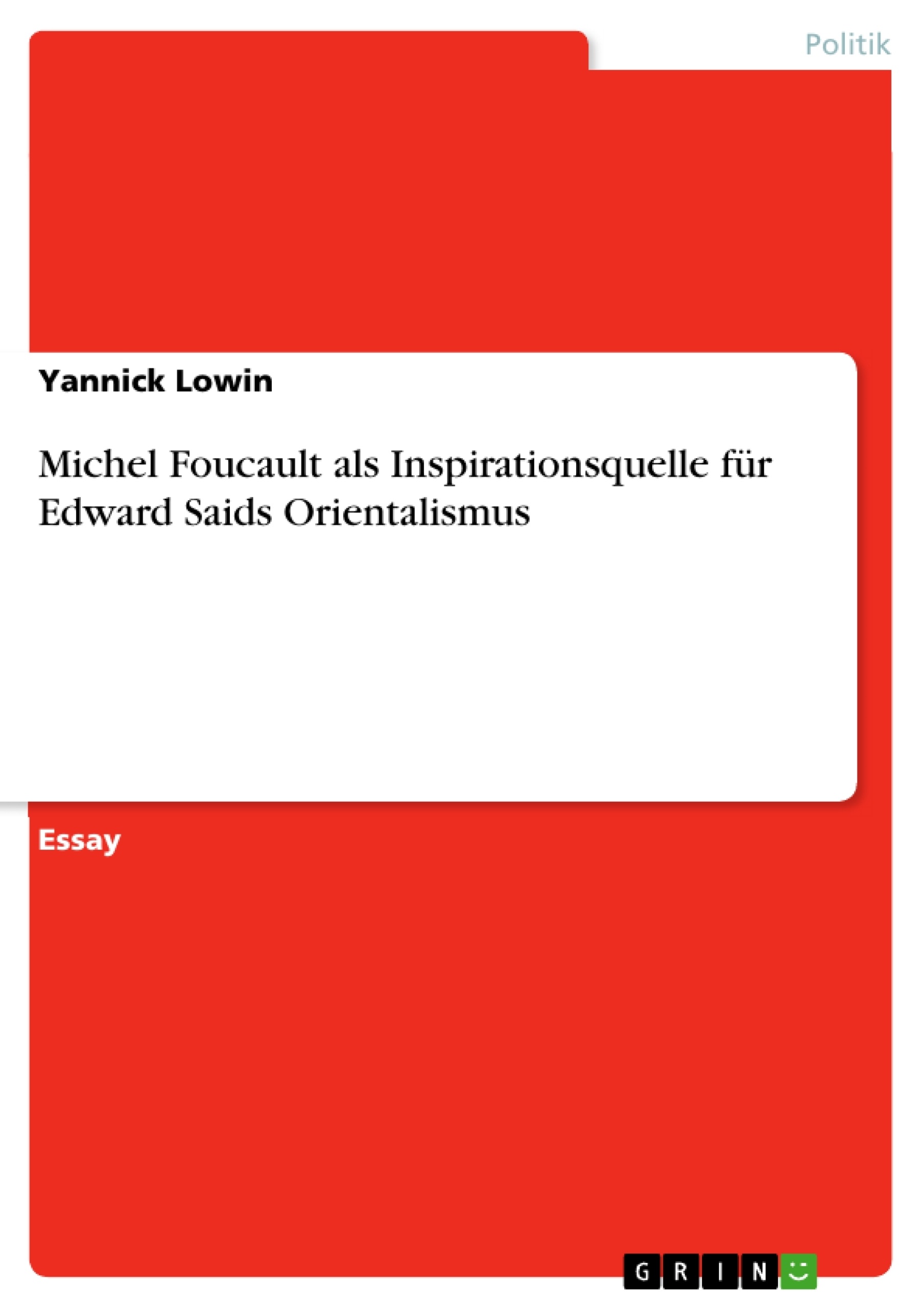In der Geschichtswissenschaft hat es immer wieder Entwicklungsschübe gegeben, die das Fach revolutioniert haben. Dabei wurden neue Perspektiven erschlossen, altbekannte Begriffe mit neuen Inhalten diskutiert und vor allem neue Methoden und Themen vorgeschlagen. Als einer der größten, aber auch kontrovers diskutierten Innovatoren der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften gilt der französische „Allround-Denker“ Michel Foucault. „Es ist die Geschichte der Wahrheitsproduktion, die im Zentrum des Foucaultschen Denkens steht“, bringt es Hannelore Bublitz in einem Sammelband mit dem Titel „Geschichte schreiben mit Foucault“ auf den Punkt. Und treffender könnte man auch eine Einleitung zu Edward Saids viel beachtetem und von der Kritik sehr unterschiedlich aufgenommenem Buch "Orientalism" nicht formulieren, in dem dieser den Orientalismus nicht nur als einen vom Okzident über den Orient entwickelten Diskurs beschreibt sondern soweit geht, zu behaupten, der „Orient“ sei eine nahezu europäische Erfindung.
Der verstorbene Literaturwissenschaftler beruft sich in seinem Werk darauf, mit den von Michel Foucault entwickelten Methoden gearbeitet zu haben. Dazu zählen die Instrumente „Archiv“, „Archäologie“, „Genealogie“ und „Diskurs“, wobei letzterer die zentrale Rolle in Saids Analysen einnimmt. Doch schreibt Edward Said wirklich Geschichte konsequent nach den Vorstellungen Michel Foucaults oder dient ihm dieser vielleicht nicht eher als kongenialer Stichwortgeber?
Inhaltsverzeichnis
- In der Geschichtswissenschaft hat es immer wieder Entwicklungsschübe gegeben, die das Fach revolutioniert haben.
- Der verstorbene Literaturwissenschaftler bemft sich in seinem Werk darauf, mit den von Michel Foucault entwickelten Methoden gearbeitet zu haben.
- Allein anhand dieser komprimierten Darstellung von Saids Werk wird deutlich, dass man dabei nicht ohne einen Rückbezug auf Foucault auskommt.
- Saids Vorhaben in Orientalism ist es, den Diskurs zu enthüllen und seine unterdrückende Systematik freizulegen.
- Alles in allem scham es Said zwar, in der Retrospektive einen Diskurs zu identifizieren, der dichotomisierend und reduzierend in seiner Darstellung des anderen ist, allerdings leitet er dabei den Diskurs aus einer bloßen Tradition ab und damit zurück in die klassische intellektuelle Geschichte.
- Zu Gute halten muss man dem Autor aber, dass die Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes immer sehr delikat und höchst diffizil ist, wenn es darum geht, das Konzept der Diskursanalyse konsequent anzuwenden.
- Edward Said selbst hat Foucault als „source of inspiration and a powerful innovator" beschrieben, und trotz seiner Schwächen in der Anwendung der Diskursanalyse, kann man ohne Weiteres behaupten, dass die reine Präsenz von Foucaults Konzepten Saids Analyse und seinen Blick auf den Orient und das Phänomen Orientalismus nachhaltig geprägt und beeinflusst haben.
- Ich würde mich zudem seiner Auffassung anschließen, dass es nur wemgen Autoren, die mit Foucaults so unglaublich komplexen und widersprüchlichem Konzept der Diskursanalyse gearbeitet haben, gelungen ist, diese wissenschaftliche Theorie perfekt zu meistern bzw. sie überhaupt in ihrem gesamten Ausmaß zu verstehen.
- Die Diskursanalyse sollte meiner Meinung nach eher als Denkanstoß verstanden werden, der dazu beiträgt, seine Augen für neue, andere Themengebiete zu öfften bzw Fragen zu stellen, die bisher noch nicht gestellt wurden und Dinge in Frage zu stellen, die als selbstverständlich hingenommen wurden, oder wie es der Historiker James Clifford gesagt hat, „Foucault-s work will not occupy any permanent ground, but most attack pervert, transgress the ground of truth and meaning wherever they become formulated institutionally".
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Einfluss von Michel Foucaults Werk auf Edward Saids Orientalismus. Sie untersucht, inwieweit Saids Werk von Foucaults Methoden und Konzepten inspiriert wurde und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Denkern bestehen.
- Der Orientalismus als Diskurs und seine Konstruktion des „Orients“
- Die Rolle von Macht und Wissen in der Produktion des Orientalismus
- Die Anwendung von Foucaults Methoden der Diskursanalyse auf den Orientalismus
- Die Kritik an Saids Anwendung von Foucaults Konzepten
- Die Bedeutung von Foucaults Einfluss für Saids Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- In der Einleitung wird der Einfluss von Michel Foucault auf die Geschichtswissenschaft und die Geisteswissenschaften im Allgemeinen beleuchtet. Es wird deutlich gemacht, dass Foucault als ein bedeutender Innovator gilt, dessen Werk bis heute kontrovers diskutiert wird.
- Im zweiten Kapitel wird Edward Saids Orientalismus vorgestellt. Saids Werk wird als eine Kritik am westlichen Diskurs über den Orient verstanden, der den Orient als ein „Konstrukt“ des Okzidents darstellt und eine ungleiche Machtbeziehung zwischen beiden Welten widerspiegelt.
- Im dritten Kapitel wird die Beziehung zwischen Saids Werk und Foucaults Diskursanalyse näher untersucht. Es wird deutlich, dass Said sich von Foucaults Methoden inspirieren ließ, aber gleichzeitig auch von diesen abwich.
- Das vierte Kapitel analysiert die Stärken und Schwächen von Saids Anwendung der Diskursanalyse auf den Orientalismus. Es wird darauf hingewiesen, dass Saids Werk zwar wichtige Erkenntnisse zum Orientalismus liefert, aber gleichzeitig auch einige Kritikpunkte aufwirft.
- Im fünften Kapitel wird der Einfluss von Foucaults Werk auf Saids Orientalismus zusammengefasst. Es wird deutlich gemacht, dass Foucaults Konzept des Diskurses eine zentrale Rolle für Saids Analyse spielt und dass Saids Werk ohne Foucaults Einfluss wohl anders ausgefallen wäre.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Orientalismus, Michel Foucault, Edward Said, Diskursanalyse, Macht, Wissen, Konstruktion des „Orients“, Kritik am westlichen Diskurs, Einfluss von Foucault auf Said, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Foucault und Said.
- Quote paper
- Yannick Lowin (Author), 2011, Michel Foucault als Inspirationsquelle für Edward Saids Orientalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178823