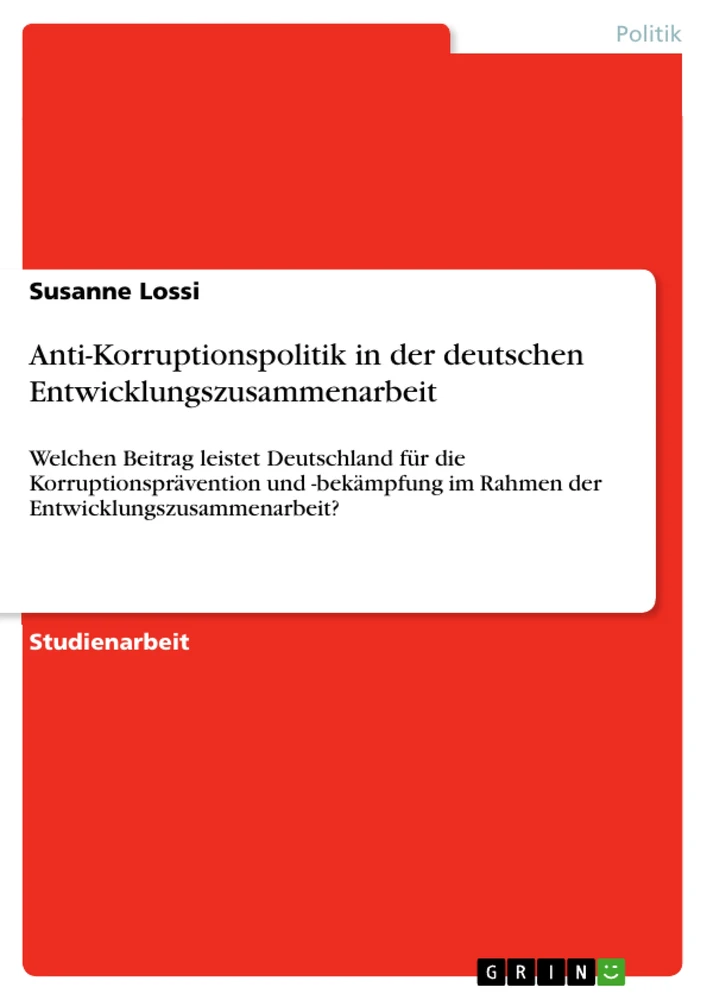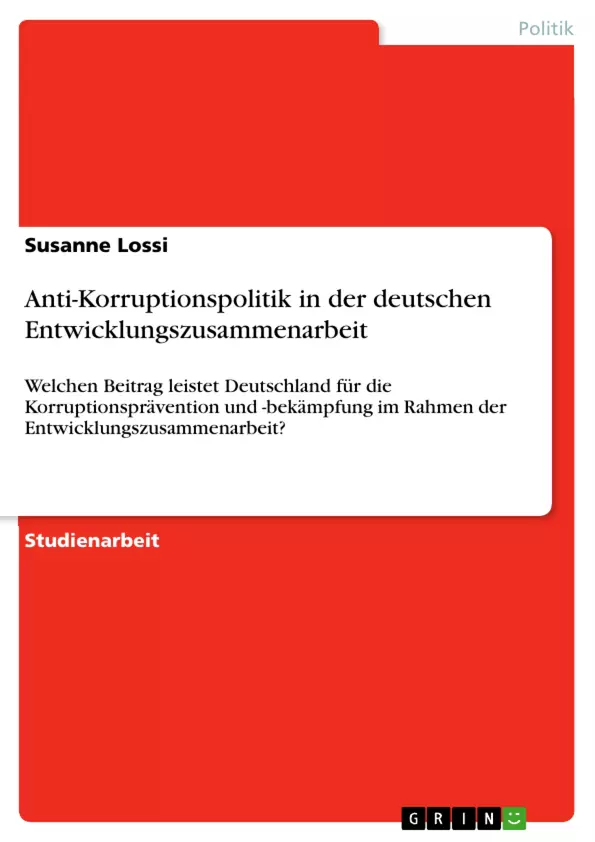Nach der Auflösung des Ost-West Konfliktes liegt der Fokus der Entwicklungszusammenarbeit heute primär auf der Lösung von globalen Problemstellungen. Armut in den Entwicklungsländern bringt auch zunehmend Gefahren für die Industrieländer mit sich. Eine nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen in den Entwicklungsländern ist allerdings nur dann möglich, wenn es der internationalen Staatengemeinschaft gelingt, das Phänomen der Korruption, welches ein ernstes Entwicklungshindernis darstellt, erfolgreich zu bekämpfen.
Diese Arbeit betrachtet den deutschen Beitrag zur Korruptionsprävention in der Entwicklungszusammenarbeit auf der Grundlage der Analyse von ausgewählten Texten. Schwerpunktmäßig sollen Grundlagenkenntnisse bezüglich der aufgeworfenen Fragestellung dargelegt werden.
Die deutschen Maßnahmen zur Reduktion von Korruption zeigen erste Wirkungen hinsichtlich der Transparenz sowie Effektivität der Entwicklungszusammenarbeit und sind grundsätzlich als erfolgreich einzuschätzen. Um jedoch eine nachhaltige Verbesserung der Gesamtsituation in den Entwicklungsländern zu erzielen, muss dieser eingeschlagene Weg konsequent weiter gegangen werden. Insbesondere eine Mittelerhöhung und eine gesteigerte Öffentlichkeitswahrnehmung sollten in diesem Zusammenhang von Deutschland angestrebt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anti-Korruptionspolitik – Ein Schlüsselthema innerhalb der deutschen Entwicklungspolitik
- Korruption, Entwicklung und „Good Governance“
- Welchen Nutzen kann Korruption entfalten? - Eine kritische Abwägung der Vor- und Nachteile von Korruption
- Förderung des Wettbewerbes?
- Beschleunigung der bürokratischen Arbeitsweise?
- Anreiz für qualifizierte Beamte?
- Einnahmen aus Korruption als Quelle der Kapitalbildung?
- Schutz von Minderheiten?
- Zusammenfassung
- Die Entwicklung der deutschen Entwicklungs- und Anti-Korruptionspolitik
- Der deutsche Beitrag zur Korruptionsprävention und- bekämpfung
- Der deutsche Beitrag in der internationalen Zusammenarbeit
- Der deutsche Beitrag in der bilateralen Zusammenarbeit
- Korruptionsprävention in Deutschland
- Verbesserungsvorschläge innerhalb der deutschen Entwicklungspolitik
- Ergebnis und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den deutschen Beitrag zur Korruptionsprävention und -bekämpfung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Sie analysiert die Notwendigkeit einer Anti-Korruptionspolitik in der Entwicklungspolitik und beleuchtet die Geschichte der deutschen Entwicklungs- und Anti-Korruptionspolitik. Darüber hinaus werden die verschiedenen Handlungsschwerpunkte und -orte der deutschen Anti-Korruptionspolitik, insbesondere die Anstrengungen in der multilateralen und bilateralen Zusammenarbeit, sowie die Korruptionsprävention in Deutschland selbst, beleuchtet. Die Arbeit erörtert schließlich mögliche Maßnahmen und Überlegungen für eine nachhaltige Verbesserung der deutschen Entwicklungspolitik in Bezug auf Korruptionsprävention.
- Die Bedeutung von „Good Governance“ und Korruptionsprävention für die Entwicklungszusammenarbeit
- Die Rolle von Korruption als Entwicklungshindernis
- Die historischen Entwicklungen der deutschen Entwicklungs- und Anti-Korruptionspolitik
- Die Strategien der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zur Korruptionsprävention und -bekämpfung auf internationaler und bilateraler Ebene
- Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der deutschen Entwicklungspolitik in Bezug auf Korruptionsprävention
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Korruptionsprävention für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit dar. Kapitel 2 diskutiert die Bedeutung von Anti-Korruptionspolitik in der Entwicklungspolitik, beleuchtet die Vor- und Nachteile von Korruption, analysiert die Entwicklung der deutschen Entwicklungs- und Anti-Korruptionspolitik und untersucht den deutschen Beitrag zur Korruptionsprävention und -bekämpfung auf internationaler und bilateraler Ebene sowie in Deutschland selbst. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf mögliche Maßnahmen und Überlegungen für eine nachhaltige Verbesserung der deutschen Entwicklungspolitik in Bezug auf Korruptionsprävention.
Schlüsselwörter
Korruption, Entwicklungszusammenarbeit, Anti-Korruptionspolitik, Good Governance, Transparenz, Effektivität, multilaterale Zusammenarbeit, bilaterale Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Armutsbekämpfung, Wirtschaftswachstum.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Anti-Korruptionspolitik wichtig für die Entwicklungshilfe?
Korruption gilt als eines der größten Entwicklungshindernisse, da sie Ressourcen verschwendet, den Wettbewerb verzerrt und die Wirksamkeit von Hilfsprojekten untergräbt.
Was versteht man unter "Good Governance"?
Good Governance bezeichnet eine gute, transparente und verantwortungsvolle Regierungsführung, die als Grundvoraussetzung für nachhaltige Entwicklung und Korruptionsprävention gilt.
Wie engagiert sich Deutschland bilateral gegen Korruption?
In der bilateralen Zusammenarbeit unterstützt Deutschland Partnerländer direkt durch Beratung, den Aufbau von Kontrollinstanzen und die Förderung von Transparenz in der Verwaltung.
Gibt es "Nutzen" von Korruption?
Die Arbeit wägt kritisch ab, ob Korruption bürokratische Prozesse beschleunigen kann, kommt jedoch zu dem Schluss, dass die langfristigen Schäden für die Gesellschaft überwiegen.
Welche Verbesserungsvorschläge nennt der Text für die deutsche Politik?
Empfohlen werden eine Erhöhung der finanziellen Mittel für Anti-Korruptionsprogramme sowie eine stärkere Sensibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Thema.
- Citar trabajo
- Susanne Lossi (Autor), 2011, Anti-Korruptionspolitik in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178839