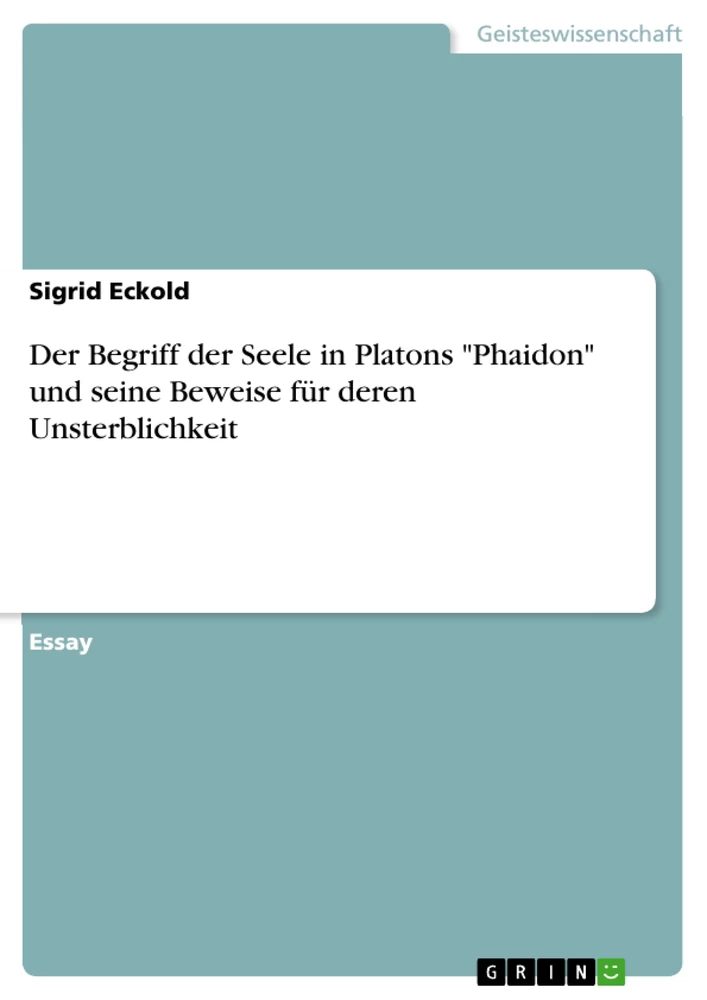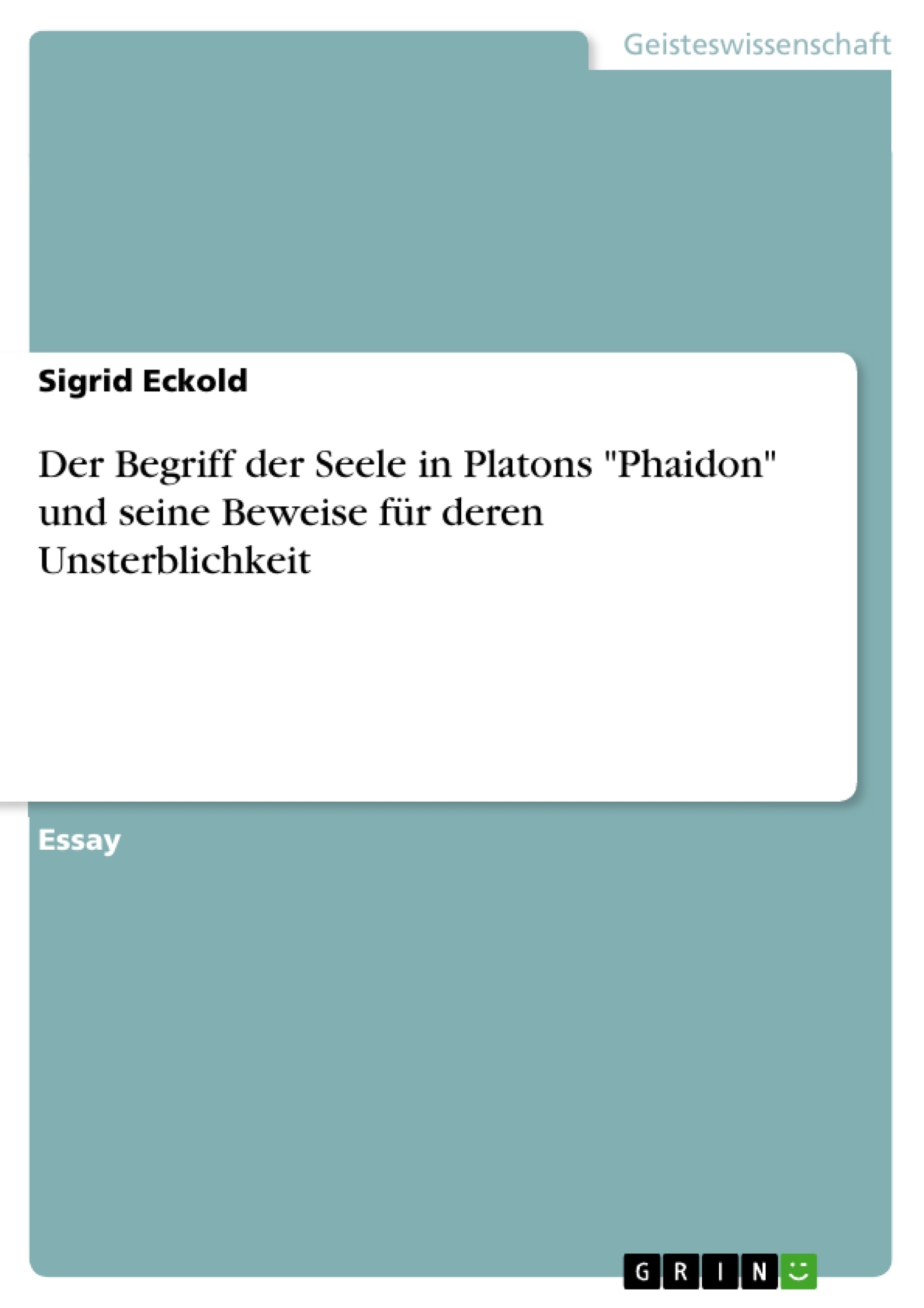Der Begriff der Seele in Platons Phaidon und seine Beweise für deren Unsterblichkeit
Der Dialog Phaidon gehört zur mittleren Periode der Werke Platons. Datiert um 387 v. Chr., der Rückkehr Platons von Italien, Sizilien und Aegina, also noch vor dem Symposion Er ist dem ersten Eindruck nach ein "Denkmal auf Sokrates", der angesichts seines bevorstehenden Todes mit seinen Weggefährten im Philosophieren über das Thema der Unsterblichkeit der Seele spricht. Der Erzähler Phaidon berichtet dem Zuhörer Echekrates (einem Schüler der Phytagoreer Philolaus und Eurytus, sowie auch Sokrates). Die Zeitspanne zwischen der Verurteilung Sokrates und seinem Tod ergab sich, so berichtet Phaidon Echekrates, aus der rituellen Wiederholung der Theseusfahrt nach Delos, die Zwischenstation Theseus auf seiner Heimfahrt nach Athen, nachdem er in Kreta den Minotauros getötet hat. Die Befreiung der Opfer und in der Konsequenz die Befreiung seiner Vaterstadt Athen wurde jedes Jahr feierlich mit einem Festzug für Apollon nach Delos begangen. Während dieser Zeit musste Athen rein gehalten werden, weshalb niemand getötet werden durfte. Sobald das Schiff aus Delos zurückkam, erhielt Sokrates die Nachricht seines nun bevorstehenden Todes. Im Gefängnis versammeln sich deshalb seine Gefährten, um in der Stunde seines Todes dabei zu sein. Es waren ziemlich viele seiner Gefährten zugegen, nur Platon war krank. Auch Simmias und Kebes, Schüler des Philolaus wurden als anwesende Fremde genannt.
Das philosophische Gespräch wird von Sokrates eröffnet, indem er nach der Lösung seiner Fesseln durch die Elfmänner über den Gegensatz des Angenehmen zum Unangenehmen, der Lust zum Schmerz reflektiert. Damit löst sich Sokrates aus dem naturalen Geschehen seines bevorstehenden Todes, welches unreflektierte Affekte bei seinen Jüngern und bei seiner Frau Xanthippe auslöst.
Inhaltsverzeichnis
- Der Begriff der Seele in Platons Phaidon und seine Beweise für deren Unsterblichkeit
- Seele und der Tod
- Platons Seelenbegriff
- Die Unsterblichkeitsbeweise in Platons Phaidon
- 1. Im Rückgriff auf einen Mythos entwickelt Sokrates das Argument der zyklischen Wiederkehr der Seelen
- 2. Zweiter Unsterblichkeitsbeweis - Die Anamnesislehre
- 3. Unsterblichkeitsbeweis: Die beiden Gattungen des Seins - Das Unwandelbare und das Wandelbare
- Die Kritik Sokrates an den Naturphilosophen:
- Kritik an Anaxagoras:
- 4. Unsterblichkeitsbeweis und Uberleitung zur Klimax der Genesis der Ideenlehre:
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert den Begriff der Seele in Platons Dialog "Phaidon" und untersucht die von Sokrates vorgebrachten Beweise für die Unsterblichkeit der Seele. Der Fokus liegt auf der philosophischen Argumentation Platons, die sich mit der Natur der Seele, ihrer Beziehung zum Körper und der Frage nach dem Leben nach dem Tod auseinandersetzt.
- Platons Seelenbegriff und seine Abgrenzung von den Naturphilosophen
- Die Unsterblichkeitsbeweise im Phaidon und ihre Argumentationsstruktur
- Die Rolle der Ideenlehre in Platons Philosophie und ihre Bedeutung für die Unsterblichkeitsbeweise
- Die Kritik an den Naturphilosophen und ihre Auswirkungen auf Platons eigene Philosophie
- Die Beziehung zwischen Sein und Werden in Platons Denken
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einführung in den Dialog "Phaidon" und setzt den Kontext für die philosophische Diskussion über die Unsterblichkeit der Seele. Er beleuchtet die Situation Sokrates kurz vor seinem Tod und die philosophischen Gespräche, die er mit seinen Schülern führt.
Im Anschluss werden die verschiedenen Beweise für die Unsterblichkeit der Seele analysiert, die Sokrates im Dialog "Phaidon" vorbringt. Der erste Beweis basiert auf dem Mythos der Seelenwanderung und der zyklischen Wiederkehr. Der zweite Beweis bezieht sich auf die Anamnesislehre, die besagt, dass die Seele über ein angeborenes Wissen verfügt, das durch Erinnerung wiedererlangt werden kann. Der dritte Beweis argumentiert, dass die Seele aufgrund ihrer Verbindung zu den unveränderlichen Ideen selbst unsterblich sein muss.
Der Text beleuchtet auch die Kritik Sokrates an den Naturphilosophen und deren Erklärungen für das Entstehen und Vergehen. Er zeigt auf, wie Platons eigene Philosophie sich von diesen Ansätzen unterscheidet und wie er eine neue Sichtweise auf die Natur der Welt und die Rolle der Vernunft entwickelt.
Schließlich geht der Text auf die Bedeutung der Ideenlehre für Platons Philosophie ein und zeigt, wie diese Lehre die Grundlage für die Unsterblichkeitsbeweise bildet. Er analysiert die Beziehung zwischen Sein und Werden und die Rolle der Ideen als unveränderliche und transzendente Prinzipien.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Platons Philosophie, den Dialog "Phaidon", die Seele, Unsterblichkeit, Ideenlehre, Anamnesis, Naturphilosophie, Sein und Werden, Kritik an den Naturphilosophen, Sokrates.
Häufig gestellte Fragen
In welchem Werk Platons werden die Beweise für die Unsterblichkeit der Seele dargelegt?
Die Beweise finden sich im Dialog „Phaidon“, der zur mittleren Schaffensperiode Platons gehört.
Was ist der historische Kontext des Dialogs?
Der Dialog schildert die letzten Stunden des Sokrates im Gefängnis vor seinem Tod durch den Schierlingsbecher.
Welche drei Hauptbeweise für die Unsterblichkeit werden im Text genannt?
Sokrates führt das Argument der zyklischen Wiederkehr (Mythos), die Anamnesislehre (Wiedererinnerung) und die Verwandtschaft der Seele mit den unwandelbaren Ideen an.
Was besagt die Anamnesislehre?
Die Anamnesislehre geht davon aus, dass die Seele über angeborenes Wissen aus der Zeit vor der Geburt verfügt, an das sie sich durch philosophische Reflexion erinnern kann.
Warum kritisiert Sokrates die Naturphilosophen?
Er kritisiert sie (insbesondere Anaxagoras), weil sie Entstehung und Vergehen rein materiell erklären und die Rolle der Vernunft (Nous) vernachlässigen.
- Quote paper
- M.A.phil. Sigrid Eckold (Author), 1995, Der Begriff der Seele in Platons "Phaidon" und seine Beweise für deren Unsterblichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178856