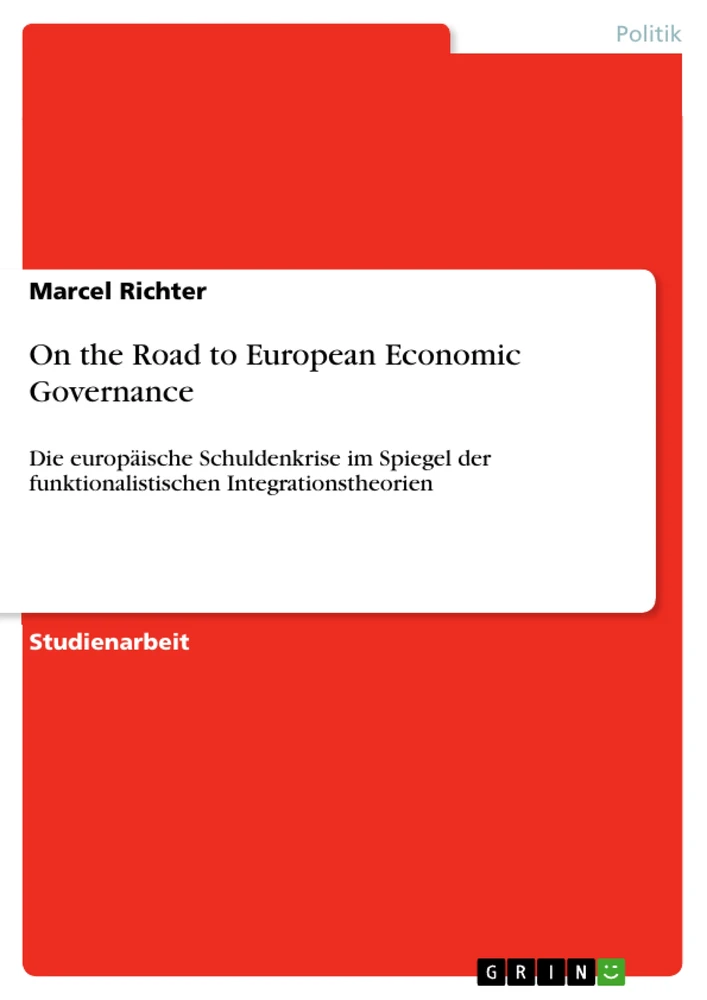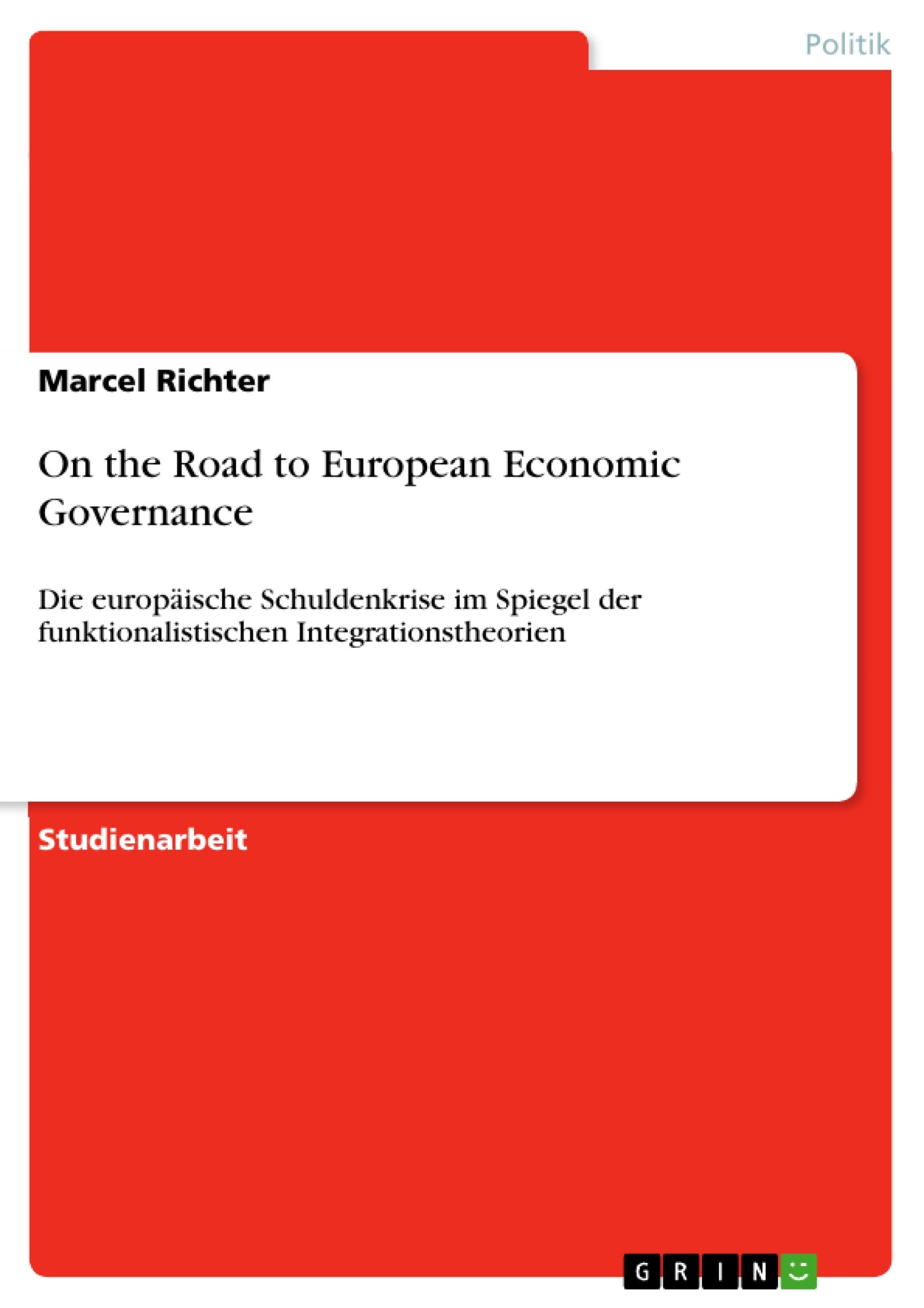„Der Europäische Wirtschafts- und Währungsraum droht auseinanderzubrechen“. So ähnlich lauteten 2011 die Schlagzeilen, wenn es darum ging, die dramatische Lage der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) zu beschreiben. Die eigentlichen Probleme des europäischen Währungsraums begannen mit dem Bekanntwerden des griechischen Haushaltsdefizits von 2009 woraufhin Griechenland drohte, seine Schulden aus eigener Kraft nicht merh refinanzieren zu können. In dieser Situation trafen sich die Staats- und Regierungschefs der Euro- Staaten am 7. Mai 2010 zu einer Sondersitzung in Brüssel und beschlossen unter großem Zeitdruck die Einrichtung eines provisorischen „Europäischen Finanz- Stabilisierungsmechanismus“ (EFSM). Seitdem haben die europäischen Staaten ein immer komplexeres System zur Kontrolle und Aufsicht der Finanzmärkte und der Haushaltspolitiken angeschlagener Staaten entwickelt.
In dem Versuch, eine Erklärung für die Entstehung der Krise abzugeben, wird in der öffentlichen Diskussion oft auf die mangelnde Haushaltsdisziplin der südlichen Euroländer verwiesen. Mit Anhalten der Krise und ihrer Ausbreitung auf andere Länder der EU wurde jedoch deutlich, dass dieser Erklärungsansatz wahrscheinlich zu kurz greift. Dazu passt, dass namhafte Ökonomen bereits bei der Einführung des Euro prophezeiten, „der Euro werde seine erste große Krise nicht überstehen“. Der Kern der Kritik lag für sie in der Annahme, dass einer Währungsunion notwendigerweise ein einheitlicher Wirtschaftsraum vorausgehen müsse. Die EU dagegen bestehe weiterhin aus einer Vielzahl von Wirtschaftsräumen. Hieraus ließen sich nun Forderungen ableiten nach einer Verlagerung wirtschaftspolitischer Kompetenzen auf die supranationale Ebene der EU, um so eine Vereinheitlichung des europäischen wirtschaftsraumes zu erreichen.
Die Hausarbeit widmet sich nun den Frage, ob die bisherigen Schritte zur Bekämpfung der Krise bereits zu einer Vertiefung der Integration der Währungs- und Wirtschaftspolitik der EU geführt haben. Außerdem wird untersucht, wie es zu diesen Schritten kam. Die vorläufige Antwort auf diese Fragen stellt gleichzeitig die Leitthese des Aufsatzes dar:
Die Konstruktion der Währungs- und Wirtschaftsunion im Vertrag von Maastricht löste eine Eigendynamik aus, die, verstärkt durch die aktuelle Krise, zu einer Vertiefung der Integration in der Wirtschaftspolitik geführt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Die europäische Schuldenkrise - Eine strukturelle Krise?
- Form Follows Function - Zur funktionalistischen Theoriebildung
- Shift towards Supranationalism – Die Schuldenkrise als Katalysator für die Vertiefung der Integration
- Intergovernmental Bargain or Spillover? - Das Überschwappen der Integration auf die Haushaltspolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die europäische Schuldenkrise im Lichte funktionalistischer Integrationstheorien. Ziel ist es, die Rolle der Krise als Katalysator für die Vertiefung der europäischen Integration zu untersuchen und die Frage zu beleuchten, inwiefern die Krise auf strukturelle Mängel im europäischen Wirtschafts- und Währungsraum zurückzuführen ist.
- Funktionalistische Integrationstheorien und ihre Relevanz für die Analyse der europäischen Schuldenkrise
- Die europäische Schuldenkrise als Katalysator für die Vertiefung der Integration
- Die Rolle von supranationalen Institutionen in der Krisenbewältigung
- Strukturelle Mängel des europäischen Wirtschafts- und Währungsraums
- Die Auswirkungen der Krise auf die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die europäische Schuldenkrise - Eine strukturelle Krise? Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der europäischen Schuldenkrise, die ihren Ursprung in der internationalen Finanzkrise von 2007 hat. Es analysiert die Rolle des griechischen Haushaltsdefizits von 2009 als Auslöser der Krise und die darauf folgenden Rettungsmaßnahmen der europäischen Staaten.
- Kapitel 2: Form Follows Function - Zur funktionalistischen Theoriebildung In diesem Kapitel werden die Grundlagen funktionalistischer Integrationstheorien vorgestellt. Es wird erläutert, wie die Integrationsprozesse in der Europäischen Union durch die Funktionalität und den Bedarf an gemeinsamen Lösungen in verschiedenen Politikbereichen vorangetrieben werden.
- Kapitel 3: Shift towards Supranationalism – Die Schuldenkrise als Katalysator für die Vertiefung der Integration Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Schuldenkrise als Katalysator für die Vertiefung der europäischen Integration. Es analysiert die Erweiterung der Kompetenzen supranationaler Institutionen, insbesondere im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik, und die damit verbundenen Auswirkungen auf die intergouvernementalen Beziehungen innerhalb der EU.
- Kapitel 4: Intergovernmental Bargain or Spillover? - Das Überschwappen der Integration auf die Haushaltspolitik Das Kapitel befasst sich mit der Frage, inwiefern die Schuldenkrise zu einer Verlagerung von Kompetenzen in der Haushaltspolitik geführt hat. Es untersucht die verschiedenen Modelle der Integrationstheorie und analysiert, ob es zu einem „Spillover“ von der Währungspolitik auf die Haushaltspolitik gekommen ist.
Schlüsselwörter
Europäische Schuldenkrise, funktionalistische Integrationstheorie, supranationale Integration, Wirtschafts- und Währungsunion, Haushaltspolitik, Finanzmärkte, Stabilitätskriterien, Konvergenzkriterien, PIIGS-Staaten, Euro-Krise.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser der europäischen Schuldenkrise ab 2009?
Der Auslöser war das Bekanntwerden des massiven griechischen Haushaltsdefizits, was zu Refinanzierungsschwierigkeiten und einer Vertrauenskrise an den Finanzmärkten führte.
Was besagt die funktionalistische Integrationstheorie?
Sie geht davon aus, dass Integration in einem Bereich (z.B. Währung) einen Sachzwang zur Integration in benachbarten Bereichen (z.B. Haushaltspolitik) erzeugt (sog. Spillover-Effekt).
Hat die Krise die europäische Integration vertieft?
Ja, die Krise wirkte als Katalysator für die Schaffung supranationaler Kontrollmechanismen wie den EFSM und eine engere Abstimmung der Wirtschaftspolitik.
Was ist das Problem unterschiedlicher Wirtschaftsräume in der Eurozone?
Kritiker argumentieren, dass eine einheitliche Währung ohne eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik (European Economic Governance) strukturell instabil ist.
Welche Rolle spielten die PIIGS-Staaten in der Krise?
Als PIIGS-Staaten (Portugal, Italien, Irland, Griechenland, Spanien) wurden die Länder bezeichnet, die besonders stark von hohen Staatsschulden und wirtschaftlichen Ungleichgewichten betroffen waren.
- Arbeit zitieren
- Marcel Richter (Autor:in), 2011, On the Road to European Economic Governance, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178887