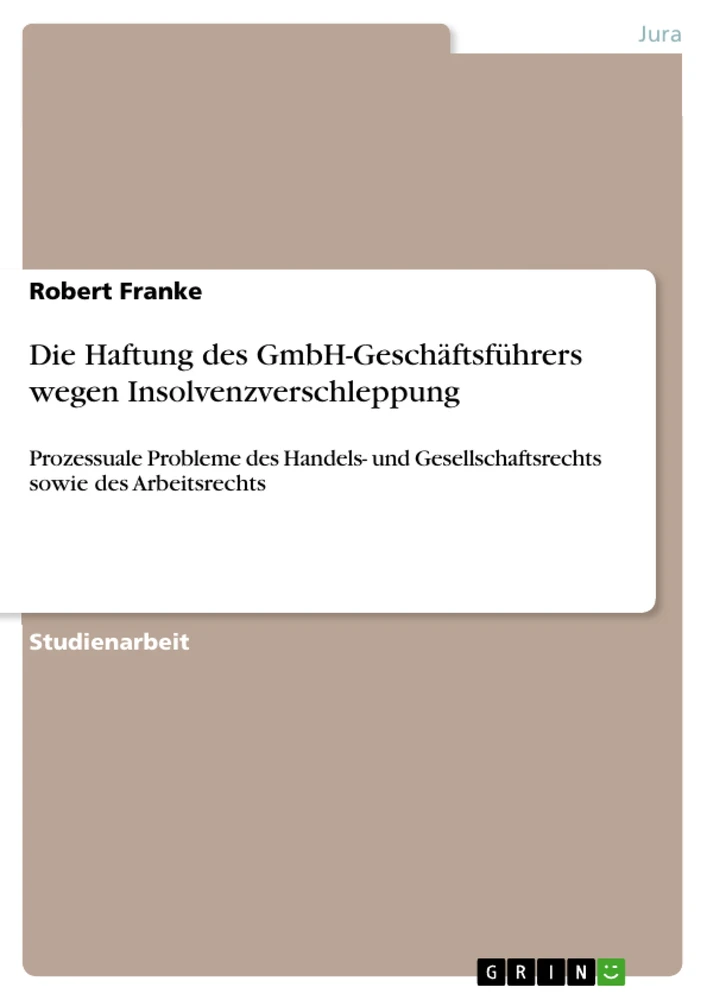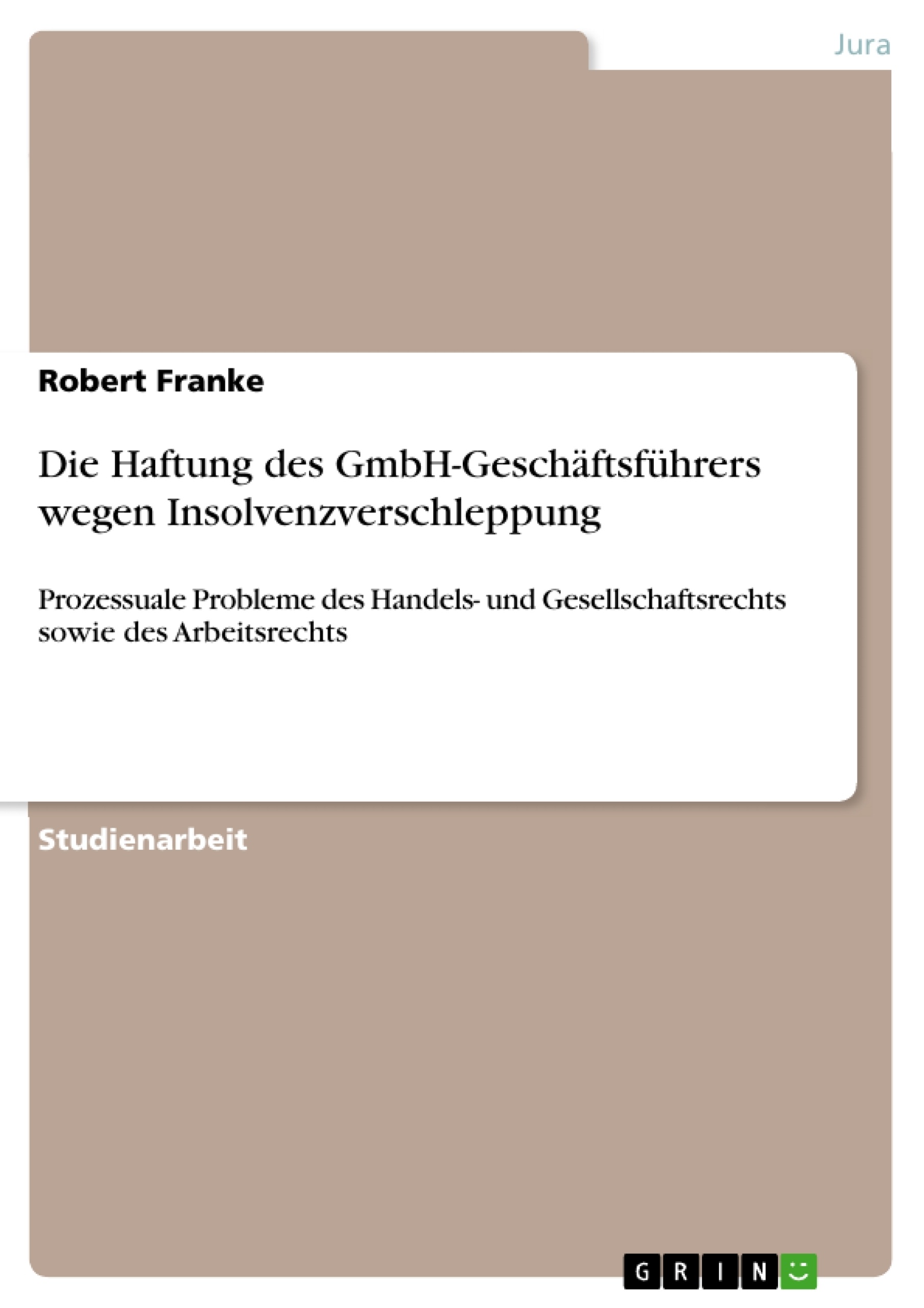Die vorliegende Arbeit behandelt die Auswirkungen der Insolvenzverschleppung durch den GmbH-Geschäftsführer sowohl im Innenverhältnis zu den Gesellschaftern und der Gesellschaft als auch im für die Praxis bedeutsamen Außenverhältnis zu Dritten. Auf eine ausführliche Darstellung des Insolvenzverfahrens soll hier, wenngleich allgemeine Ausführungen dazu zum besseren Verständnis und zur Einordnung der Probleme unerlässlich sind, verzichtet werden. Gleiches gilt für die allgemeine Haftung des Geschäftsführers aus Vertrag oder bei Inanspruchnahme besonderen Vertrauens. Auch die strafrechtlichen Beurteilung des Geschäftsführerhandelns bei Insolvenzverschleppung soll hier weitestgehend unberücksichtigt bleiben. Gleiches gilt für die Bewertung der Haftung bei nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen und Steuerverbindlichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Die GmbH in der Krise
- I.) Insolvenzreife und Entstehung der Insolvenzantragspflicht
- 1.) Krisenbegriff
- 2.) Das Insolvenzverfahren im Überblick
- 3.) Problem der masselosen Insolvenz
- 4.) Insolvenzgründe
- a) drohende Zahlungsunfähigkeit
- b) Zahlungsunfähigkeit
- c) Überschuldung
- II.) Insolvenzantragspflicht
- 1.) durch Geschäftsführer
- 2.) durch den faktischen Geschäftsführer
- 3.) bei Führungslosigkeit
- 4.) durch den Gesellschaftsgläubiger
- 5.) Antragsfrist
- I.) Insolvenzreife und Entstehung der Insolvenzantragspflicht
- C) Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft
- I.) Allgemeines
- II.) Zahlungsanweisungen
- 1.) Zahlungen vor Insolvenzreife
- 2.) Zahlungen nach Insolvenzreife
- 3.) privilegierte Zahlungen
- 4.) Verschulden
- III.) Haftungsumfang
- IV.) Anspruchsberechtigter und Geltendmachung
- V.) Verjährung
- D) Haftung des Geschäftsführers gegenüber Dritten
- I.) Allgemeines
- II.) Insolvenzverschleppung
- 1.) Haftungsumfang
- a) Quotenschaden der Altgläubiger
- b) individueller Schaden der Neugläubiger
- c) keine Ungleichbehandlung
- 2.) Verschulden
- 3.) Beweislast
- 4.) Geltendmachung der Schäden
- a) Altgläubiger
- b) Neugläubiger
- 5.) Verjährung
- 1.) Haftungsumfang
- E) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Haftung des GmbH-Geschäftsführers im Falle von Insolvenzverschleppung. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, die verschiedenen Haftungsformen und die damit verbundenen Konsequenzen.
- Insolvenzreife und die Entstehung der Insolvenzantragspflicht
- Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft
- Haftung des Geschäftsführers gegenüber Dritten
- Der Umfang der Haftung bei Insolvenzverschleppung
- Beweislast und Geltendmachung von Schäden
Zusammenfassung der Kapitel
A) Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Haftung des GmbH-Geschäftsführers bei Insolvenzverschleppung ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie umreißt die zentrale Fragestellung und die methodische Vorgehensweise.
B) Die GmbH in der Krise: Dieses Kapitel analysiert die GmbH in einer finanziellen Krisensituation. Es definiert den Krisenbegriff, erläutert das Insolvenzverfahren und die verschiedenen Insolvenzgründe (drohende Zahlungsunfähigkeit, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung). Besondere Aufmerksamkeit gilt der Insolvenzantragspflicht des Geschäftsführers unter verschiedenen Szenarien, einschließlich der Fälle von faktischem Geschäftsführer oder Führungslosigkeit, und der Bedeutung der Antragsfrist. Die Komplexität der Masselosigkeit bei Insolvenzen wird ebenfalls beleuchtet.
C) Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit der Haftung des GmbH-Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft selbst. Es untersucht allgemeine Aspekte der Haftung, analysiert die Problematik von Zahlungsanweisungen vor und nach Eintritt der Insolvenzreife, einschließlich privilegierter Zahlungen und deren Einfluss auf die Haftung. Die Bestimmung des Haftungsumfangs, die Anspruchsberechtigten und die Geltendmachung des Anspruchs sowie die Verjährungsfristen werden detailliert betrachtet.
D) Haftung des Geschäftsführers gegenüber Dritten: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Haftung des GmbH-Geschäftsführers gegenüber Dritten im Kontext der Insolvenzverschleppung. Es analysiert den Haftungsumfang, der sich aus dem Quotenschaden der Altgläubiger und dem individuellen Schaden der Neugläubiger zusammensetzt, und die Bedeutung des Verschuldens sowie der Beweislastverteilung. Die Geltendmachung der Ansprüche durch Alt- und Neugläubiger sowie die Verjährungsfristen werden ebenfalls ausführlich behandelt. Die Thematik der Ungleichbehandlung wird kritisch beleuchtet und in ihrer Relevanz für die Rechtspraxis diskutiert.
Schlüsselwörter
GmbH-Geschäftsführer, Insolvenzverschleppung, Haftung, Insolvenzreife, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenzantragspflicht, Quotenschaden, Gläubigerschutz, Verschulden, Beweislast, Verjährung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Haftung des GmbH-Geschäftsführers bei Insolvenzverschleppung
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit der Haftung des Geschäftsführers einer GmbH im Fall von Insolvenzverschleppung. Er analysiert die rechtlichen Grundlagen, die verschiedenen Haftungsformen gegenüber der Gesellschaft und Dritten, und die damit verbundenen Konsequenzen. Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende zentrale Themen: Insolvenzreife und die Entstehung der Insolvenzantragspflicht, die Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft (einschließlich Zahlungsanweisungen vor und nach Insolvenzreife), die Haftung des Geschäftsführers gegenüber Dritten im Kontext der Insolvenzverschleppung (mit Fokus auf Quotenschaden der Altgläubiger und individuellen Schaden der Neugläubiger), den Umfang der Haftung bei Insolvenzverschleppung, die Beweislastverteilung und die Geltendmachung von Schäden sowie die Verjährungsfristen.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in fünf Abschnitte (A-E) gegliedert: Einleitung, Die GmbH in der Krise (inkl. Insolvenzantragspflicht), Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft, Haftung des Geschäftsführers gegenüber Dritten und Fazit. Jeder Abschnitt gliedert sich weiter in Unterkapitel und Unterpunkte, die die einzelnen Aspekte der Geschäftsführerhaftung detailliert behandeln.
Was versteht der Text unter Insolvenzreife und Insolvenzantragspflicht?
Der Text definiert den Begriff der Insolvenzreife und erläutert die verschiedenen Insolvenzgründe (drohende Zahlungsunfähigkeit, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung). Er beschreibt die Insolvenzantragspflicht des Geschäftsführers unter verschiedenen Szenarien (z.B. faktischer Geschäftsführer, Führungslosigkeit) und die Bedeutung der Antragsfrist. Die Problematik der masselosen Insolvenz wird ebenfalls beleuchtet.
Wie wird die Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft behandelt?
Dieser Abschnitt analysiert die Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft, insbesondere im Zusammenhang mit Zahlungsanweisungen vor und nach Eintritt der Insolvenzreife. Es werden privilegierte Zahlungen, der Haftungsumfang, die Anspruchsberechtigten, die Geltendmachung des Anspruchs und die Verjährungsfristen detailliert untersucht.
Wie wird die Haftung des Geschäftsführers gegenüber Dritten behandelt?
Der Text konzentriert sich auf die Haftung des Geschäftsführers gegenüber Dritten im Fall von Insolvenzverschleppung. Hier werden der Haftungsumfang (Quotenschaden der Altgläubiger, individueller Schaden der Neugläubiger), das Verschulden, die Beweislastverteilung, die Geltendmachung der Ansprüche durch Alt- und Neugläubiger und die Verjährungsfristen umfassend erläutert. Die Thematik der Ungleichbehandlung wird kritisch diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind im Text relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: GmbH-Geschäftsführer, Insolvenzverschleppung, Haftung, Insolvenzreife, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenzantragspflicht, Quotenschaden, Gläubigerschutz, Verschulden, Beweislast, Verjährung.
- Quote paper
- Robert Franke (Author), 2011, Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers wegen Insolvenzverschleppung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178973