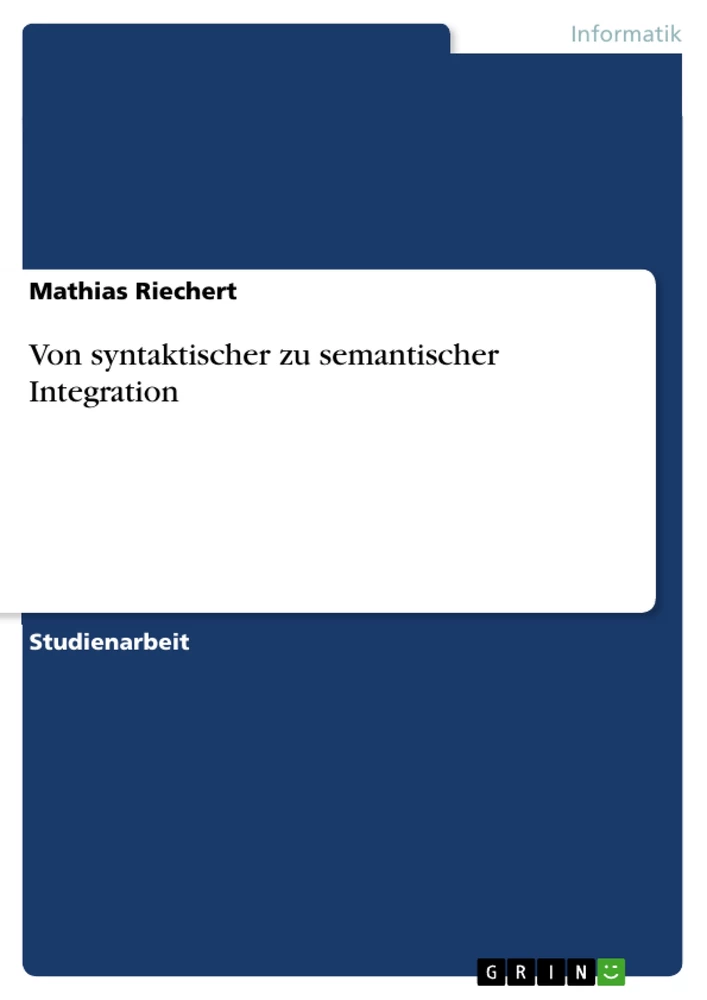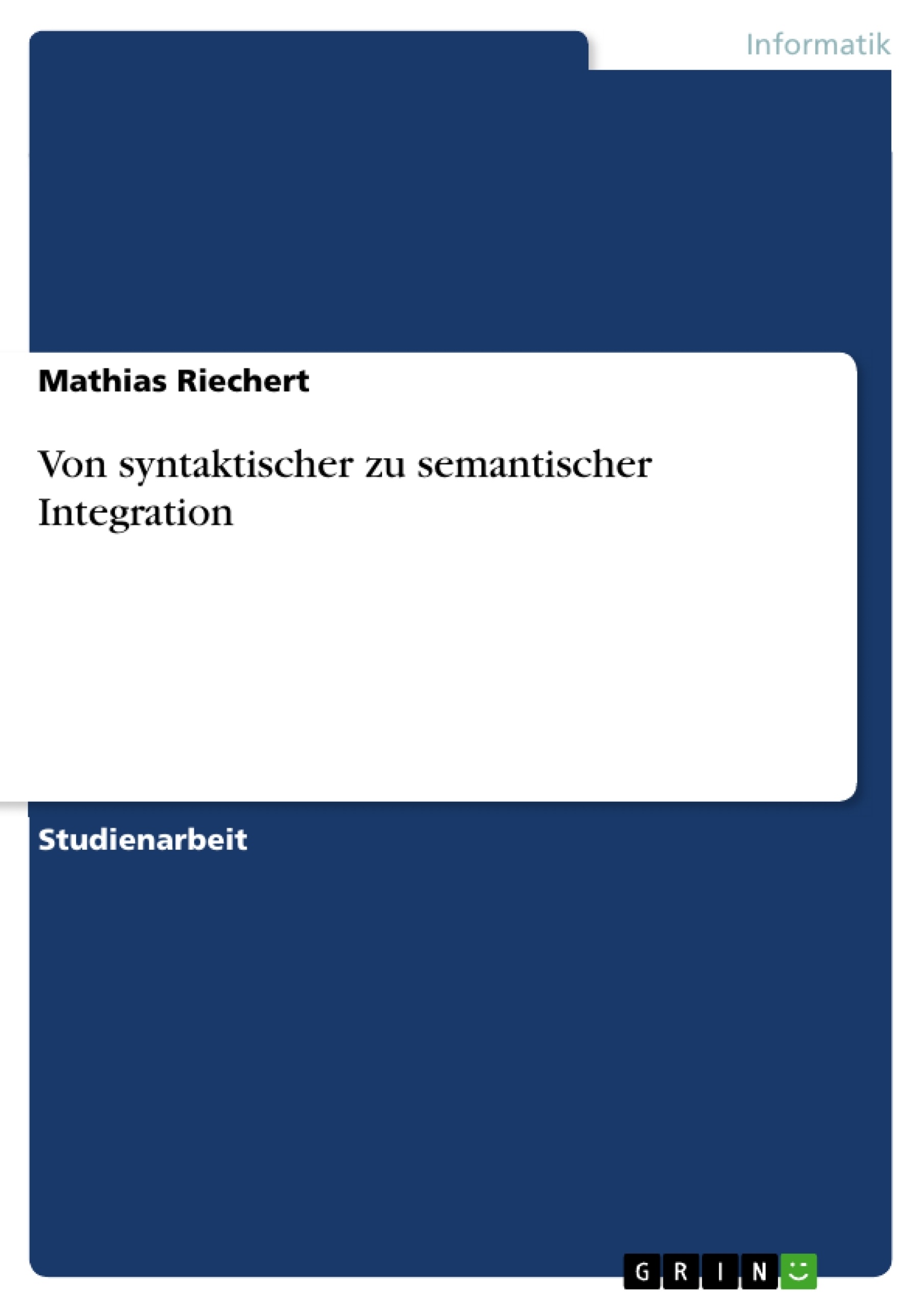Die Integration von Enterprise Integration Systems (EIS) ist besonders für große und dynamische Firmen wichtig (vgl. Izza, 2009, S. 1), um der steigenden Vernetzungskomplexität gerecht zu werden. Ziel ist die Entwicklung eines anwendungs-, abteilungs- und plattformübergreifenden Informationssystems. Die vorliegende Arbeit untersucht Technologien der syntaktischen Anwendungsintegration und vergleicht sie mit semantischen Integrationstechnologien, um Potentiale und Risiken der Entwicklung zu identifizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabelleverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffliche Grundlagen
- 2.1 Informationssysteme
- 2.2 Integration
- 3 Von syntaktischer zu semantischer Integration
- 3.1 Syntaktische Integration
- 3.1.1 Ad hoc Techniken
- 3.1.2 Standardisierung
- 3.1.3 Middleware
- 3.1.4 Enterprise Application Integration (EAI)
- 3.1.5 Business Process Management (BPM)
- 3.1.6 Service-oriented Architectures (SOA)
- 3.1.7 Zusammenfassung syntaktische Integration
- 3.2 Semantische Integration
- 3.2.1 Ontologiebasierte Integration
- 3.3 Vergleich syntaktische / semantische Integration
- 3.1 Syntaktische Integration
- 4 Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Integration von Enterprise Information Systems (EIS) und untersucht die Entwicklung von einem anwendungs-, abteilungs- und plattformübergreifenden Informationssystem. Die Arbeit analysiert Technologien der syntaktischen Anwendungsintegration und vergleicht sie mit semantischen Integrationstechnologien, um Potentiale und Risiken der Entwicklung zu identifizieren.
- Begriffliche Grundlagen der Integration von Informationssystemen
- Untersuchung und Bewertung von Technologien der syntaktischen Integration
- Analyse und Bewertung von Ansätzen der semantischen Integration
- Vergleich von syntaktischer und semantischer Integration
- Zusammenfassung und kritische Würdigung der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 diskutiert die begrifflichen Grundlagen der Integration von Informationssystemen. Es werden Frameworks zur Integration von Informationssystemen beschrieben, wobei die Problemdimensionen Autonomie, Heterogenität und Distribution sowie die verschiedenen Ebenen der Integration (physische Systemintegration, Applikationsintegration und Firmenintegration) erläutert werden.
Kapitel 3 beschreibt den Übergang von syntaktischer zu semantischer Integration. Zuerst werden Technologien der syntaktischen Integration wie Ad hoc Techniken, Standardisierung, Middleware, Enterprise Application Integration (EAI), Business Process Management (BPM) und Service-oriented Architectures (SOA) vorgestellt und analysiert. Die verschiedenen Ansätze werden anhand von Kriterien wie Offenheit, Autonomie, Distribution, Flexibilität und Dynamik bewertet. Es wird gezeigt, dass SOA im Vergleich zu anderen Ansätzen das überzeugendste Konzept zur syntaktischen Integration darstellt.
Im Anschluss werden semantische Integrationsansätze mit Fokus auf Serviceunterstützung diskutiert. Es wird erläutert, dass die Berücksichtigung von semantischen Strukturen notwendig ist, um die syntaktische Integration zu vereinfachen und zu automatisieren. Das semantische Kontinuum wird vorgestellt und die verschiedenen Konzepte der Wissensrepräsentation (Vokabular, Thesaurus, Taxonomie, Ontologie, Logische Formalismen) werden erläutert.
Der Schwerpunkt liegt auf der ontologiebasierten Integration, da diese eine formale Beschreibung der Semantik beinhaltet. Verschiedene Ansätze der ontologiebasierten Integration werden vorgestellt und analysiert. Es wird gezeigt, dass OWL-S (OWL for Services) eine Ontologie zur Beschreibung von semantischen Web Services ist, die auf der Ontologiesprache OWL basiert und die automatische Auffindbarkeit, Startbarkeit, Zusammenfügung und Überwachung von Web Services ermöglicht.
Im Kapitel 3.3 erfolgt ein Vergleich von syntaktischer und semantischer Integration, wobei SOA und OWL-S exemplarisch als Technologien mit Fokus auf Serviceintegration betrachtet werden. Die Kriterien Transparenz, Auffindbarkeit, Automatisierbarkeit, Beschreibungsaufwand, Verfiigbarkeit, Datenkomplexität, Aussagekraft, Skalierbarkeit, Modellierungssprachenvielfalt und Verbreitungsgrad werden analysiert und die Chancen und Risiken des Einsatzes von semantischer Integration werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Integration von Informationssystemen, die syntaktische und semantische Integration, Enterprise Application Integration (EAI), Business Process Management (BPM), Service-oriented Architectures (SOA), Web Services, Ontologien, OWL-S, Web Service Modeling Framework (WSMF), Semantic Web Services, Interoperabilität, Automatisierbarkeit, Flexibilität, Skalierbarkeit, Transparenz, Datenkomplexität, Modellierungssprachenvielfalt, Verbreitungsgrad.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen syntaktischer und semantischer Integration?
Syntaktische Integration konzentriert sich auf das Format und die Struktur der Datenübertragung, während semantische Integration die tatsächliche Bedeutung der Daten durch Ontologien berücksichtigt.
Warum ist SOA ein wichtiges Konzept für die Integration?
Service-oriented Architecture (SOA) bietet ein flexibles Konzept zur syntaktischen Integration, indem Anwendungen als Dienste bereitgestellt werden, was die Interoperabilität erhöht.
Welche Rolle spielt OWL-S bei Web Services?
OWL-S ist eine Ontologie, die Web Services semantisch beschreibt. Sie ermöglicht das automatische Auffinden, Zusammenfügen und Überwachen von Diensten im Semantic Web.
Was sind die Vorteile einer ontologiebasierten Integration?
Sie erlaubt eine formale Beschreibung der Semantik, was die Automatisierung komplexer Integrationsprozesse vereinfacht und die Datenkomplexität besser beherrschbar macht.
Was versteht man unter dem „semantischen Kontinuum“?
Es beschreibt die Abstufungen der Wissensrepräsentation von einfachen Vokabularen und Taxonomien bis hin zu komplexen logischen Formalismen und Ontologien.
Warum ist Integration für dynamische Firmen so wichtig?
Nur durch eine anwendungs- und plattformübergreifende Integration können Unternehmen der steigenden Vernetzungskomplexität gerecht werden und effiziente Informationssysteme betreiben.
- Quote paper
- B. Sc. Mathias Riechert (Author), 2011, Von syntaktischer zu semantischer Integration, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178974