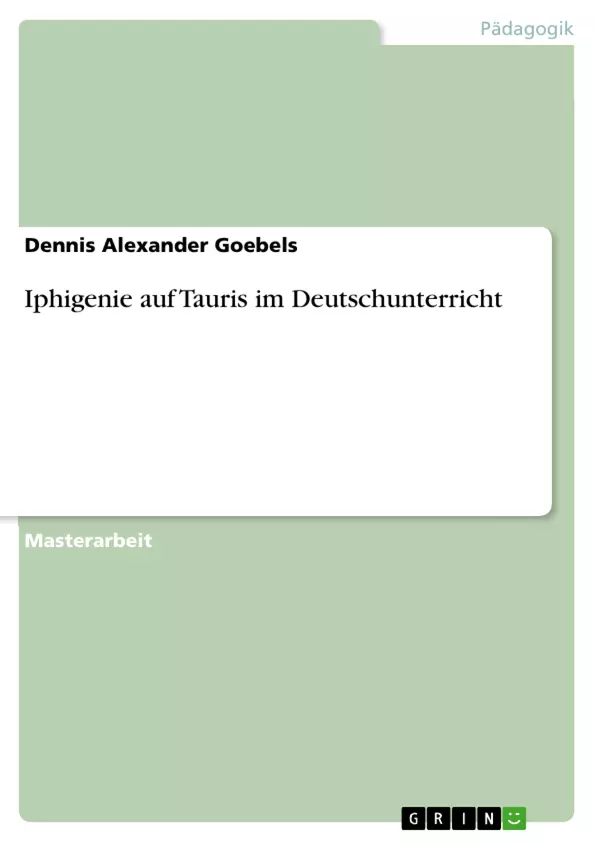Die Zeit der Weimarer Klassik oder des Weimarer Klassizismus stellt für Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) eine der produktivsten Epochen seiner literarischen Schaffenszeit dar. Während seiner Italienreise (1786-1788), aber auch und gerade nach seiner Rückkehr nach Weimar und in Zusammenarbeit mit Friedrich Schiller (1759-1805) entstanden einige der bedeutendsten Werke der deutschen Literaturgeschichte. Stärker noch als Schiller, der hauptsächlich auf dem Gebiet der philosophisch-ästhetischen Schriften und dem Drama brillierte, deckte Goethes klassizistische Phase alle Bereiche literarischer Kunst ab. Sowohl im Bereich des Dramas (Faust I, Iphigenie auf Tauris etc.) als auch im Bereich des Romans (Wilhelm Meisters Lehrjahre), des Versepos (Herman und Dorothea) oder auch der Lyrik (Der Erlkönig) produzierte Goethe Werke, die auch heute noch vielfach gelesen werden.
Gegenstand dieser Masterarbeit soll ein Text aus der Frühzeit der Weimarer Klassik sein, der von Goethe bereits 1779 verfasst, jedoch im Laufe der Zeit immer wieder umgearbeitet und schließlich auf seiner Italienreise in seine noch heute bekannte Form gebracht wurde: Iphigenie auf Tauris. Zum besseren Verständnis des Textes soll zunächst die Epoche der Weimarer Klassik näher beleuchtet werden. Daran anschließend sollen die Positionen zweier Wegbereiter für Goethes Klassizismus thematisiert werden: Johann Joachim Winckelmanns Theorie des Kunstschönen und Karl Philipp Moritz‘ Theorien zur Kunstautonomie und zur Prosodie im Deutschen. Im dritten Teil des Kapitels Weimarer Klassik soll es um Goethes klassizistische Ästhetik gehen.
Im dritten Kapitel soll der Text Iphigenie auf Tauris selbst im Mittelpunkt stehen. Dazu wird zunächst eine knappe Inhaltsangabe des Stückes gegeben, bevor auf die Geschichte des Stoffes, der Goethes Iphigenie zugrunde liegt, eingegangen wird. Anschließend sollen klassizistische Elemente des Dramas sowohl im Hinblick auf den Inhalt als auch auf die Form herausgearbeitet werden.
Im vierten Kapitel soll Iphigenie auf Tauris dann als Text für den Deutschunterricht untersucht werden. Dazu werden zunächst einige allgemeine Überlegungen zur Dramendidaktik im Deutschunterricht dargestellt, ehe in einem zweiten Schritt die Eignung dieses Stückes für den Deutschunterricht anhand verschiedener Kriterien analysiert wird. Schließlich sollen in einem dritten Schritt methodische Überlegungen zur didaktischen Vermittlung der Iphigenie angestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Weimarer Klassik
- Begriffsdefinition Weimarer Klassik
- Wegbereiter für Goethes Klassizismus
- Johann Joachim Winckelmann
- Karl Philipp Moritz
- Goethes klassizistische Ästhetik
- Konzept der Nachahmung der Natur
- Goethes Theorie der Metamorphose
- Goethes Verhältnis zum Drama
- Iphigenie auf Tauris
- Inhaltsangabe Iphigenie auf Tauris
- Stoffgeschichte
- Klassizistische Elemente
- Inhaltliche Elemente
- Formale Elemente
- Iphigenie auf Tauris im Deutschunterricht
- Dramendidaktik
- Iphigenie auf Tauris — Ein geeigneter Stoff für den Deutschunterricht?
- Methodische Überlegungen
- Vorbereitende Übungen
- Begleitende Übungen
- Nachbereitende Übungen
- Fazit
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit Johann Wolfgang Goethes „Iphigenie auf Tauris“, einem Stück aus der Frühzeit der Weimarer Klassik, das bereits 1779 verfasst, jedoch im Laufe der Zeit immer wieder umgearbeitet und schließlich auf Goethes Italienreise in seine noch heute bekannte Form gebracht wurde. Die Arbeit soll ein tieferes Verständnis des Stückes ermöglichen, indem zunächst die Epoche der Weimarer Klassik näher beleuchtet wird, bevor Iphigenie auf Tauris selbst im Mittelpunkt steht und schließlich als Text für den Deutschunterricht untersucht wird.
- Die Definition des Begriffs „Weimarer Klassik“ und die Problematik seiner Verwendung
- Die Positionen von Johann Joachim Winckelmann und Karl Philipp Moritz als Wegbereiter für Goethes Klassizismus
- Goethes klassizistische Ästhetik, insbesondere seine Konzepte der Nachahmung der Natur und der Metamorphose
- Die Analyse von Goethes Iphigenie auf Tauris, insbesondere im Hinblick auf seine klassizistischen Elemente
- Die Eignung von Goethes Iphigenie auf Tauris als Stoff für den Deutschunterricht und die didaktische Umsetzung des Stückes.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich der Definition des Begriffs „Weimarer Klassik“ und beleuchtet die Problematik seiner Verwendung. Es werden verschiedene Definitionen und zeitliche Begrenzungen des Begriffs diskutiert und die Kritik an der Klassik als Gütemaßstab für die deutsche Literatur behandelt. Im Anschluss werden die Positionen von Johann Joachim Winckelmann und Karl Philipp Moritz als Wegbereiter für Goethes Klassizismus vorgestellt. Winckelmanns Theorie des Kunstschönen und Moritz' Theorien zur Kunstautonomie und zur Prosodie im Deutschen werden anhand ihrer Schriften analysiert. Abschließend wird Goethes klassizistische Ästhetik beleuchtet, wobei insbesondere seine Konzepte der Nachahmung der Natur und der Metamorphose im Zentrum stehen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Goethes „Iphigenie auf Tauris“. Es wird zunächst eine knappe Inhaltsangabe des Stückes gegeben, bevor die Geschichte des Stoffes, der Goethes Iphigenie zugrunde liegt, näher beleuchtet wird. Dabei werden die Bearbeitungen des Stoffes durch Euripides und Jean Racine im Detail betrachtet. Anschließend werden klassizistische Elemente des Dramas sowohl im Hinblick auf den Inhalt als auch auf die Form herausgearbeitet.
Das dritte Kapitel untersucht Goethes „Iphigenie auf Tauris“ als Text für den Deutschunterricht. Zunächst werden einige allgemeine Überlegungen zur Dramendidaktik im Deutschunterricht dargestellt, ehe in einem zweiten Schritt die Eignung des Stückes für den Deutschunterricht anhand verschiedener Kriterien analysiert wird. Schließlich werden in einem dritten Schritt methodische Überlegungen zur didaktischen Vermittlung der Iphigenie angestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Weimarer Klassik, Johann Wolfgang Goethe, Iphigenie auf Tauris, Klassizismus, Nachahmung der Natur, Metamorphose, Humanität, Dramendidaktik, Deutschunterricht. Die Arbeit analysiert Goethes Iphigenie auf Tauris im Kontext der Weimarer Klassik und untersucht die klassizistischen Elemente des Stückes. Darüber hinaus werden die Eignung des Stückes als Stoff für den Deutschunterricht und die didaktische Umsetzung des Stückes im Unterricht behandelt.
- Quote paper
- B.A. Dennis Alexander Goebels (Author), 2011, Iphigenie auf Tauris im Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179000