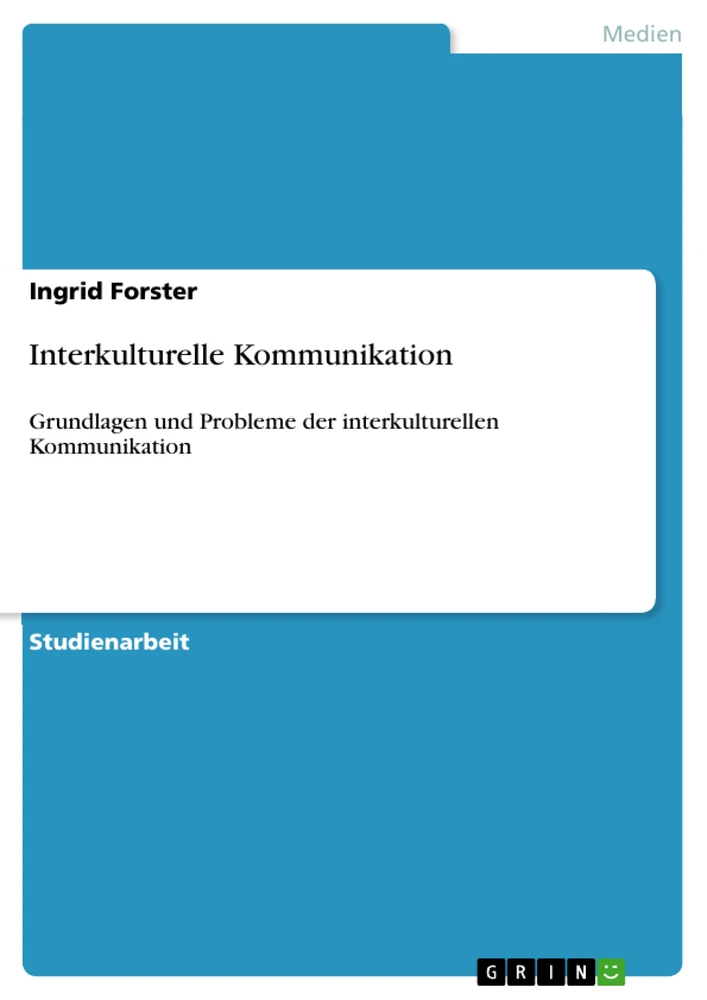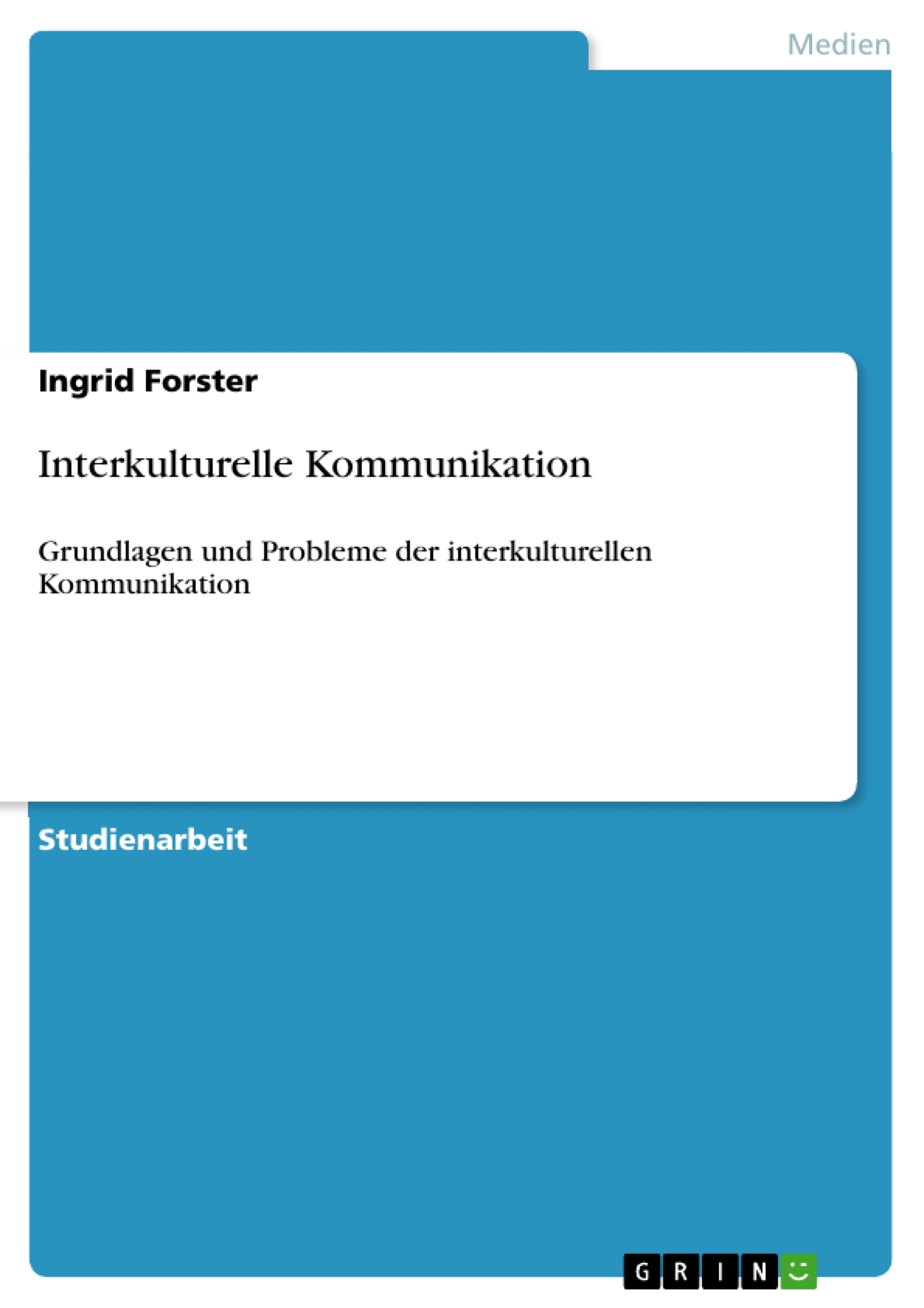1. Einleitung
Schon immer gab es Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen. Während diese früher jedoch relativ selten waren, hat sich das Ausmaß in den letzten 150 Jahren durch die Entwicklung moderner Verkehrs und Kommunikationsmittel vervielfacht.1
Das „normale“ in der Kommunikation ist allerdings das Missverständnis. Nur ausnahmsweise verstehen wir uns. Diese Feststellung gilt für den eigenen Sprach- und Kulturraum. Sie gilt umso mehr, wenn wir Grenzen überschreiten und mit Menschen kommunizieren, die eine andere Prägung
erfahren haben.2
Mit zunehmender Internationalisierung der Geschäftbeziehungen und Märkte haben sich auch die Geschäftsaktivitäten und –felder der Unternehmen verändert. Die Akteure stammen aus kulturell verschiedenen Ländern, der Bedarf an Wissen um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede
verschiedener Kulturen steigt. „So weisen wissenschaftliche Untersuchungen für die interpersonale Kommunikation in der Wirtschaft nach, dass Manager im Durchschnitt 70% ihrer täglichen Arbeitszeit
für Kommunikation aufwenden.“ 3 Dennoch lässt sich feststellen, dass gerade hier vielfach Ignoranz dominiert. „Missverständnisse und Konfl ikte, die in der Wirtschaft zu Fehlschlägen ganzer Projekte und Geschäftsabschlüsse führen können, sind mögliche Folge von kulturabhängig unterschiedlichen Kommunikationsweisen sowie Handlungs – und Deutungsvorraussetzungen, die in der interkulturellen Zusammenarbeit Berücksichtigung finden müssen.“ 4 Statt mit Neugierde und Wissensdrang auf
andere Menschen zuzugehen werden Vorurteile gefasst oder Werturteile ausgesprochen.
Ziel dieser Arbeit ist es zunächst einmal die wichtigsten Grundlagen und Grundbegriffe der interkulturellen Kommunikation zu erläutern und vorzustellen (Kapitel zwei). Kapitel drei befasst sich dann mit der Frage, wodurch sich Kulturen voneinander unterscheiden und welche Probleme welcher Art innerhalb von diesem Kontext entstehen können. In diesem Zusammenhang werden zehnkulturspezifische Strukturmerkmale als Unterscheidungskriterien herangezogen, die unter anderem auf die unterschiedlichen Mentalitäten, Werte, das Denken und die Interaktionen zwischen Menschen verschiedener Kulturen eingehen. Den Abschluss der Hausarbeit bildet Kapitel vier mit einer
Zusammenfassung der Ergebnisse und Einsichten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Was ist Kultur?
- 2.1.1 Rückblick auf die Entwicklung der Kultur
- 2.1.2 Normativer bzw. behavioristischer Kulturbegriff
- 2.1.3 Kulturbegriff der kognitiven Anthropologie
- 2.1.4 Symbolischer Kulturbegriff
- 2.2 Was ist Kommunikation?
- 2.3 Mensch und Kultur - das Individuum und die Enkulturation
- 2.4 Was ist interkulturelle Kommunikation? Der Zusammenhang zwischen Kultur und Kommunikation
- 2.5 Ethnozentrismus: Die eigene Kultur als Mittelpunkt und Maßstab
- 2.6 Fremde und Fremdsein: Ingroup and Outgroup
- 2.7 Kulturdistanz
- 2.8 Stereotypen im interkulturellen Kontext
- 3. Strukturmerkmale von Kulturen: Was unterscheidet Kulturen voneinander und welche Probleme ergeben sich dadurch?
- 3.1 Nationalcharakter, Basispersönlichkeit
- 3.2 Wahrnehmung
- 3.3 Zeiterleben
- 3.4 Raumerleben
- 3.5 Denken
- 3.6 Sprache
- 3.7 Nonverbale Kommunikation
- 3.8 Wertorientierung
- 3.9 Verhaltensmuster: Sitten, Normen, Rollen
- 3.10 Soziale Gruppen und ihre Beziehungen
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Grundlagen der interkulturellen Kommunikation zu erläutern und die Probleme aufzuzeigen, die aus kulturellen Unterschieden resultieren. Sie befasst sich mit dem Verständnis von Kultur und Kommunikation und analysiert, wie kulturelle Unterschiede die zwischenmenschliche Interaktion beeinflussen.
- Definition und Entwicklung des Kulturbegriffs
- Der Zusammenhang zwischen Kultur und Kommunikation
- Kulturelle Unterschiede als Quelle von Missverständnissen und Konflikten
- Analyse kulturspezifischer Strukturmerkmale
- Die Rolle von Stereotypen in der interkulturellen Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die zunehmende Bedeutung interkultureller Kommunikation im Kontext der Globalisierung und Internationalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie hebt die hohe Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen in der Kommunikation hervor, besonders im interkulturellen Kontext, und betont die Notwendigkeit, kulturelle Unterschiede zu verstehen, um erfolgreiche Interaktionen zu ermöglichen. Der Text unterstreicht die wachsende Relevanz des Themas im wirtschaftlichen Bereich und kritisiert die oft vorherrschende Ignoranz gegenüber kulturellen Nuancen. Die Arbeit skizziert die Struktur, indem sie die einzelnen Kapitel und deren Inhalte kurz vorstellt.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der interkulturellen Kommunikation dar. Es definiert den Begriff "Kultur" aus verschiedenen Perspektiven, von normativen und behavioristischen Ansätzen bis hin zu kognitiven und symbolischen Interpretationen. Weiterhin wird der Begriff "Kommunikation" präzisiert und der Zusammenhang zwischen Mensch, Kultur und Enkulturation untersucht. Der zentrale Abschnitt behandelt den Begriff der interkulturellen Kommunikation selbst, beleuchtet das Phänomen des Ethnozentrismus, die Dynamik von Ingroups und Outgroups, den Aspekt der Kulturdistanz und die Rolle von Stereotypen in interkulturellen Begegnungen. Dieses Kapitel bietet ein umfassendes Fundament für das Verständnis der folgenden Kapitel.
3. Strukturmerkmale von Kulturen: Kapitel drei konzentriert sich auf die Analyse von Strukturmerkmalen, die Kulturen voneinander unterscheiden und zu Problemen in der interkulturellen Kommunikation führen können. Es werden zehn kulturspezifische Merkmale untersucht, wie Nationalcharakter, Wahrnehmung, Zeiterleben, Raumerleben, Denkweisen, Sprache, nonverbale Kommunikation, Wertorientierungen, Verhaltensmuster und soziale Beziehungen. Jedes Merkmal wird im Kontext interkultureller Unterschiede analysiert und seine Bedeutung für die Kommunikation herausgestellt. Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Betrachtung der Faktoren, die interkulturelle Missverständnisse und Konflikte verursachen können.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kommunikation, Kulturbegriff, Kommunikationstheorie, Ethnozentrismus, Stereotypen, Kulturunterschiede, Globalisierung, Missverständnisse, Konflikte, Strukturmerkmale von Kulturen, Wertsysteme, Nonverbale Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Interkulturelle Kommunikation"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der interkulturellen Kommunikation. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Schwerpunkt liegt auf der Erläuterung der Grundlagen von Kultur und Kommunikation und der Analyse der Probleme, die aus kulturellen Unterschieden resultieren.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Grundlagen, 3. Strukturmerkmale von Kulturen und 4. Schluss. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar, indem es verschiedene Kulturbegriffe definiert und den Zusammenhang zwischen Kultur und Kommunikation erläutert. Kapitel 3 analysiert zehn kulturspezifische Merkmale, die zu Missverständnissen in der interkulturellen Kommunikation führen können. Die Einleitung und der Schluss umrahmen den Hauptteil.
Welche Kulturbegriffe werden behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Kulturbegriffe, darunter normative und behavioristische Ansätze, den Kulturbegriff der kognitiven Anthropologie und den symbolischen Kulturbegriff. Die verschiedenen Perspektiven werden vorgestellt und verglichen, um ein umfassendes Verständnis von Kultur zu ermöglichen.
Welche Strukturmerkmale von Kulturen werden analysiert?
Kapitel 3 analysiert zehn Strukturmerkmale von Kulturen: Nationalcharakter, Wahrnehmung, Zeiterleben, Raumerleben, Denken, Sprache, nonverbale Kommunikation, Wertorientierung, Verhaltensmuster und soziale Gruppen und deren Beziehungen. Diese Merkmale werden im Kontext interkultureller Unterschiede untersucht, um deren Einfluss auf die Kommunikation zu beleuchten.
Welche Rolle spielen Stereotypen in der interkulturellen Kommunikation?
Das Dokument thematisiert die Rolle von Stereotypen als wichtige Einflussfaktoren in der interkulturellen Kommunikation. Es wird der Einfluss von Stereotypen auf die Wahrnehmung und Interaktion mit Menschen aus anderen Kulturen behandelt und deren potenziell negative Auswirkungen hervorgehoben.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument verfolgt das Ziel, die Grundlagen der interkulturellen Kommunikation zu erläutern und die Probleme aufzuzeigen, die aus kulturellen Unterschieden resultieren. Es soll ein Verständnis für den Zusammenhang zwischen Kultur und Kommunikation schaffen und die Bedeutung des Verständnisses kultureller Unterschiede für gelungene Interaktionen hervorheben.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist für alle relevant, die sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigen, beispielsweise Studierende der Sozialwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, aber auch für Personen, die im beruflichen Kontext mit Menschen aus anderen Kulturen interagieren.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument behandelt?
Schlüsselbegriffe umfassen: Interkulturelle Kommunikation, Kulturbegriff, Kommunikationstheorie, Ethnozentrismus, Stereotype, Kulturunterschiede, Globalisierung, Missverständnisse, Konflikte, Strukturmerkmale von Kulturen, Wertsysteme und Nonverbale Kommunikation.
- Quote paper
- Ingrid Forster (Author), 2008, Interkulturelle Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179043