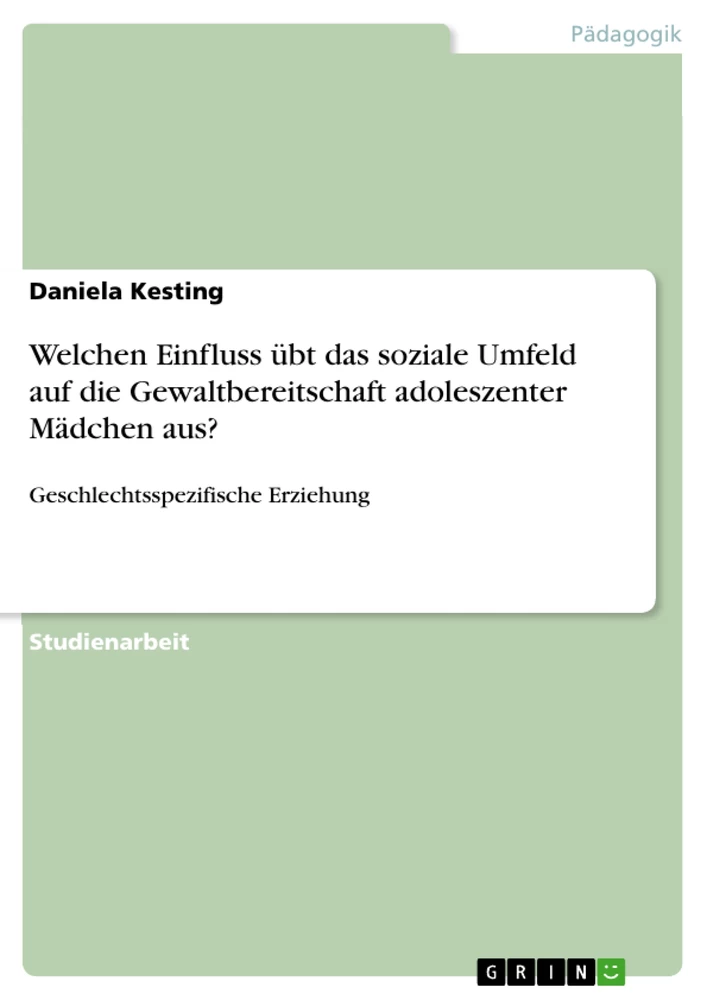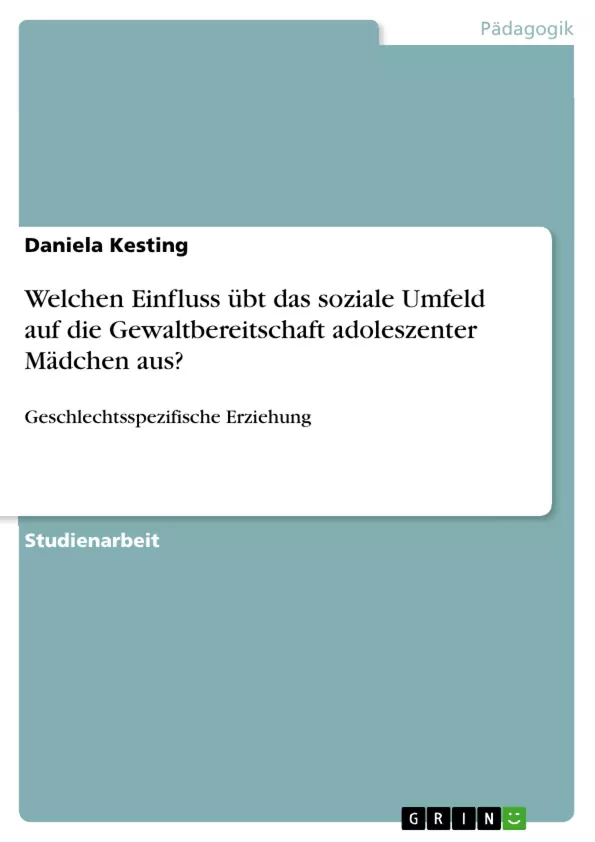Gibt man im Internet über bekannte Suchmaschinen das Stichwort: „Gewaltbereite Mädchen“ ein, wird man mit einer wahren Flut an Informationen überschütten. Da heißt es z.B. bei Focus Online:“ Mädchen schlagen öfter zu“ (www.focus.de/ schule/familie/erziehung), Zugriff: 06.07.2010) oder bei Spiegel Online:“Lidstrich und Leberprellung“ (www.spiegel.de/schulspiegel/leben), Zugriff: 06.07.2010)
Mit solch provokanten Schlagzeilen wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass unsere „lieben“ und „braven“ Mädchen auf alarmierende Art und Weise zusehends in „soziale Abgründe“ rutschen. Der Leser solcher Schlagzeilen wird sich mit einigen Fragen beschäftigen, vor allem nach dem warum und wieso junge Mädchen physische Gewalt anwenden. Vielleicht geraten sie auch nur momentan in den Focus der Öffentlichkeit, weil es vielleicht gerade für große Schlagzeilen sorgt. Oder gibt es sie schon immer, die Mädchen, die Yvonne Raub mit dem Schlagwort „Amazonismus“ versieht (Raub, Yvonne, Amazonismus, 2010).
In nachfolgender Arbeit soll sich mit folgender Frage auseinander gesetzt werden: „Welchen Einfluss übt das soziale Umfeld auf die Gewaltbereitschaft von adoleszenten Mädchen aus?“
Es wird davon ausgegangen, dass das Elternhaus grundlegende Meilensteine in der Sozialisation eines Kindes legt, und im Laufe der kindlichen Entwicklung, das soziale Umfeld, wie Peer-Group und Schule, zusehends an Bedeutung gewinnen. Somit könnte man zu der Erkenntnis gelangen, dass das soziale Umfeld den größten Einfluss auf die Gewaltbereitschaft junger Mädchen ausübt.
Um die Fragestellung eindeutig beantworten zu können, wird neben allgemeinen Begriffsbestimmungen im nächsten Punkt, auf die Adoleszenz und ihr Gewaltpotential eingegangen, dabei wird der Versuch unternommen, nach geschlechtsspezifischen Punkten zu unterscheiden
Zwei aktuelle Studien zum Thema Mädchen und Gewalt werden gegenüber gestellt, die vom Aufbau und der Fragestellung her, sehr ausführlich auf die Besonderheiten und Schwierigkeiten der Mädchen eingehen. Anschließend wird auf den Bereich Prävention, und welche Anforderung sie erfüllen sollte, eingegangen. Im Fazit werden die Ergebnisse zusammengetragen und zusammengefasst, um zu einer Beantwortung der Frage zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionsbestimmungen
- Gewalt
- Einfluss
- Adoleszenz
- Soziales Umfeld
- Doing Gender
- 3. Entwicklung der Aggression unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten
- 4. Das Phänomen Gewalt bei Mädchen
- 4.1 Kirsten Bruhns und Svendy Wittmann: „Mit Gewalt kannst du dir Respekt verschaffen“ (Bruhns, Wittmann, 2002)
- 4.2 Mirja Silkenbeumer: Biografische Selbstentwürfe und Weiblichkeitskonzepte aggressiver Mädchen und junger Frauen (Silkenbeumer, 2007)
- 5. Gewaltprävention bei adoleszenten Mädchen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss des sozialen Umfelds auf die Gewaltbereitschaft adoleszenter Mädchen. Die Arbeit geht der Frage nach, inwieweit Faktoren wie Familie, Schule und Peergroup die Entwicklung aggressiven Verhaltens bei jungen Frauen beeinflussen.
- Definition von Gewalt und Aggression im Kontext adoleszenter Mädchen
- Entwicklungspsychologische Aspekte von Aggression bei Mädchen
- Analyse relevanter Studien zu Gewalt bei Mädchen
- Rolle des sozialen Umfelds (Familie, Schule, Peergroup)
- Ansätze der Gewaltprävention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Forschungsfrage – den Einfluss des sozialen Umfelds auf die Gewaltbereitschaft adoleszenter Mädchen – ausgehend von provokanten Schlagzeilen in Medien, die vermehrt über Gewaltbereitschaft bei Mädchen berichten. Sie skizziert den Forschungsansatz, der die Bedeutung des Elternhauses in der frühen Sozialisation betont und die zunehmende Rolle des sozialen Umfelds (Peergroup, Schule) im Jugendalter hervorhebt. Die Arbeit kündigt die methodische Vorgehensweise an: Begriffsbestimmungen, Analyse der Adoleszenz und ihres Gewaltpotentials unter geschlechtsspezifischen Aspekten, Gegenüberstellung aktueller Studien, und Abschluss mit einem Fazit.
2. Definitionsbestimmungen: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe: Gewalt, Einfluss, Adoleszenz, soziales Umfeld und „Doing Gender“. Es hebt die Schwierigkeit einer prägnanten Definition von Gewalt hervor und verweist auf die Verbindung zu Aggression. Es wird der Unterschied zwischen Aggression und Gewalt erläutert, wobei die Definition der WHO aus dem Jahr 2002 herangezogen wird. Der Begriff „Einfluss“ wird im Kontext des Verhaltens und der Einstellungen adoleszenter Mädchen definiert. Die Adoleszenz wird als Lebensphase zwischen 17 und 20 Jahren beschrieben, in der hormonelle Veränderungen und die Suche nach Identität eine zentrale Rolle spielen. Das soziale Umfeld umfasst Familie, Schule, Freundes- und Bekanntenkreis. Der Ansatz des „Doing Gender“ wird kurz erläutert, um die soziale Konstruktion von Geschlecht und die damit verbundenen Rollenerwartungen zu beleuchten.
3. Entwicklung der Aggression unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung von Aggression von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter, wobei geschlechtsspezifische Unterschiede und Gemeinsamkeiten beleuchtet werden. Es wird auf den Einfluss früher Kindheitserfahrungen, wie Bindungsdefizite, emotionale Vernachlässigung oder Misshandlung, auf die spätere Entwicklung aggressiven Verhaltens hingewiesen. Die Ausführungen stützen sich auf Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und unterstreichen den Zusammenhang zwischen frühen Erfahrungen und dem späteren Auftreten von Aggression.
4. Das Phänomen Gewalt bei Mädchen: Dieses Kapitel analysiert das Phänomen von Gewalt bei Mädchen anhand zweier aktueller Studien (Bruhns & Wittmann, 2002; Silkenbeumer, 2007). Es werden die Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der Erforschung weiblicher Gewalt aufgezeigt und die jeweiligen Studien im Detail vorgestellt. Die Zusammenfassung der Kapitel konzentriert sich auf die wesentlichen Ergebnisse und die methodischen Ansätze der Studien und deren Relevanz für die Fragestellung der Arbeit.
5. Gewaltprävention bei adoleszenten Mädchen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Gewaltprävention bei Mädchen und den Anforderungen an effektive Präventionsmaßnahmen. Es werden wahrscheinlich verschiedene Strategien und Interventionen diskutiert, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen adoleszenter Mädchen zugeschnitten sind. Der Fokus liegt auf der Prävention von Gewalt und der Förderung von gesundem Sozialverhalten.
Schlüsselwörter
Gewaltbereitschaft, Adoleszente Mädchen, Soziales Umfeld, Aggression, Entwicklungspsychologie, Gewaltprävention, Doing Gender, Peergroup, Familie, Schule.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Einfluss des sozialen Umfelds auf die Gewaltbereitschaft adoleszenter Mädchen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss des sozialen Umfelds auf die Gewaltbereitschaft adoleszenter Mädchen. Sie beleuchtet, wie Familie, Schule und Peergroup die Entwicklung aggressiven Verhaltens bei jungen Frauen beeinflussen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition von Gewalt und Aggression bei Mädchen, entwicklungspsychologische Aspekte von Aggression, Analyse relevanter Studien zu Gewalt bei Mädchen, die Rolle des sozialen Umfelds (Familie, Schule, Peergroup) und Ansätze der Gewaltprävention.
Welche Begriffe werden in der Hausarbeit definiert?
Die Hausarbeit definiert zentrale Begriffe wie Gewalt, Einfluss, Adoleszenz, soziales Umfeld und „Doing Gender“. Es wird der Unterschied zwischen Aggression und Gewalt erläutert, und die Definition der WHO aus dem Jahr 2002 wird herangezogen. Die Adoleszenz wird als Lebensphase zwischen 17 und 20 Jahren beschrieben.
Welche Studien werden in der Hausarbeit analysiert?
Die Hausarbeit analysiert die Studien von Bruhns & Wittmann (2002): „Mit Gewalt kannst du dir Respekt verschaffen“ und Silkenbeumer (2007): Biografische Selbstentwürfe und Weiblichkeitskonzepte aggressiver Mädchen und junger Frauen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Definitionsbestimmungen, Entwicklung der Aggression unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten, Das Phänomen Gewalt bei Mädchen, Gewaltprävention bei adoleszenten Mädchen und Fazit. Jedes Kapitel fasst seine zentralen Ergebnisse zusammen.
Was ist das zentrale Ergebnis der Einleitung?
Die Einleitung präsentiert die Forschungsfrage und skizziert den Forschungsansatz, der die Bedeutung des Elternhauses und die zunehmende Rolle des sozialen Umfelds im Jugendalter hervorhebt. Die methodische Vorgehensweise (Begriffsbestimmungen, Analyse der Adoleszenz, Gegenüberstellung aktueller Studien und Fazit) wird angekündigt.
Was wird im Kapitel "Entwicklung der Aggression unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten" behandelt?
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung von Aggression von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter, wobei geschlechtsspezifische Unterschiede und Gemeinsamkeiten beleuchtet werden. Es wird auf den Einfluss früher Kindheitserfahrungen (Bindungsdefizite, emotionale Vernachlässigung oder Misshandlung) hingewiesen.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels "Das Phänomen Gewalt bei Mädchen"?
Dieses Kapitel analysiert das Phänomen weiblicher Gewalt anhand der Studien von Bruhns & Wittmann (2002) und Silkenbeumer (2007). Es werden die Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der Erforschung weiblicher Gewalt aufgezeigt und die jeweiligen Studien im Detail vorgestellt.
Worauf konzentriert sich das Kapitel zur Gewaltprävention?
Das Kapitel zur Gewaltprävention bei adoleszenten Mädchen befasst sich mit effektiven Präventionsmaßnahmen und Strategien, die auf die spezifischen Bedürfnisse adoleszenter Mädchen zugeschnitten sind. Der Fokus liegt auf der Prävention von Gewalt und der Förderung von gesundem Sozialverhalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Gewaltbereitschaft, Adoleszente Mädchen, Soziales Umfeld, Aggression, Entwicklungspsychologie, Gewaltprävention, Doing Gender, Peergroup, Familie, Schule.
- Citation du texte
- Daniela Kesting (Auteur), 2010, Welchen Einfluss übt das soziale Umfeld auf die Gewaltbereitschaft adoleszenter Mädchen aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179056