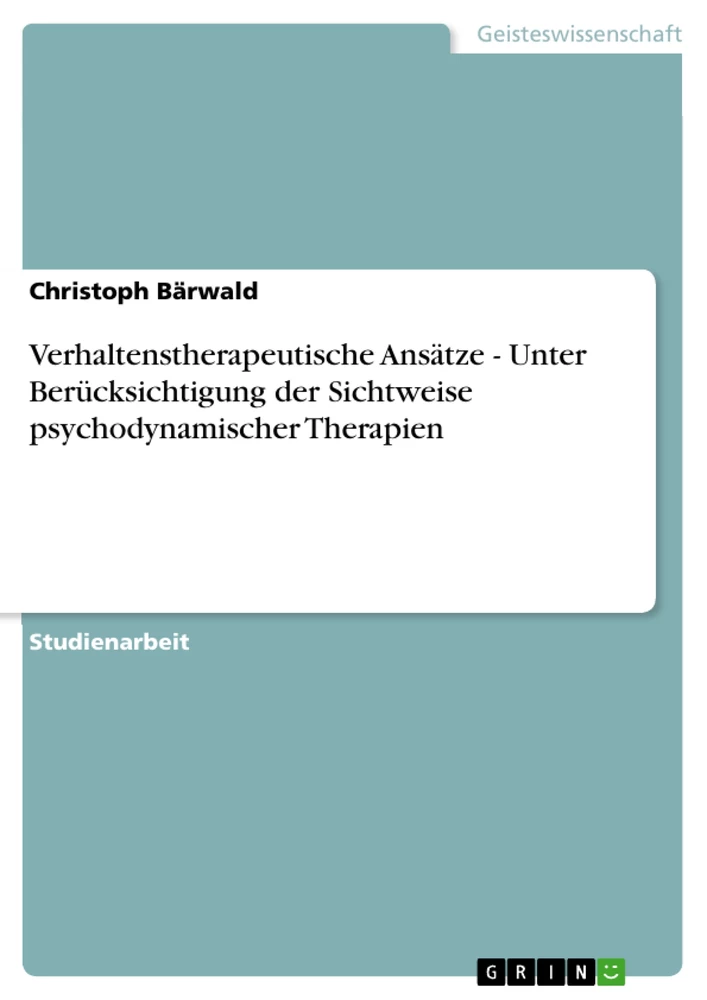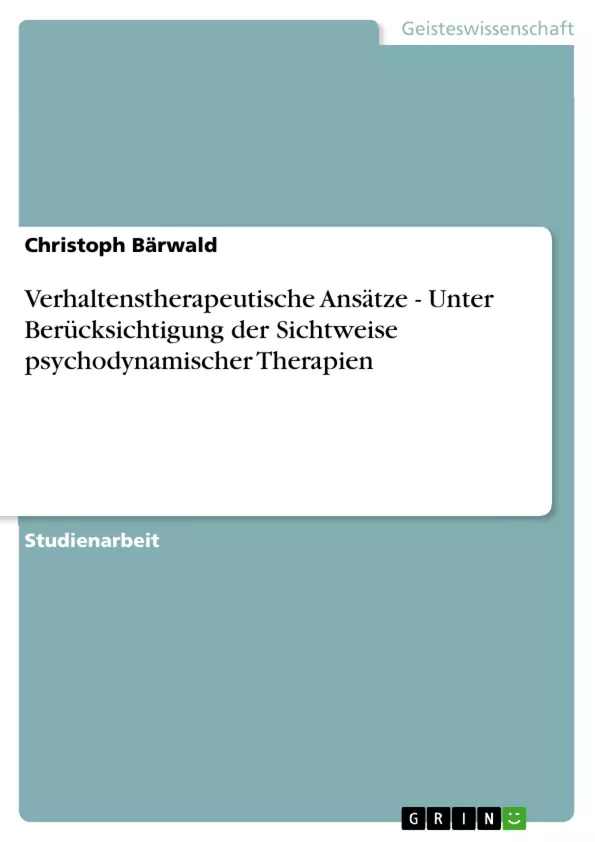Ob Zwangsstörungen, Essstörungen, somatoforme Störungen, posttraumatische Störungen, Schlafstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen, sexuelle Funktionsstörungen bis hin zur Suchterkrankung, kann der Mensch eine Vielzahl verschiedener Verhaltensweisen und Verhaltensmuster zeigen oder gar verlieren, wenn sein inneres seelisches Befinden aus dem Gleichgewicht geraten ist. Man erkennt, dass das Feld seelischer Erkrankungen sehr vielfältig und breit gefächert ist, sowie dass in Deutschland ein enormer Handlungs- und Beratungsbedarf für seelische Leiden jeglicher Form entstanden ist und der Mensch die Art, wie er zukünftig leben will, überdenken sollte. Es wird Zeit, dass auch der Letzte erkennt, dass der Mensch eine Einheit aus Körper, Geist und Seele ist. Wird diese Einheit zerstört, so entstehen körperliche und auch seelische Probleme.
Hilfe verspricht hierbei die Verhaltenstherapie, die einen Großteil dieser Hausarbeit ausmachen wird. Im Rahmen dieser Hausarbeit soll unter Berücksichtigung des Leib-Seele-Problems die Brücke zum Behaviorismus geschlagen werden, um somit den Grundstein und den geschichtlichen Hintergrund der Verhaltenstherapie darzustellen. Fortfahrend werden lerntheoretische, kognitive sowie konfrontative Methoden der Verhaltenstherapie erläutert und in einem weiteren Punkt, Kritik an der Verhaltenstherapie geäußert.
Im zweiten Teil der Arbeit wird der psychodynamische Ansatz in seinem Grundverständnis erfasst, um dadurch die wesentlichen Unterschiede zum verhaltenstherapeutischen Verständnis herauszuarbeiten. Dabei soll die Psychoanalyse, die analytische Psychotherapie als auch die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie berücksichtigt werden. Anschließend sollen auch hier Kritiken zum psychodynamischen Ansatz geäußert werden. Ziel soll es sein, einen verständlichen und geordneten Einblick in das Grundverständnis dieser beiden verschiedenen Ansätze und deren Arbeitsweisen zu geben.
Fragestellung dieser Arbeit soll es sein, wie diese beiden großen Ansätze in der heutigen Zeit zueinander stehen und ob eine dieser Schulen als zeitgemäßer und eventuell wirksamer und effektiver charakterisiert werden kann oder sogar muss.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Leib-Seele-Problem
- 3. Die Verhaltenstherapie
- 3.1. Die Anfänge der Verhaltenstherapie – Definition Behaviorismus
- 3.2. Methoden der Verhaltenstherapie
- 3.2.1. Lerntheoretische Ansätze
- 3.2.1.1. Klassische Konditionierung
- 3.2.1.2. Operante Konditionierung
- 3.2.1.3. Sozial-kognitive Lerntheorie
- 3.2.2. Kognitive Ansätze
- 3.2.2.1. Rational-Emotive Therapie (nach Ellis)
- 3.2.2.2. Kognitive Therapie (nach Beck)
- 3.2.2.3. Stressimpfungstraining (nach Meichenbaum)
- 3.2.3. Konfrontative Ansätze
- 3.2.3.1. Systematische Desensibilisierung (graduiert, in sensu)
- 3.2.3.2. Flooding (massiert, in vivo)
- 3.2.1. Lerntheoretische Ansätze
- 3.3. Kritik an der Verhaltenstherapie
- 4. Eine kleine Gesellschaftsanalyse
- 5. Der psychodynamische Ansatz
- 5.1. Die Entwicklung der psychoanalytischen Technik Freuds
- 5.2. Methoden psychodynamischer Therapien
- 5.2.1. Psychoanalyse
- 5.2.2. Analytische Psychotherapie
- 5.2.3. Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
- 5.3. Kritik an den psychodynamischen Therapien
- 6. Gegenüberstellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verhaltenstherapeutische und psychodynamische Ansätze in der Behandlung psychischer Erkrankungen. Ziel ist ein verständlicher Vergleich beider Ansätze und deren Eignung für die heutige Zeit. Die Arbeit beleuchtet die historischen Hintergründe, Methoden und Kritikpunkte beider Therapieformen.
- Vergleich verhaltenstherapeutischer und psychodynamischer Ansätze
- Methoden der Verhaltenstherapie (lerntheoretisch, kognitiv, konfrontativ)
- Methoden psychodynamischer Therapien (Psychoanalyse, analytische Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie)
- Das Leib-Seele-Problem und seine Relevanz für die Therapieansätze
- Kritikpunkte an beiden Therapieformen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die steigende Bedeutung psychischer Erkrankungen in der heutigen Gesellschaft, gestützt auf Statistiken des Fehlzeiten-Reports 2010 und des Gesundheitsberichts „Gesundheit in Deutschland“ 2006. Sie verdeutlicht die vielschichtigen Ursachen und Auswirkungen psychischer Leiden und hebt die Notwendigkeit von effektiven Behandlungsansätzen hervor. Die Arbeit kündigt den Vergleich von verhaltenstherapeutischen und psychodynamischen Ansätzen an, wobei das Leib-Seele-Problem als zentrale Brücke zwischen beiden Konzepten dient.
2. Das Leib-Seele-Problem: Dieses Kapitel befasst sich mit dem komplexen Leib-Seele-Problem, einer der größten Herausforderungen der Philosophie. Es werden verschiedene Perspektiven auf den Zusammenhang von Körper und Geist angesprochen, und die Auswirkungen dieser Debatte auf Psychologie, Psychiatrie und Psychosomatik werden diskutiert. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Betrachtung der unterschiedlichen Therapieansätze, indem es die grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis von Körper und Geist beleuchtet.
3. Die Verhaltenstherapie: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Einführung in die Verhaltenstherapie. Es beginnt mit den Anfängen und der Definition des Behaviorismus und schreitet fort zu einer detaillierten Darstellung der verschiedenen Methoden. Lerntheoretische Ansätze (klassische und operante Konditionierung, sozial-kognitive Lerntheorie), kognitive Ansätze (Rational-Emotive Therapie, Kognitive Therapie, Stressimpfungstraining) und konfrontative Ansätze (systematische Desensibilisierung, Flooding) werden erläutert. Abschließend wird Kritik an der Verhaltenstherapie thematisiert.
4. Eine kleine Gesellschaftsanalyse: [Es fehlt der Text für dieses Kapitel im bereitgestellten Dokument. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.]
5. Der psychodynamische Ansatz: Dieses Kapitel widmet sich dem psychodynamischen Ansatz, beginnend mit der Entwicklung der psychoanalytischen Technik Freuds. Es werden verschiedene Methoden psychodynamischer Therapien, wie Psychoanalyse, analytische Psychotherapie und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, detailliert beschrieben. Kritische Aspekte des psychodynamischen Ansatzes werden ebenfalls behandelt. Der Fokus liegt auf der Darstellung des grundlegenden Verständnisses und der Arbeitsweisen dieser Therapieform.
Schlüsselwörter
Verhaltenstherapie, Psychodynamische Therapie, Behaviorismus, Lerntheorie, Kognitive Therapie, Psychoanalyse, Leib-Seele-Problem, Psychische Erkrankungen, Gesundheitswesen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verhaltenstherapie vs. Psychodynamischer Ansatz
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über verhaltenstherapeutische und psychodynamische Ansätze in der Behandlung psychischer Erkrankungen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf einem verständlichen Vergleich beider Ansätze und deren Eignung für die heutige Zeit, inklusive der historischen Hintergründe, Methoden und Kritikpunkte.
Welche Therapieansätze werden verglichen?
Das Dokument vergleicht verhaltenstherapeutische und psychodynamische Ansätze. Die Verhaltenstherapie wird detailliert in ihren lerntheoretischen (klassische und operante Konditionierung, sozial-kognitive Lerntheorie), kognitiven (Rational-Emotive Therapie, Kognitive Therapie, Stressimpfungstraining) und konfrontativen (systematische Desensibilisierung, Flooding) Methoden erläutert. Der psychodynamische Ansatz wird mit Fokus auf Psychoanalyse, analytische Psychotherapie und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie dargestellt.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Das Leib-Seele-Problem, Die Verhaltenstherapie, Eine kleine Gesellschaftsanalyse (wobei der Text für dieses Kapitel fehlt), Der psychodynamische Ansatz und Gegenüberstellung.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Ziel des Dokuments ist ein verständlicher Vergleich von verhaltenstherapeutischen und psychodynamischen Ansätzen und deren Eignung für die heutige Zeit. Es beleuchtet die historischen Hintergründe, Methoden und Kritikpunkte beider Therapieformen.
Wie wird das Leib-Seele-Problem behandelt?
Das Leib-Seele-Problem wird als zentrale Brücke zwischen den beiden Therapieansätzen betrachtet. Das Dokument diskutiert verschiedene Perspektiven auf den Zusammenhang von Körper und Geist und deren Auswirkungen auf Psychologie, Psychiatrie und Psychosomatik.
Welche Kritikpunkte an den Therapieansätzen werden angesprochen?
Das Dokument thematisiert die Kritikpunkte sowohl an der Verhaltenstherapie als auch an den psychodynamischen Therapien. Die genauen Kritikpunkte werden jedoch nicht im Detail in der Zusammenfassung aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Verhaltenstherapie, Psychodynamische Therapie, Behaviorismus, Lerntheorie, Kognitive Therapie, Psychoanalyse, Leib-Seele-Problem, Psychische Erkrankungen, Gesundheitswesen.
Welche Methoden der Verhaltenstherapie werden beschrieben?
Die beschriebenen Methoden der Verhaltenstherapie umfassen lerntheoretische Ansätze (klassische und operante Konditionierung, sozial-kognitive Lerntheorie), kognitive Ansätze (Rational-Emotive Therapie, Kognitive Therapie, Stressimpfungstraining) und konfrontative Ansätze (systematische Desensibilisierung, Flooding).
Welche Methoden der psychodynamischen Therapie werden beschrieben?
Die beschriebenen Methoden der psychodynamischen Therapie sind Psychoanalyse, analytische Psychotherapie und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie.
Fehlt ein Kapitel im Dokument?
Ja, der Text für das Kapitel "Eine kleine Gesellschaftsanalyse" fehlt im bereitgestellten Dokument. Daher kann keine Zusammenfassung dieses Kapitels erstellt werden.
- Arbeit zitieren
- Christoph Bärwald (Autor:in), 2011, Verhaltenstherapeutische Ansätze - Unter Berücksichtigung der Sichtweise psychodynamischer Therapien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179070