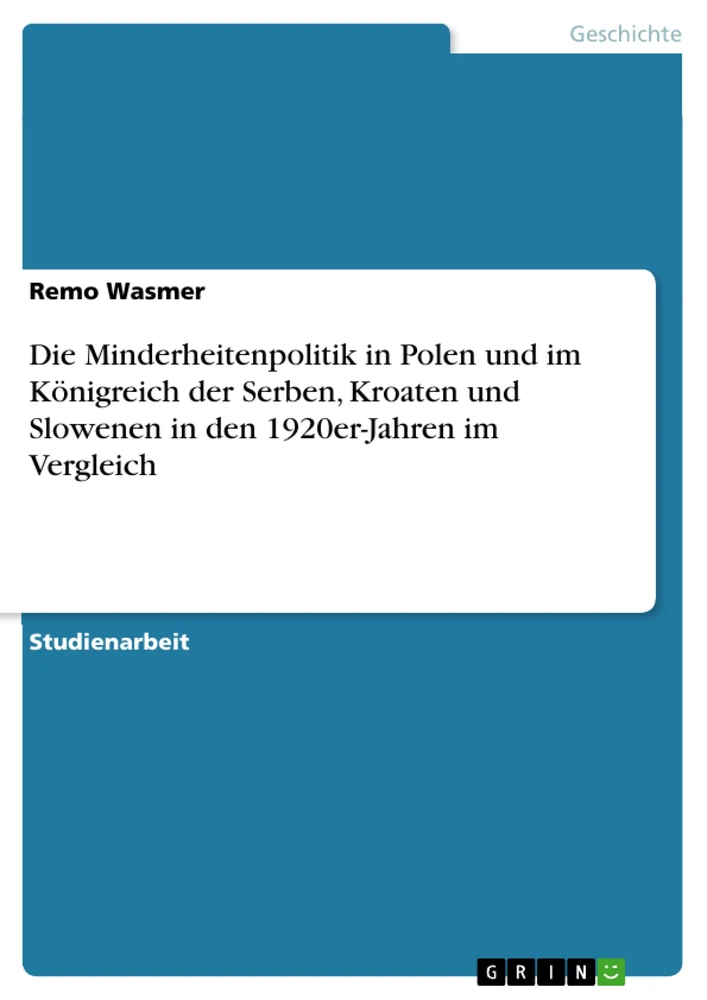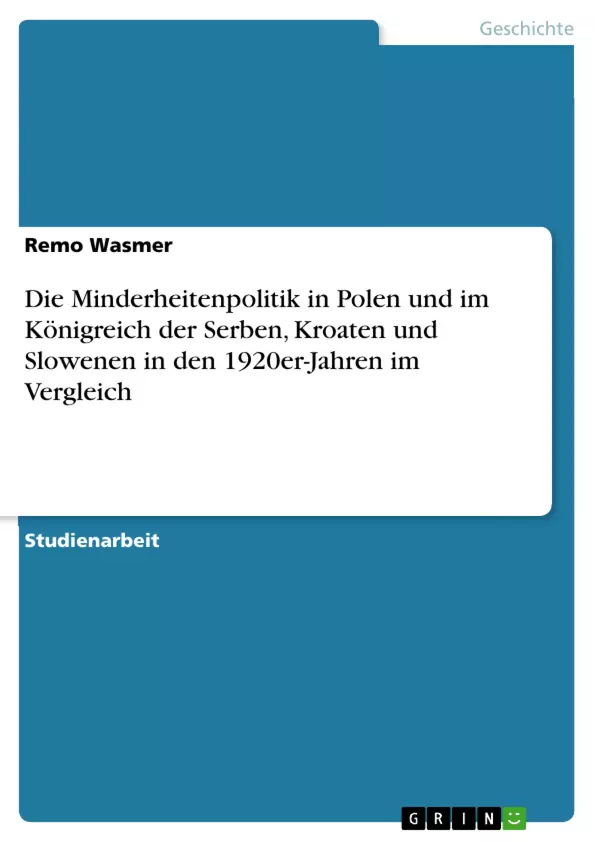Die ostmitteleuropäischen Minderheiten bargen nach dem Ersten Weltkrieg ein Konfliktpotenzial, das vor dem Hintergrund eines wachsenden Nationalismus, einer fortdauernden sozioökonomischen Unsicherheit und einer politischen Autokratisierung kaum zu überschätzen war. Ein unheilvoller Komplex aus ideologischen und geopolitischen Aspekten machte die Minderheiten auch für die staatliche Konsolidierung der beiden neuen Staaten Polen und Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen zu einem kritischen Faktor. Wie auch die meisten anderen Staaten in diesem Raum, sahen diese ihre Zukunft in einer nationalen Uniformierung, zu deren Vollendung die Minderheiten hinderlich waren.
In der vorliegenden Arbeit wird die Politik der Polnischen Republik und des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen gegenüber ihren Minderheiten in den 1920er-Jahren vergleichend aufgearbeitet. Dazu werden die Beweggründe und die Umsetzung minderheitenpolitischer Massnahmen sowie die Reaktionen der Minoritäten darauf für beide Staaten getrennt herauskristallisiert. Das internationale Minderheitenschutzsystem der Zwischenkriegszeit stellt dabei einen wichtigen Beobachtungsgegenstand dar, da die Berührungspunkte der beiden Staaten mit diesem Instrument einiges über deren Minderheitenpolitik und ihren Hintergrund offenbaren. Im Diskussionsteil werden schliesslich die erarbeiteten Erkenntnisse aus der Politik beider Staaten einander gegenübergestellt und vor dem Hintergrund relevanter soziopolitischer Rahmenbedingungen interpretiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung und Vorgehensweise
- Literatur und Quellen
- Zeitgenössische Quellen und Literatur
- Jüngere Sekundärliteratur
- Historisch-geographischer Kontext
- Ausgangslage im östlichen Europa zu Ende des Ersten Weltkrieges
- Der Minderheitenschutz-Mechanismus des Völkerbunds
- Ausgestaltung des Minderheitenschutzes
- Polen
- Minderheitenstruktur zu Ende des Ersten Weltkrieges
- Interne Minderheiten
- Minderheitenschutzabkommen unter Garantie des Völkerbunds
- Minderheitenpolitik Polens 1921-1934
- Motivation und Ziele
- Unsystematische Assimilierungspolitik
- Polonisierung, Pazifizierung, Entdeutschung
- Unter Piłsudski: Zwischen Duldsamkeit und Repression
- Reaktionen der betroffenen Minderheiten
- Beschwerden an den Völkerbund
- Radikalisierung
- Ausblick auf die weiteren Ereignisse
- Verschärfung des deutsch-polnischen Gegensatzes
- Polens Aufkündigung des Minderheitenschutzvertrags mit dem Völkerbund 1934
- Minderheitenstruktur zu Ende des Ersten Weltkrieges
- Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen
- Minderheitenstruktur im SHS-Staat
- Interne Minderheiten
- Minderheitenschutzabkommen unter Garantie des Völkerbundes
- Minderheitenpolitik des SHS-Staates 1921-1929
- Motivationen und Ziele
- Repression und Kolonisierung in Makedonien und im Kosovo
- Assimilierung der Magyaren und der Deutschen
- Verschärfung in den 1920-er Jahren
- Reaktionen der betroffenen Minderheiten
- Beschwerden an den Völkerbund
- Radikalisierung
- Ausblick auf die weiteren Ereignisse: Königsdiktatur ab 1929
- Minderheitenstruktur im SHS-Staat
- Polen
- Diskussion
- Polen - SHS-Staat: Vergleich der Minderheitenpolitik
- Bedeutung der Minderheiten für Polen und den SHS-Staat
- Ideologische Faktoren
- Sicherheitspolitische Aspekte
- Internationale Beziehungen und Reziprozität in der Minderheitenpolitik
- Umgang mit den Minderheiten
- Mittel der Minderheitenpolitik
- Unterschiede im Umgang mit den verschiedenen Minderheiten
- Beziehungen zum internationalen Minderheitenschutzsystem
- Umgang des Sekretariates mit den Beschwerden
- Bedeutung der Minderheiten für Polen und den SHS-Staat
- Schlussfolgerungen
- Zusammenfassung
- Abschliessende Bemerkungen zur vorliegenden Arbeit
- Polen - SHS-Staat: Vergleich der Minderheitenpolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit setzt sich zum Ziel, die Minderheitenpolitik der Polnischen Republik und des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen in den 1920er-Jahren vergleichend zu analysieren. Dabei liegt der Fokus auf den Beweggründen und der Umsetzung dieser Politik, sowie den Reaktionen der betroffenen Minderheiten. Das internationale Minderheitenschutzsystem der Zwischenkriegszeit wird als wichtiger Beobachtungsgegenstand herangezogen.
- Minderheitenpolitik in Polen und im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen
- Beweggründe und Umsetzung der Minderheitenpolitik
- Reaktionen der betroffenen Minderheiten
- Internationale Minderheitenschutzmechanismen des Völkerbunds
- Vergleich der Minderheitenpolitik beider Staaten im Kontext der jeweiligen soziopolitischen Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit, die Zielsetzung und die Vorgehensweise vor. Sie skizziert den historischen und geographischen Kontext sowie die relevanten Quellen und Literatur.
- Ausgestaltung des Minderheitenschutzes in Polen: Dieses Kapitel analysiert die Minderheitenstruktur in Polen nach dem Ersten Weltkrieg, die Minderheitenschutzabkommen und die konkrete Politik Polens gegenüber seinen Minderheiten in den 1920er-Jahren. Es werden die Motivationen und Ziele der Politik, die eingesetzten Mittel sowie die Reaktionen der Minderheiten beleuchtet.
- Ausgestaltung des Minderheitenschutzes im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen: Analog zum vorherigen Kapitel, werden die Minderheitenstruktur, die Minderheitenschutzabkommen und die konkrete Politik des SHS-Staates gegenüber seinen Minderheiten in den 1920er-Jahren analysiert. Auch hier werden die Motivationen, Ziele, Mittel und Reaktionen der Minderheiten betrachtet.
- Diskussion: Im Diskussionsteil werden die Ergebnisse der Analysen von Polen und dem SHS-Staat miteinander verglichen. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Minderheitenpolitik beider Staaten im Kontext der jeweiligen soziopolitischen Rahmenbedingungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des Minderheitenschutzes im östlichen und südöstlichen Europa nach dem Ersten Weltkrieg. Dabei werden insbesondere die Minderheitenpolitik Polens und des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen in den 1920er-Jahren sowie das internationale Minderheitenschutzsystem des Völkerbunds in den Fokus genommen. Die Arbeit behandelt Konzepte wie Assimilierungspolitik, Polonisierung, Entdeutschung, Repression und Kolonisierung. Weitere wichtige Aspekte sind der Konflikt zwischen nationaler Einheit und Minderheitenrechten sowie die Rolle des Völkerbunds bei der Konfliktlösung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser vergleichenden Arbeit zur Minderheitenpolitik?
Das Ziel ist die Analyse und der Vergleich der Minderheitenpolitik in Polen und im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS-Staat) während der 1920er-Jahre, wobei besonders die Beweggründe, die Umsetzung und die Reaktionen der Betroffenen untersucht werden.
Welche Rolle spielte der Völkerbund im Minderheitenschutz dieser Zeit?
Der Völkerbund garantierte internationale Minderheitenschutzabkommen. Die Arbeit untersucht, wie Polen und der SHS-Staat mit diesem System interagierten und wie das Sekretariat des Völkerbunds auf Beschwerden der Minderheiten reagierte.
Was waren die zentralen Maßnahmen der polnischen Minderheitenpolitik?
Die polnische Politik war geprägt von Polonisierung, Entdeutschung und einer teilweise unsystematischen Assimilierungspolitik, die unter Piłsudski zwischen Duldsamkeit und Repression schwankte.
Wie unterschied sich die Politik im SHS-Staat von der in Polen?
Im SHS-Staat standen neben der Assimilierung von Magyaren und Deutschen insbesondere Repression und Kolonisierung in Regionen wie Makedonien und dem Kosovo im Vordergrund, was schließlich in die Königsdiktatur ab 1929 mündete.
Welche Reaktionen zeigten die betroffenen Minderheiten auf staatliche Maßnahmen?
Die Minderheiten reagierten häufig mit offiziellen Beschwerden beim Völkerbund. In vielen Fällen führte der staatliche Druck zudem zu einer zunehmenden Radikalisierung der betroffenen Gruppen.
Warum kündigte Polen 1934 den Minderheitenschutzvertrag auf?
Die Aufkündigung war eine Folge der Verschärfung des deutsch-polnischen Gegensatzes und des Bestrebens Polens, sich der internationalen Kontrolle über seine interne Minderheitenpolitik zu entziehen.
- Quote paper
- Remo Wasmer (Author), 2011, Die Minderheitenpolitik in Polen und im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen in den 1920er-Jahren im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179093