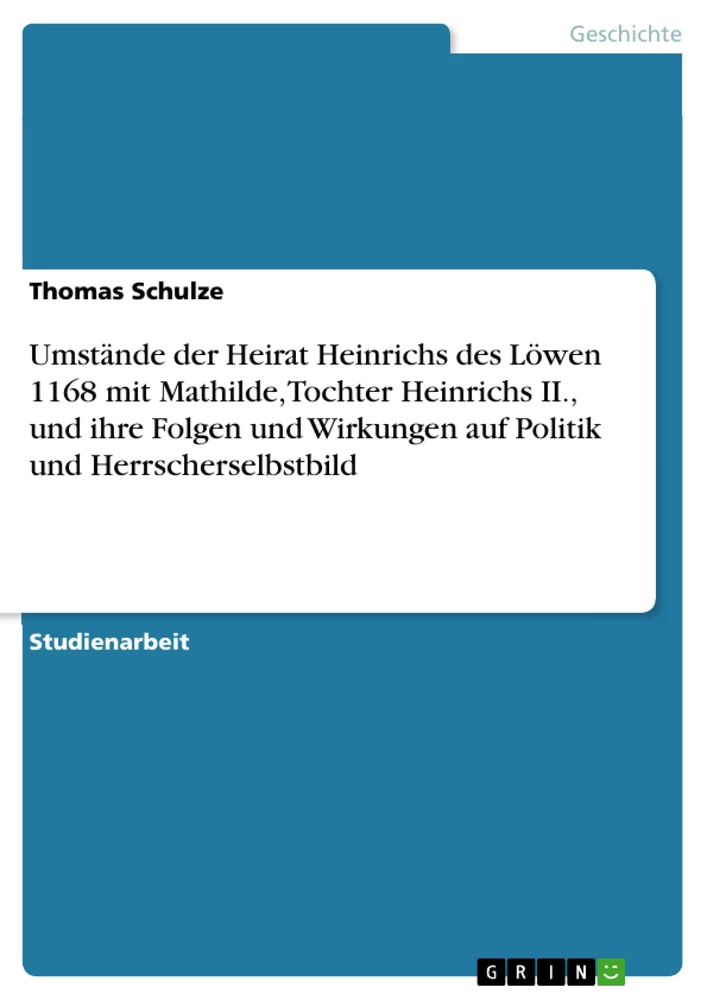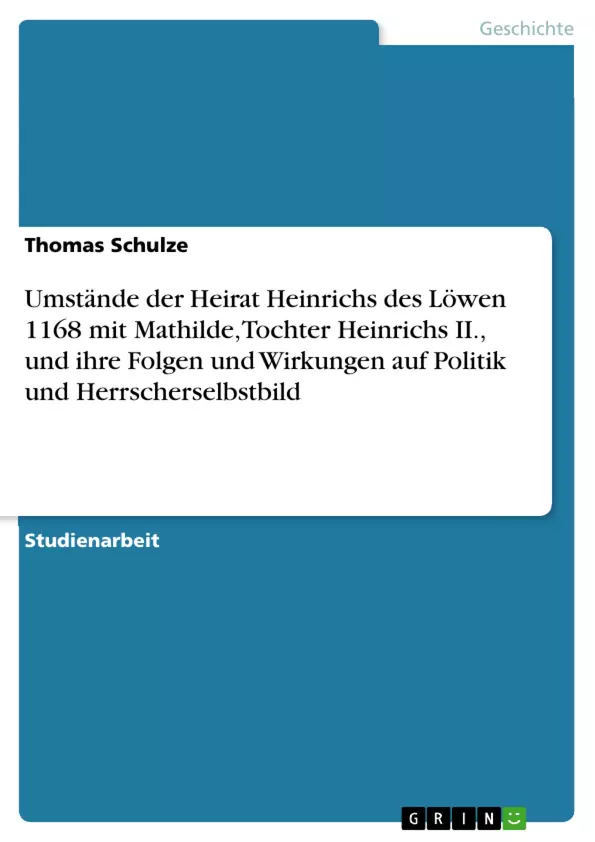Ziel dieser Proseminararbeit soll es sein, die Umstände der Heirat Heinrichs des Löwen 1168 zu untersuchen und ihre Wirkungen auf Politik und Herrscherbild darzustellen. 1168 heiratete Heinrich der Löwe, Herzog von Bayern und Sachsen, die Tochter des englischen Königs Heinrich II., Mathilde, und unterstrich damit seine Ausnahmestellung innerhalb der deutschen Fürsten erneut. Die Hausarbeit wird sowohl die Hintergründe der Heirat klären, als auch die direkten und indirekten Folgen auf Heinrichs Herrschaft nachvollziehen. Inwieweit hatte die Heirat Einfluss auf Heinrichs Macht? Kann in diesem Zusammenhang folglich von verstärkten Herrschaftsambitionen Heinrichs weit über seine fürstliche Herrschaft hinaus gesprochen werden?
Der erste Teil der Arbeit klärt die Hintergründe der Scheidung von Clementia von Zähringen 1162 und setzt sie in Zusammenhang mit den Umständen und Problemen der Vermählung 1168. Im zweiten Teil werden die daraus entstehenden politischen und herrschaftsrelevanten Konsequenzen resümiert und im dritten Teil auf ihre Gültigkeit am Beispiel des Krönungsbildes im Evangeliar geprüft.
Unzählige Publikationen setzen sich in unterschiedlicher Gewichtung mit Heinrich dem Löwen auseinander, weshalb es erforderlich ist, den Themenbereich dieser Arbeit einzugrenzen. Es kann und soll nicht genau auf Heinrichs erste Ehe eingegangen werden, lediglich einige Erkenn-tnisse können zu Vergleichszwecken herangezogen werden. Auch die expliziten Umstände Heinrichs Herrschaft vor 1166 und nach 1168 können nur angedeutet, aus Platzgründen aber nicht ausgeführt werden.
Als Quellen dienten unter anderem die Königschronik von Mönch Stephan sowie das Krönungs-bild des Gmundener Evangeliars. Vornehmlich soll jedoch die Forschungsliteratur als Instrument interpretatorischer Arbeit verwendet werden. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts erschien eine Vielzahl von Publikationen über Heinrich den Löwen, innerhalb derer sich in den letzten fünfzig Jahren ein Trend weg von dem bloßen Gewinnen von Erkenntnissen über die Hochzeit, hin zu einer kontroversen Diskussion um ihre Folgen und Wirkungen für Heinrich den Löwen und seine Herrschaft nach 1168 entwickelte.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Heirat Heinrichs des Löwen 1168 — direkte und indirekte Folgen
- Die Fakten und Umstände der Heirat mit Mathilde 1168
- Wirkungen und Folgen der Vermählung
- Vermeintlich verstärkte Herrschaftsgedanken Heinrichs am Beispiel des Krönungsbildes im Gmundener Evangeliar
- Zusammenfassung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Proseminararbeit untersucht die Umstände der Heirat Heinrichs des Löwen im Jahr 1168 und analysiert ihre Auswirkungen auf seine Politik und sein Herrscherbild. Die Arbeit befasst sich mit den Hintergründen der Heirat, den direkten und indirekten Folgen für Heinrichs Herrschaft und der Frage, ob die Heirat zu verstärkten Herrschaftsambitionen Heinrichs führte.
- Die Hintergründe der Scheidung von Clementia von Zähringen und ihre Verbindung zu den Umständen der Heirat 1168
- Die politischen und herrschaftsrelevanten Konsequenzen der Heirat
- Die Bedeutung des Krönungsbildes im Gmundener Evangeliar für die Interpretation von Heinrichs Herrschaftsansprüchen
- Die Rolle von Mathilde, Tochter Heinrichs II., in Heinrichs Leben und Politik
- Die Auswirkungen der Heirat auf Heinrichs Macht und Ansehen innerhalb des europäischen Kontextes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den Fokus der Arbeit und die Forschungsmethodik erläutert. Im ersten Kapitel werden die Umstände der Heirat Heinrichs des Löwen mit Mathilde, Tochter des englischen Königs Heinrich II., im Jahr 1168 beleuchtet. Die Arbeit geht auf die Hintergründe der Scheidung von Clementia von Zähringen ein, die politischen und dynastischen Motive für die Heirat mit Mathilde sowie die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die mit dieser Verbindung verbunden waren.
Das zweite Kapitel analysiert die direkten und indirekten Folgen der Heirat für Heinrichs Herrschaft. Die Arbeit untersucht, wie die Heirat Heinrichs Macht und Ansehen steigerte, insbesondere durch die hohe Mitgift Mathildes und die enge Verbindung zum englischen Königshaus. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Heirat im Kontext der Beendigung der Kämpfe in Sachsen und die Auswirkungen auf Heinrichs Selbstbild und seine Herrschaftsambitionen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Krönungsbild im Gmundener Evangeliar, einem wichtigen Artefakt, das Aufschluss über Heinrichs Selbstverständnis als Herrscher geben könnte. Die Arbeit diskutiert die Interpretation des Krönungsbildes und die Frage, ob es als Ausdruck von Heinrichs Wunsch nach königlicher Würde gedeutet werden kann. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf das Krönungsbild und die Argumente, die für und gegen eine Interpretation als königliche Legitimation sprechen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Heinrich den Löwen, Mathilde, Tochter Heinrichs II., die Heirat 1168, die Folgen der Heirat für Heinrichs Herrschaft, das Herrscherbild, das Krönungsbild im Gmundener Evangeliar, die Welfen, das englische Königshaus, die Machtverhältnisse im Heiligen Römischen Reich, die politische und kulturelle Bedeutung der Heirat, die Ausnahmestellung Heinrichs innerhalb der deutschen Fürsten, die Bedeutung von Dynastien und Familientraditionen im Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Warum heiratete Heinrich der Löwe 1168 Mathilde von England?
Die Heirat mit der Tochter des englischen Königs Heinrich II. diente dazu, Heinrichs Ausnahmestellung unter den deutschen Fürsten zu untermauern und seine Macht durch eine prestigeträchtige dynastische Verbindung zu festigen.
Was geschah mit Heinrichs erster Ehefrau?
Heinrich der Löwe ließ sich 1162 von Clementia von Zähringen scheiden, was den Weg für die politisch bedeutsamere Verbindung mit dem englischen Königshaus ebnete.
Welche Rolle spielt das Gmundener Evangeliar in dieser Arbeit?
Das Krönungsbild im Gmundener Evangeliar wird als Quelle analysiert, um Heinrichs Herrscherselbstbild und seine möglichen Ambitionen auf eine königliche Würde zu deuten.
Welche direkten Folgen hatte die Heirat auf Heinrichs Macht?
Die Heirat brachte eine hohe Mitgift ein, stärkte sein Ansehen im europäischen Kontext und half bei der vorübergehenden Beendigung von Kämpfen in Sachsen.
Wie wird die Heirat in der modernen Forschung bewertet?
In der Forschung der letzten 50 Jahre wird kontrovers diskutiert, inwieweit die Hochzeit tatsächlich als Beleg für verstärkte Herrschaftsambitionen über seine fürstliche Stellung hinaus gewertet werden kann.
- Quote paper
- Thomas Schulze (Author), 2008, Umstände der Heirat Heinrichs des Löwen 1168 mit Mathilde, Tochter Heinrichs II., und ihre Folgen und Wirkungen auf Politik und Herrscherselbstbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179156