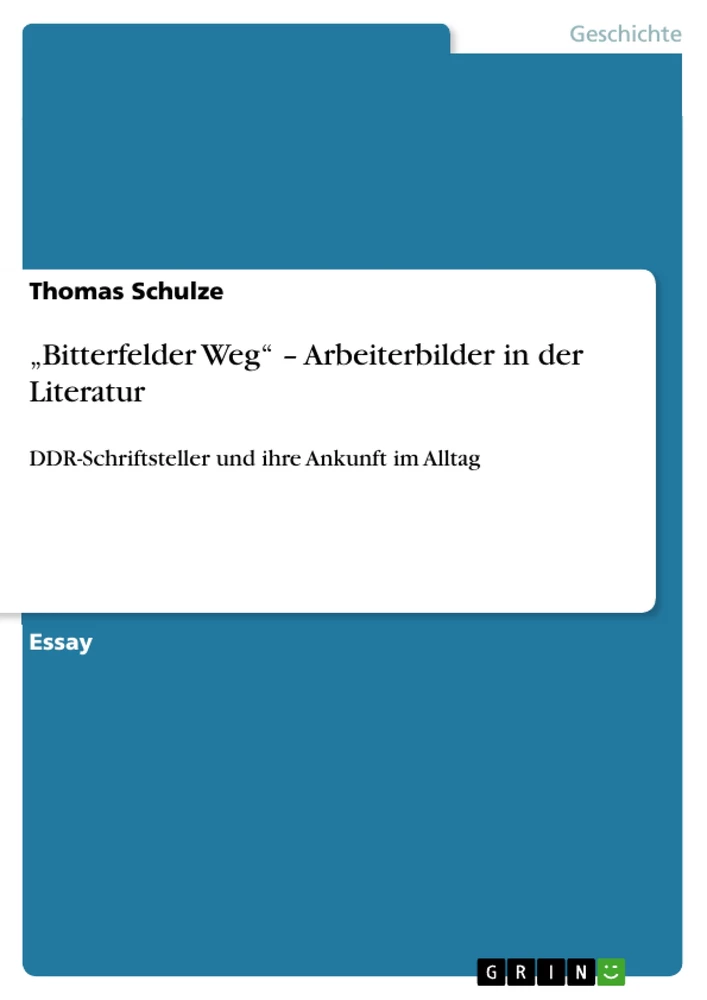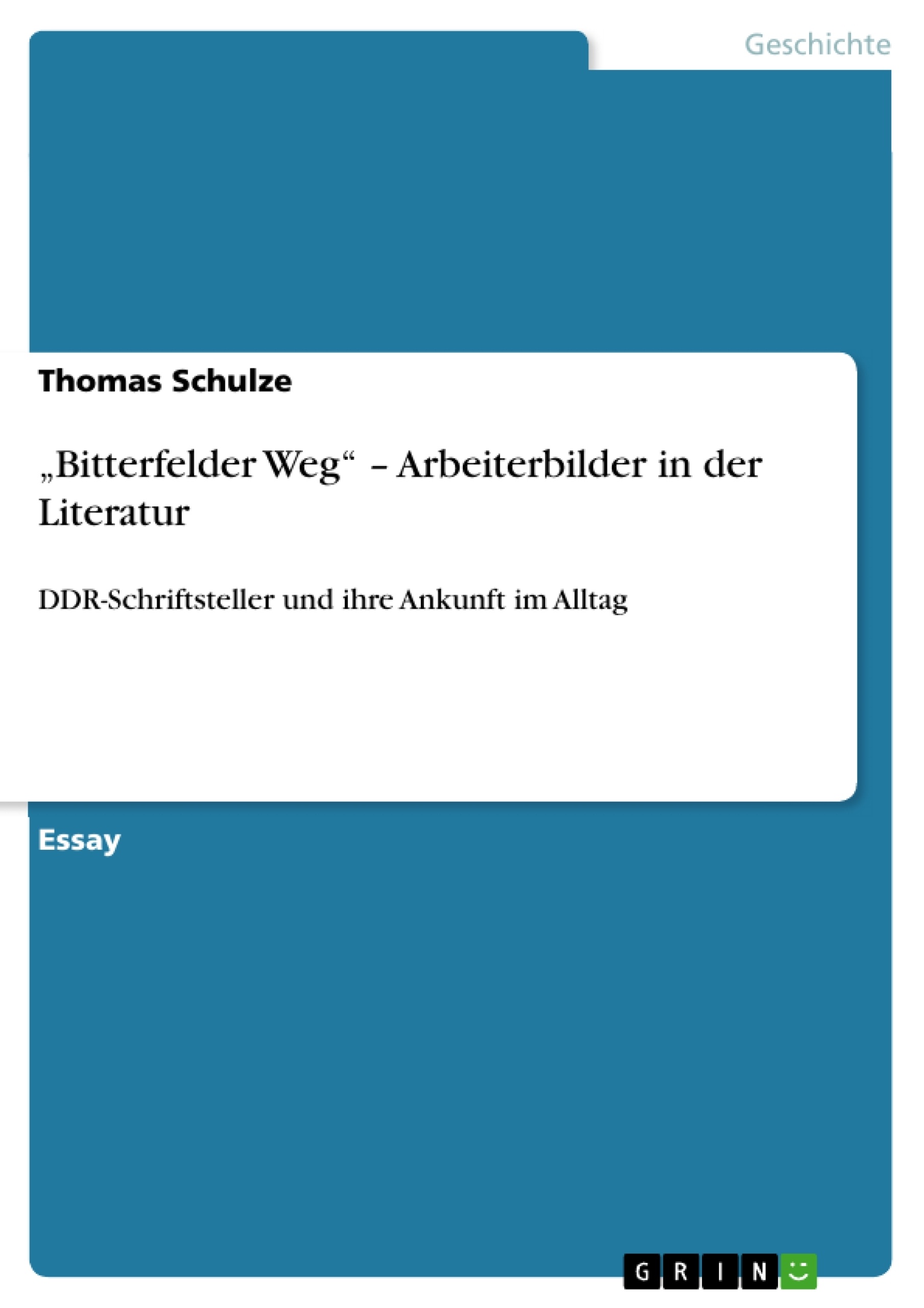„Das Bitterfelder Programm, ‚Greif zur Feder, Kumpel‘, war ja ganz einsichtig, heraus kam eine Parodie, Domestizierung statt Klassenemanzipation. Auch eine ABM für erfolglose Schriftsteller“ . So beschrieb der 1995 verstorbene Dramatiker Heiner Müller den 1959 in der DDR eingeschlagenen „Bitterfelder Weg“. Für viele Schriftsteller, Intellektuelle und Künstler stellte der „Bitterfelder Weg“ einen entscheidenden Einschnitt in ihrer künstlerischen Vita dar.
Im Kern dieses Essays soll die Frage stehen, welche Grundforderungen die Politik seit der Bitterfelder Konferenz an Schriftsteller wie auch Arbeiter stellte und inwiefern sich die Forderungen dieser politischen Agenda in den Werken des literarischen Zeitgeschehens wiederspiegeln. Dabei steht zunächst die Bitterfelder Konferenz selbst im Mittelpunkt. Ausgehend von den Prämissen der Konferenz stellen die lebensweltliche Realität der Arbeiter sowie die Schilderungen dieser Eindrücke in Form von Literatur den Kernpunkt der Betrachtung dar.
Inhaltsverzeichnis
- Die Bitterfelder Konferenz 1959 und ihre Forderungen
- Arbeitende Schriftsteller und schreibende Arbeiter
- Ankunft im Alltag, Rummelplatz und die schreibenden Arbeiter
- Ankunft gescheitert? — Zwischen Wunsch und Wirklichkeit
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert die Auswirkungen der „Bitterfelder Konferenz" von 1959 auf die Literatur in der DDR. Er untersucht die Forderungen der Politik an Schriftsteller und Arbeiter, die sich aus dieser Konferenz ergaben, und analysiert, wie diese Forderungen in den Werken der Zeit widergespiegelt werden.
- Die Bitterfelder Konferenz als Wendepunkt in der DDR-Literatur
- Die Rolle der Arbeiterklasse in der Literatur
- Die Konstruktion von Arbeiterbildern in der Literatur
- Die Beziehung zwischen Kunst und Politik in der DDR
- Die Auswirkungen der Bitterfelder Konferenz auf die literarische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Bitterfelder Konferenz 1959 und ihre Forderungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Hintergründe und Forderungen der Bitterfelder Konferenz, die die politische Agenda für die DDR-Literatur prägten. Die Konferenz forderte die Überwindung der Trennung zwischen körperlicher und künstlerischer Arbeit sowie die Mobilisierung der „arbeitenden Massen" auf kulturellem Gebiet. Die Erwartungen an die Konferenz und die politischen Ziele werden analysiert.
- Arbeitende Schriftsteller und schreibende Arbeiter: Dieses Kapitel untersucht die Folgen der Bitterfelder Konferenz für Schriftsteller und Arbeiter. Die Schriftsteller wurden aufgefordert, in die Betriebe zu gehen und die Erfahrungen der Arbeiter zu verschriftlichen, während die Arbeiter dazu angeregt wurden, ihre Arbeitswelt literarisch zu bearbeiten. Die Ziele und Auswirkungen dieser Initiative werden beleuchtet.
- Ankunft im Alltag, Rummelplatz und die schreibenden Arbeiter: Dieses Kapitel analysiert die literarische Darstellung des Arbeiterbildes im Kontext des „Bitterfelder Weges". Die Werke „Ankunft im Alltag" von Brigitte Reimann und „Rummelplatz" von Werner Bräunig werden als Beispiele für unterschiedliche Konstruktionen des Arbeiterbildes untersucht. Die Rolle der „schreibenden Arbeiter" und die Besonderheiten ihrer literarischen Produktion werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den „Bitterfelder Weg", die DDR-Literatur, Arbeiterbilder, die Beziehung zwischen Kunst und Politik, die „schreibenden Arbeiter" und die literarische Darstellung der Arbeitswelt. Der Text analysiert die Auswirkungen der Bitterfelder Konferenz auf die literarische Produktion in der DDR und beleuchtet die unterschiedlichen Konstruktionen des Arbeiterbildes in der Literatur der Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was war der "Bitterfelder Weg" in der DDR?
Der Bitterfelder Weg war ein 1959 initiiertes Programm der DDR-Kulturpolitik. Unter dem Motto "Greif zur Feder, Kumpel" sollten Arbeiter selbst literarisch tätig werden und Schriftsteller die Arbeitswelt in den Betrieben kennenlernen.
Welches Ziel verfolgte die Bitterfelder Konferenz?
Ziel war es, die Trennung von Kunst und Leben sowie von Hand- und Kopfarbeit zu überwinden und eine neue, sozialistische Nationalkultur zu schaffen, die fest in der Arbeiterklasse verwurzelt ist.
Wer waren die "schreibenden Arbeiter"?
Dies waren Laienautoren aus der Produktion, die in "Zirkeln schreibender Arbeiter" gefördert wurden, um ihre Alltagserfahrungen und die sozialistische Realität im Betrieb literarisch festzuhalten.
Wie reagierten etablierte Schriftsteller auf das Programm?
Viele Schriftsteller gingen tatsächlich in die Betriebe, um dort zu arbeiten oder Brigaden zu begleiten. Während einige dies als Chance zur Realitätsnähe sahen, kritisierten andere wie Heiner Müller das Programm später als Form der "Domestizierung".
Welche literarischen Werke sind typisch für diese Epoche?
Beispielhafte Werke sind "Ankunft im Alltag" von Brigitte Reimann und "Rummelplatz" von Werner Bräunig, wobei letzteres aufgrund seiner kritischen Darstellung zunächst verboten wurde.
- Arbeit zitieren
- Thomas Schulze (Autor:in), 2009, „Bitterfelder Weg“ – Arbeiterbilder in der Literatur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179160