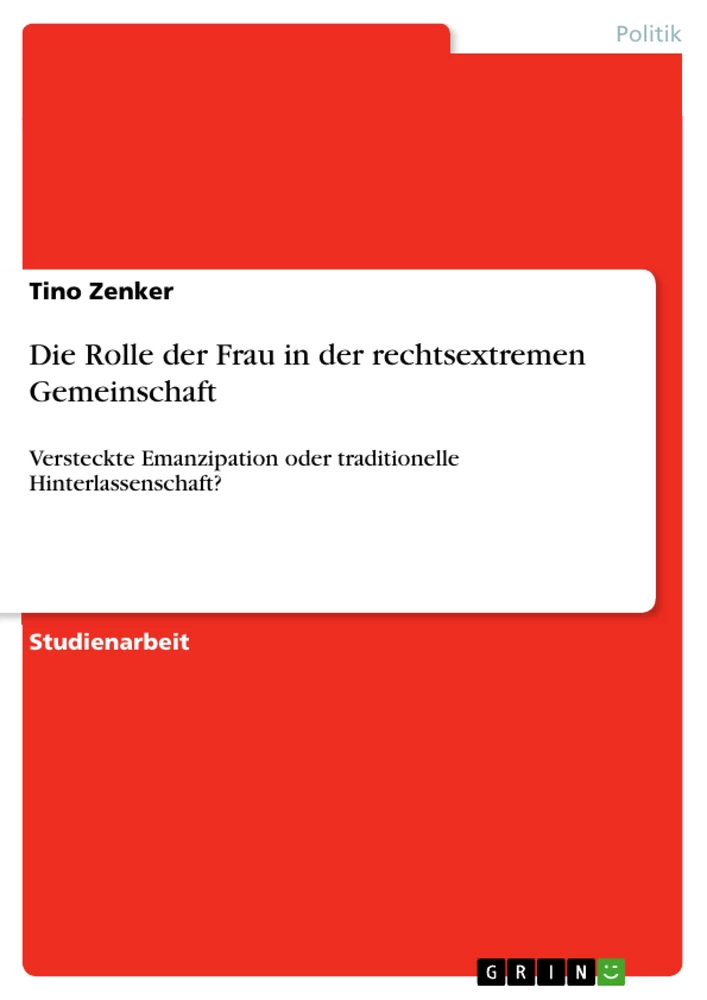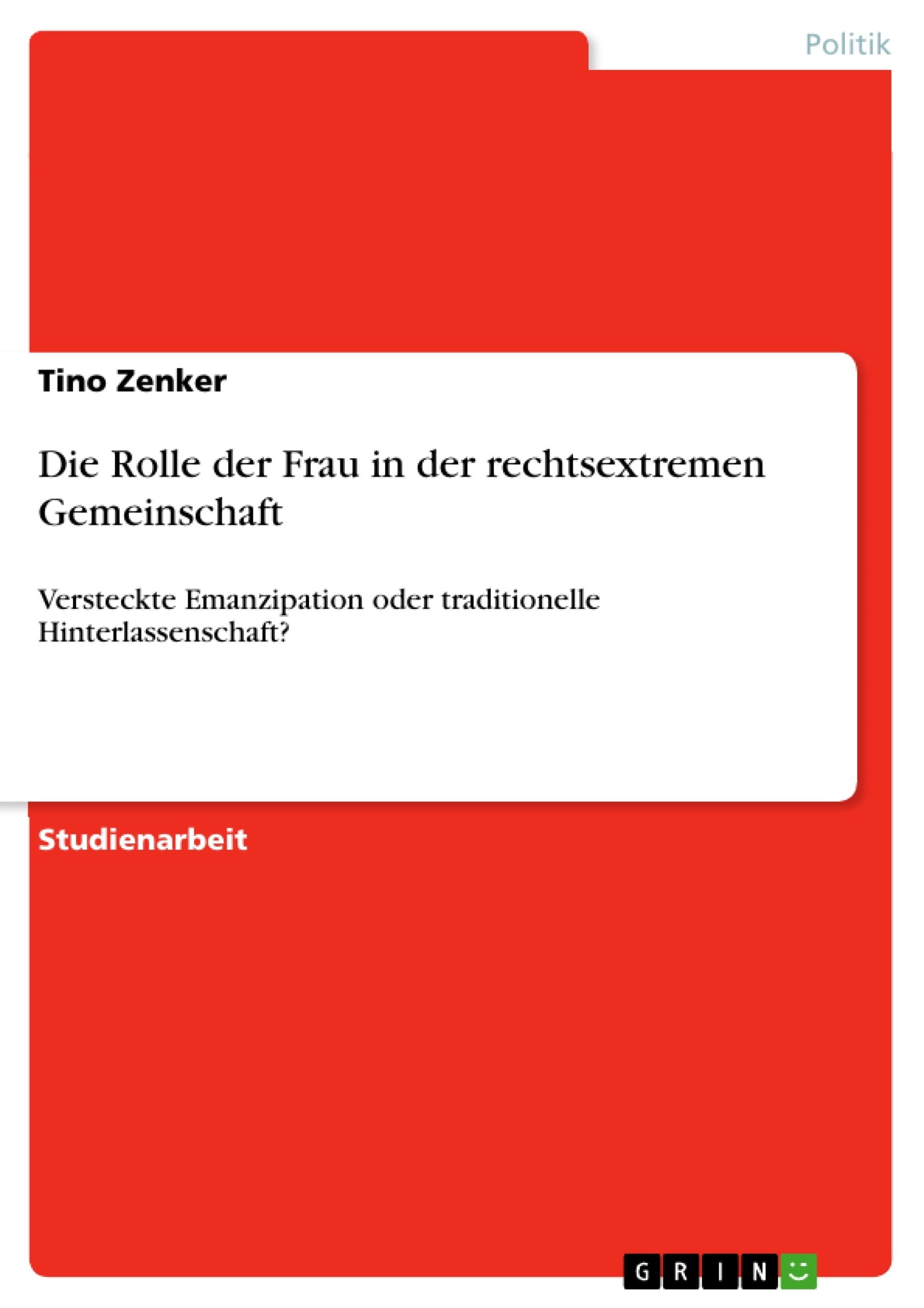In der heutigen Gesellschaft ist das Thema der Emanzipation allgegenwärtig und wird in der Mitte der Gesellschaft keineswegs mehr hinterfragt oder in Frage gestellt. Im besonderen Falle des Rechtsextremismus soll hierbei geklärt werden, ob auch hier eine Übernahme der Emanzipation stattgefunden hat, oder ob ein traditionalistisches Frauenbild à la Adolf Hitler noch immer Sympathisanten findet. In der Hausarbeit "Die Rolle der Frau in der rechtsextremen Gemeinschaft - Versteckte Emanzipation oder traditionelle Hinterlassenschaft?" soll geklärt werden, welches Frauenbild, bzw. welche Frauenbilder sich in der rechten Szene durchgesetzt haben. Hierfür beginne ich nach dieser Einleitung mit einem Abriss über die Rolle der Frau im Rechtsextremismus, um dann zu den beiden großen Gegenpolen von Ansichten zu kommen, die heute noch überwiegen. Hierbei stehen sich einerseits Frauenbilder von Männern, andererseits Selbstverständnisse von Frauen gegenüber, von denen man meinen könnte es handele sich um zwei verschiedene Diskussionspunkte. Mit der Darstellung von rechtem Feminismus werde ich die Themenerarbeitung abschließen.
Zu sagen ist, dass sich die wissenschaftliche Diskussion als eher schwierig gestaltet. Dies jedoch nicht, weil etwaige Besonderheiten die Forschung erschweren, sondern weil historische Forschungen Mangelware sind. Es gibt nur eine spärliche Anzahl aktueller Literatur und einige wenige Veröffentlichungen aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Nichtsdestotrotz soll am Ende herausgestellt werden, ob Frauen im Rechtsextremismus immer noch als Heimchen am Herd, oder mittlerweile schon als Kämpferinnen neben den Männern gesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frauen im Rechtsextremismus
- Die Rolle der Frau im Rechtsextremismus
- Das Frauenbild rechter Männer
- Das Selbstverständnis rechter Frauen
- Feminismus im Rechtsextremismus
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit „Die Rolle der Frau in der rechtsextremen Gemeinschaft - Versteckte Emanzipation oder traditionelle Hinterlassenschaft?" analysiert das Frauenbild innerhalb der rechtsextremen Szene, wobei sie die unterschiedlichen Perspektiven von Männern und Frauen in den Fokus nimmt. Die Arbeit untersucht, ob und inwiefern die Emanzipation in den rechtsextremen Diskurs Eingang gefunden hat oder ob traditionelle Geschlechterrollen weiterhin dominieren.
- Das Frauenbild im Rechtsextremismus: Traditionelle Rollenbilder vs. Emanzipation
- Die unterschiedlichen Perspektiven von Männern und Frauen in der rechtsextremen Szene
- Die Rolle von Frauen in der rechtsextremen Ideologie und Praxis
- Der Einfluss von feministischen Strömungen auf den Rechtsextremismus
- Die Debatte um „Feminismus" im Kontext des Rechtsextremismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über den Forschungsstand und die Relevanz der Thematik. Sie stellt die Frage, ob Frauen im Rechtsextremismus weiterhin als „Heimchen am Herd" oder bereits als „Kämpferinnen" neben den Männern gesehen werden.
Im zweiten Kapitel wird zunächst die Rolle der Frau im Rechtsextremismus allgemein beleuchtet. Anschließend werden die unterschiedlichen Frauenbilder von Männern und das Selbstverständnis rechter Frauen getrennt betrachtet. Dabei wird deutlich, dass es keine einheitliche Vorstellung von der Rolle der Frau in der rechtsextremen Szene gibt. Die Kapitel beleuchten die unterschiedlichen Perspektiven von Frauen, die sich mit dem Rechtsextremismus identifizieren, und die verschiedenen Formen von „Feminismus", die in diesem Kontext auftreten können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Rechtsextremismus, das Frauenbild, die Emanzipation, die Rolle der Frau, das Selbstverständnis von Frauen, Feminismus, Nationalismus, Rassismus, sexismuskritischer Nationalismus, traditionelle Geschlechterrollen, modernisierte Modelle, Gleichstellung, Frauenrechte, politische Teilhabe, Familie, Mutterschaft, Beruf, Parteiprogramme, rechtsextreme Organisationen.
Häufig gestellte Fragen
Welches Frauenbild herrscht in der rechtsextremen Szene vor?
Es gibt kein einheitliches Bild. Es existiert ein Spannungsfeld zwischen dem traditionalistischen Bild des "Heimchens am Herd" und dem modernen Bild der "Kämpferin" neben dem Mann.
Gibt es Feminismus im Rechtsextremismus?
Ja, es existieren Strömungen eines "rechten Feminismus", der zwar Frauenrechte einfordert, diese aber oft rassistisch oder nationalistisch begründet und sich von der liberalen Emanzipation abgrenzt.
Wie sehen rechtsextreme Männer die Rolle der Frau?
Viele Männer in der Szene hängen immer noch einem traditionalistischen Rollenverständnis an, das die Frau primär in der Rolle der Mutter und Hüterin der Familie sieht.
Was ist das Selbstverständnis rechter Frauen?
Rechte Frauen sehen sich oft als aktive Mitstreiterinnen in der Bewegung, die politische Teilhabe fordern, ohne dabei ihre Rolle in der Familie vollständig aufzugeben.
Hat die Emanzipation den Rechtsextremismus verändert?
Die Arbeit untersucht, ob eine "versteckte Emanzipation" stattgefunden hat, die dazu führt, dass Frauen heute selbstbewusster in rechtsextremen Organisationen und Parteien auftreten.
- Citar trabajo
- Tino Zenker (Autor), 2011, Die Rolle der Frau in der rechtsextremen Gemeinschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179164