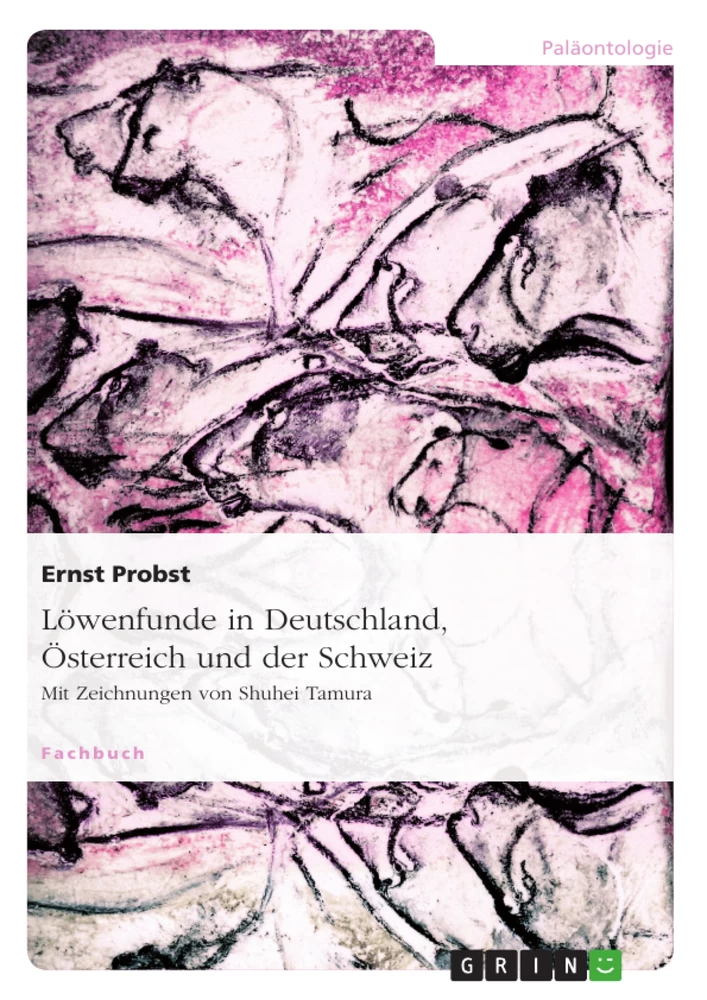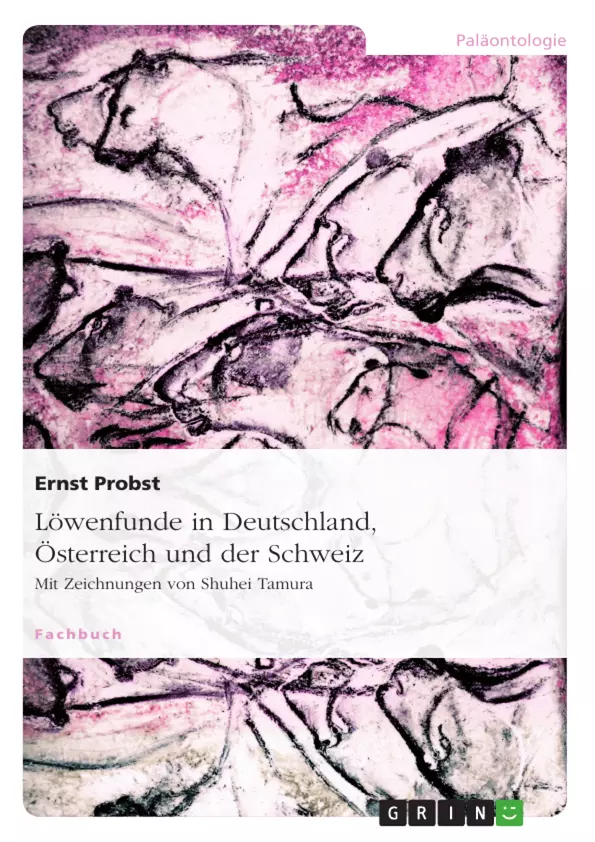Löwenfunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen im Mittelpunkt des gleichnamigen Taschenbuches des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst. Allein in Deutschland kennt man mehr als 100 Fundstätten, an denen man fossile Reste von zwei verschiedenen Löwenformen aus dem Eiszeitalter (Pleistozän) barg. Die geologisch ältere und größere dieser beiden Raubkatzen ist der riesige Mosbacher Löwe (Panthera leo fossilis). Er wurde nach etwa 600.000 Jahre alten Funden aus dem ehemaligen Dorf Mosbach bei Wiesbaden in Hessen benannt. Dieser Mosbacher Löwe gilt mit einer Gesamtlänge von bis zu 3,60 Metern als der größte Löwe aller Zeiten in Deutschland und Europa. Seine Kopfrumpflänge betrug etwa 2,40 Meter, sein Schwanz maß weitere 1,20 Meter. Von dieser imposanten Raubkatze stammt der Europäische Höhlenlöwe (Panthera leo spelaea) ab, der im Eiszeitalter vor etwa 300.000 bis 10.000 Jahren in Europa lebte. Letzterer wurde nach einem Fund aus der Zoolithenhöhle von Burggaillenreuth bei Muggendorf in der Fränkischen Schweiz (Bayern) erstmals wissenschaftlich beschrieben. Insgesamt kamen dort Reste von mehr als 25 Höhlenlöwen zum Vorschein. Nirgendwo auf der Welt fand man noch mehr Knochen und Zähne von Höhlenlöwen als dort. Ernst Probst erwähnt in seinem Taschenbuch auch Funde von Säbelzahnkatzen, Jaguaren, Leoparden und Geparden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Inhalt
Dank
Vorwort
Löwenfunde in Deutschland
Löwenfunde in Österreich
Löwenfunde in der Schweiz
Eiszeitliche Raubkatzen
Der Mosbacher Löwe
Der Europäische Höhlenlöwe
Der Europäische Jaguar
Die Säbelzahnkatze
Der Leopard
Der Schnee-Leopard
Der Gepard
Der Puma
Der Autor /
Literatur /
Bildquellen /
Häufig gestellte Fragen
Welcher war der größte Löwe, der jemals in Deutschland lebte?
Der Mosbacher Löwe (Panthera leo fossilis) gilt mit einer Länge von bis zu 3,60 Metern als der größte Löwe Europas.
Was ist der Europäische Höhlenlöwe?
Es ist eine ausgestorbene Löwenform (Panthera leo spelaea), die vor etwa 300.000 bis 10.000 Jahren in Europa lebte und vom Mosbacher Löwen abstammt.
Wo befindet sich die bedeutendste Fundstätte für Höhlenlöwen?
Die Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth in der Fränkischen Schweiz ist weltweit der Ort mit den meisten Funden von Knochen und Zähnen des Höhlenlöwen.
Gab es in Deutschland auch andere Raubkatzen in der Eiszeit?
Ja, neben Löwen wurden auch Fossilien von Säbelzahnkatzen, Jaguaren, Leoparden und Geparden gefunden.
Wie alt sind die Funde des Mosbacher Löwen?
Die Funde aus Mosbach bei Wiesbaden werden auf ein Alter von etwa 600.000 Jahren datiert.
- Arbeit zitieren
- Ernst Probst (Autor:in), 2011, Löwenfunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179190