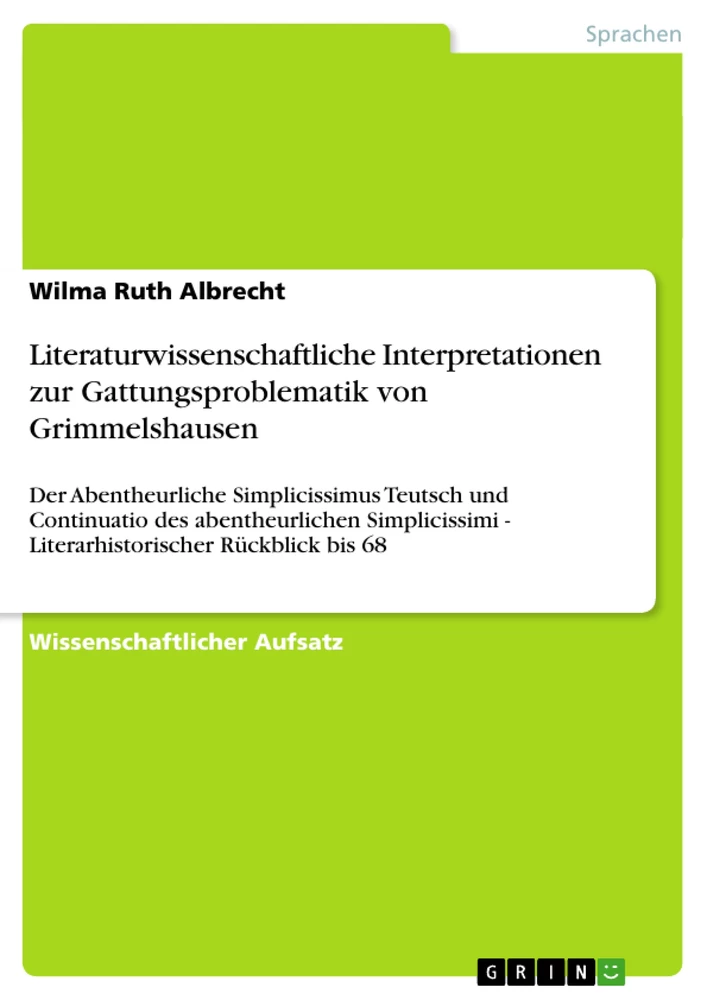Im diesem fachhistorischen Text zum SIMPLIZISSIMUS diskutiert die Autorin im Rückblick wesentliche bis 1968 publizierte literaturwissenschaftliche Untersuchungen. Damit geht es ohne weitere Aktualisierungen um einen literarhistorischen Rückblick bis ´68.
An diese wissenschaftsgeschichtliche Rekonstruktion könnte fortschreibend angeschlossen werden, etwa mit Blick auf die fachliche SIMPLIZISSISMUS-Rezeption seit Beginn der 1970er Jahre einschließlich der 2009 veröffentlichten, mehrfach ausgelobten Simplizissismus-Neuedition von Kaiser.
I. Als Gattungen lassen sich Dichtungen oder “Klassen von Werken” mit bestimmten gemeinsamen Merkmalen bezeichnen:
“Die literaturwissenschaftliche Forschung verwendet literarische Gattungsbegriffe in drei verschiedenen Bedeutungsvalenzen: rein klassifika- torische Ordnungsbegriffe ohne Erkenntniswert (Croce), zur Bezeichnung literaturhistorisch und ideengeschichtlich fixierbarer Dichtungsformen (Benjamin Szondi) und als typologische Grundbegriffe (Staiger). Diese kategorialen Bestimmungen finden sich in der Literaturgeschichte und - kritik nur selten mit der gleichen Deutlichkeit differenziert. Einander widersprechende Auffassungen des Gattungsbegriffes werden unkontrolliert miteinander verbunden.”[1]
Im wesentlichen liegen diesen Gattungsbegriffen zwei verschiedene Methoden zugrunde, die kennzeichnend für die Literaturwissenschaft im allgemeinen sind, sich auch auf die Gattungsbestimmung auswirken und hier aus analytischen Zwecken getrennt werden können in positivistische und psychologische Methode.
Die positivistische Gattungsauffassung meint: “Gattungen sind empiri-sche Ordnungskategorien für literarische Werke aufgrund bestimmter gemeinsamer innerer und äußerer Merkmale [ ], die sich a posteriori aus den geschichtlich vorhandenen Dichtungen ergeben.[2] ”
Ihr Schwergewicht legt sie auf die empirische Nachprüfbarkeit, wodurch genauere und widerspruchsfrei Klassifizierungen ermöglicht werden.
Die psychologische Gattungsauffassung geht davon aus, dichterische Gattungen aus den “Grundformen menschlicher Weltbewegung” (Staiger) abzuleiten. Ihr Schwergewicht bildet das normative Moment.
Diese Differenzierung ermöglicht jedoch noch keine formalen Bestimmungen einzelner dichterischer Werke.
“Deshalb sind innerhalb einer Gattung sehr verschiedene Dichtungsarten möglich, die sich aufgrund verschiedener weltanschaulicher, soziologi- scher, psychologischer und personaler Bedingungen ergeben.[3] ”
Eine dieser Dichtungsarten ist der Roman, der unter verschiedenen Aspekten behandelt und betrachtet werden kann und damit weitere Untergattungen eröffnet. Dies dient dazu, “der Fülle der Phänomene und Formen ... ein ordnendes Prinzip gegenüberzustellen, so daß diese Fülle überschaubar und beschreibbar wird.”[4]
Angesichts der unterschiedlichen Ansätze zur gattungsspezifischen Bestimmung des Romans allgemein ist es nicht verwunderlich, daß verschiedene Literaturwissenschaftler den Roman “Simplizissimus” von Grimmelshausen auch unterschiedlich einordnen. Diese unterschiedliche Einordnung hängt auch damit zusammen, welche Schwerpunkte innerhalb der Literaturwissenschaft und -geschichte in gewissen zeitlichen Phasen gesetzt wurden und in der wissenschaftlichen Grimmelshausenforschung ihren Niederschlag fanden. Dabei können mehrere Phasen unterschieden werden:
Die erste Phase umfasst die der so genannten “vorwissenschaftlichen”[5] Literaturkritiker und -historiker, die sich bemühten, das gattungsspezifische Moment des Werkes zu erfassen. Sie legten dabei erste Ansätze einer subtilen Interpretation vor, die auch inhaltliche und sprachliche Eigenheiten der Dichtung beachtete.
In dieser Phase lassen sich schon die beiden möglichen Positionen erkennen, die, wenn auch noch nicht explizit dargestellt, innerhalb der wissenschaftlichen Gattungszuordnung des “Simplicissimus” die äußeren Begrenzungen und extremen Standorte fixieren: einmal die Einordnung in die Gruppe der Entwicklungs- und Bildungsromane und zum anderen in die der Picaro- und Schelmenromane.[6]
II. Die Romantik versucht, Dichtung nicht mehr nach normativen technischen und formalen Kriterien zu bestimmen und zu klassifizieren - auch deshalb, um eigene literarisch-dichterische Erzeugnisse zu legitimieren. Damit gerät Literatur in den Bannkreis der Philosophie. Dabei lassen sich drei Richtungen kennzeichnen:
“Einmal die Richtung Hegels ., die in den konkreten Arten der Dichtung die Verwirklichung von Gattungsideen sehen will, dann der fürs 19. Jahrhundert so bezeichnende Empirismus, der das Sammeln und Ordnen von reinen Erfahrungen als wesentliche wissenschaftliche Tätigkeit ansieht; er führt daher die Dichtung auf geschichtliche und psychologische Gegebenheiten zurück ... Endlich als dritte Richtung die Bemühungen, die sich aus der fortschreitenden Vertiefung der Psychologie ergeben; sie führen schon ins 20. Jahrhundert herüber. Der Ausgangspunkt ist Dilthey mit seiner geisteswissenschaftlichen Psychologie [7]...”
Diese verschiedenen philosophischen Wurzeln der deutschen Philologie spiegeln sich auch in der “Grimmelshausenforschung” wider. So zeigt sich der Empirismus hauptsächlich in der Beschäftigung mit der Quellen- о forschung zum[8] “Simplicissimus” und in den Bemühungen, biographische Daten über den Dichter zu sammeln. Aus dieser Gruppe ragt besonders Gustav Könnecke hervor, der aufgrund differenzierter Kenntnisse von Grimmelshausens Leben und methodischer Textinterpretation den ausgesprochenen Kunstcharakter des Romans betonte und der bislang vorherrschenden Meinung, der “Simplicissimus” sei als biographische Dichtung zu betrachten, den Boden entzog:
“Der "Simplicissimus" ist jedoch nicht etwa des Verfassers Lebensgeschichte, sondern reiner Kunstroman von der Gattung der Schelmenro- mane.[9]
Neben dieser im Großteil quellengeschichtlich bezogenen Forschung läßt sich eine andere Richtung erkennen, die die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge, in denen Dichter und Werk stehen, erforscht, ja, sogar weitgehend in Psychologie und Metaphysik taucht, wodurch sich spekulative Aussagen in der Interpretation nieder schlagen. Im wesentlichen diese geisteswissenschaftliche Betrachtungsweise spielt in der folgenden Zeit eine bedeutende Rolle[10], denn von ihr aus wird bei der Gattungszuordnung des “Simplicissimus” die Betonung und das Schwergewicht auf den Entwicklungs- und Bildungsroman gelegt.
Allgemein wird als Entwicklungs- und Bildungsroman eine speziell an die deutsche kulturelle Situation gebundene Form des Romans verstanden, die die “charakteristische Antithetik von Innerlichkeit und sozialer Bewährung in einem symbolisch-realistischen Erzählen”[11] aufheben will. Dem Inhalt nach liegt einer solchen Romanform das Leben oder ein Teil davon als Hauptvorgang zugrunde:
“Je mehr einer solchen Romangestaltung die innere, seelische Entwicklung der Hauptgestalt im Vordergrund steht, desto eher wird man von Entwicklungsroman sprechen können. Eine wichtige Gruppe unter diesen ist der sogenannte Bildungsroman.”[12]
Als einer der frühen Vertreter dieser Richtung gilt Wilhelm Scherer[13], der den Echtermeyerschen Vergleich mit dem “Parzival” wieder aufgreift, jedoch bei seiner Interpretation Unterschiede in moralischer Hinsicht bei den Helden beider Werke betont. Für ihn ist “Grimmelshausen” deshalb ein Entwicklungs- und Bildungsroman, weil er glaubt eine Entwicklung der Hauptperson von Einfalt - Sünde - Läuterung erkennen zu können.
Friedrich Gundolf ist der erste, der explizit den “Simplicissimus” in die Phalanx der großen Bildungsromane einreiht. In phänomenologischer Sicht versucht er das Kunstwerk zu erfassen als individuellen Ausdruck eines genialen Künstlers, der wohl, da in einer bestimmten Zeit lebend, dieser auch Zugeständnisse machen muß (z. B. Überfüllung mit Wisse- rei). Primär steht aber die persönliche Intention des Künstlers, denn “aus eigenen Bedürfnissen schuf Grimmelshausen den ersten neuhochdeutschen Bildungsroman, d. h. Weltbildungsroman, der über viereinhalb Jahrhunderte hinweg gleichsam Wolframs "Parzifal" verkörpert und um vier Menschenalter den "Wilhelm Meister" vordeutet.”[14]
Grimmelshausens eigenes Leben zeige sich in Stoff und Inhalt des Romans und dränge den Dichter zum “Bericht”. Dennoch faßt Gundolf das Werk nicht als Autobiographie auf, sondern als echten Bildungsroman:
“Um 1650 war die Suche nach dem Seelenheil, was um 1800 das Bildungsstreben: das bewegende Prinzip des edleren deutschen Jünglings. Beidemale führte der Weg durch die breite Welt mit ihren mannigfachen Versuchungen und Offenbarungen.”[15]
Charakteristikum des Bildungsromans ist für Gundolf “das Ringen des ewig werdenden deutschen Jünglings mit der Erscheinung der Welt”, das hier bei “Simplicissimus” aus “Tumbheit” zur Frommheit führt.
Gerade bei Gundolf, einem “Jünger” von Stefan George, zeigt sich in der Mythologisierung des Dichters und der Betonung des Geniecharakters abstrahiert vom geschichtlichen Bezugsrahmen, wie sehr unter einer solchen Betrachtungsweise Ergebnisse der Werkanalyse ungenau und austauschbar sind.
Unterstützung erfährt Gundolf bei seiner Gattungszuordnung durch Emil Ermatinger, der die Widersprüchlichkeiten der Figur des “Simplex” wie auch die Sprache als Ausdruck eines tief religiösen Selbst- und Weltverständnisses des Dichters betont: “Das Bildungsgesetz, nach dem Grimmelshausen das Leben seines Helden entwickelt, ist die Unbeständigkeit. Aber der Sinn des Lebens ist es, hinter den ewigen Wandel der Erscheinungsformen das Bleibende, Beständige, Ewige zu finden, das die Erlösung des Menschen ausmacht.”[16]
Fritz Halfter[17], der das Titelkupfer des “Simplicissimus” interpretiert, meint eine Parallele zwischen dem Ideengehalt der Abbildung des Fabeltieres und den Grundgedanken des Romans erkennen zu können.
Ähnlich wie Gundolf, der das Dichtwerk aus dem Selbstverständnis des Dichters heraus verstehen will, geht auch Borcherdt vor, jedoch läßt er sich auch noch von einer positivistischen Einstellung leiten, wenn er den Versuch unternehmen will, “zu Stilbestimmungen vorzustoßen und die Entwicklung der Prosadichtung aus der allgemeinen Zeitgeschichte zu deuten” . Sobald sich Borcherdt gattungsthoretischer Ausdrücke bedient, werden sie geschichtlich[18] relativiert. Das ist der Fall, wenn er den “Simplicissimus” sowohl als Schelmenroman wie auch als Bildungs- und Entwicklungsroman bezeichnet. Jedoch läßt sich seine Interpretation des Werkes nur verstehen im Zusammenhang seines in der Einleitung dargelegten Romanverständnisses, das er in Abgrenzung gegenüber der Novelle gewinnt. Danach wird die Novelle in Anlehnung an Johann Wolfgang Goethe als “Darstellung einer sich ereigneten unerhörten Begebenheit”, der Roman als “subjektive Epopöe” begriffen, in dem sich das Subjekt des Künstlers in der Form wie in der inneren Darstellung spiegelt, weshalb auch der Romandichter niemals vollständige Objektivität erreichen kann:
“Man wird aber von einer relativen Objektivität des Künstlers sprechen dürfen, wenn der Dichter von den Forderungen der Form überzeugt ist und daher eine Distanz zwischen Erlebnis und Form erstrebt.”[19]
So kann jeweils die Form des Romans durch die Position des Dichters in und gegenüber seinem Werk bestimmt werden, da das Werk direkt die persönliche Absicht des Verfassers zum Ausdruck bringt, was Borcherdt in Grimmelshausens “Simplicissimus” als gegeben ansieht:
“Der "Simplicissimus" z. B. ist ein subjektiver Bekenntnisroman, in dem die Weltanschauung des Verfassers die Form bestimmt.[20] ”
Einen interessanten Aspekt zeigt dieser Wissenschaftler auf, wenn er aus dem Bezug des Künstlers zu seiner Welt eine Realitätseingrenzung des Romans folgert, der sich, um Unwirkliches auszudrücken, besonderer Formen bedienen muß.
Neben dieser Zeit und Ort einbeziehenden Gattungsbestimmung Grimmelshausens “Simplicissimus” finden sich auch diese relativierende. So zeigt der Verfasser eine Entwicklungslinie zwischen den spanischen und deutschen Schelmenromanen auf und arbeitet Gegensätze heraus.
“Während der spanische Picaro sich in jeder Lebenslage zurechtfindet und die Dinge meistert, läßt sich hier sein deutscher Bruder von den Verhältnissen bezwingen.”[21]
Dadurch erhält der deutsche Schelmenroman einen sentimentalen Zug, der den spanischen Dichtungen völlig fremd ist. Diese beiden Extreme gehen im “Simplicissimus” eine Synthese ein.
“Diese Einseitigkeiten der spanischen und deutschen Problemstellung des Schelmenromans konnten nur überwunden werden, wenn eine Synthese von Charakterentfaltung und Idee gelang, wenn der Picaro als tragische Figur und seine Taten als notwenige Geschehnisse seiner innersten Natur behandelt wurden. Diese Verinnerlichung des Problems ist Grimmelshausen in seinem “Simplicius Simplicissimus” gelungen, der in diesem Zusammenhang als der Gipfelpunkt der spanischen und der deutschen Schelmenromane erscheint.[22] ”
Vom Ausgangspunkt aus, daß der Dichter sich des tragischen Moments - der Diskrepanz zwischen Idee und Wirklichkeit - bewußt sei und daß er sich im Romanhelden selbst findet und durch ihn mitteilt, legt Borcherdt Grimmelshausen eine erzieherische Absicht zugrunde; danach verkörpert der Simplicissimus die gesamte Menschheit:
“Wie er, so sind alle in Schuld verstrickt, solange sie sich der Frau Welt ergeben. So wird der "Simplicissimus" mit der Durchführung dieser Idee zum Erziehungsroman des 17. Jahrhunderts, zum Bildungsroman des Ba- rocks.Der Ichroman wird zum grandiosen Bekenntnisroman ausgebaut.”[23]
Die Weiterentwicklung der pikarischen Romane entspringt letztlich allein aus der Intention des Dichters, seinem Selbstverständnis (das ideologisch präformiert ist) und seiner Problemerfassung.
Die intensivste, jedoch in der Forschungsliteratur umstrittene Auffassung, den “Simplicissimus” als Entwicklungsroman zu betrachten, findet sich bei Melitta Gerhard; diese Autorin versucht, eine Geschichte des Entwicklungsromans zu schreiben. Dabei legt sie ihren Ausführungen diese Definition des Romantyps zugrunde.
[...]
[1] K. R. Scherpe: Gattungspoetik im 18. Jahrhundert. Stuttgart 1968, S. 1
[2] H. Maiworm: Neue deutsche Epik. In: Grundlagen der Germanistik. Berlin 1968, S. 10
[3] H. Maiworm: Neuer … aaO (Anm. 2), S. 12
[4] F. Stanzel: Typische Formen des Romans. Göttingen ³1967, S. 7
[5] Der Begriff „vorwissenschaftlich“ wird hier in Anlehnung an Hans Mayer verwendet: Literaturwissenschaft in Deutschland. In: Das Fischer-Lexikon Literatur 2/1. Frankfurt/M. 1965
[6] Für diese erste Zeitspanne kann exemplarisch angeführt werden: 1. A. G. Kästner: Vermischte Schriften, ³1783, S. 421 ff. – Hier wird Grimmelshausens „Simplicissismus“ als Vergleichswerk zu Dafoes „Robinson Crusoe“ behandelt. Dabei meint er, der Simplicissimus könne die Anciennität der „Robinsonadenschaft“ für Deutschland beanspruchen 2. L. Wachler: Handbuch der Geschichte der Literatur, 2. Umarbtg. 1822-1824, 3. Teil, S. 317 ff: Vorlesungen über die Geschichte der deutschen Nationalliteratur. 1818, 2. Bd., S. 70 ff. Auch er sieht im „Simplicissimus“ einen Vorläufer der Robinsonden, betont jedoch außerdem noch den realistischen Charakter und die satirische Darstellung des Erzählten: „Die vorwaltende Richtung des gleichsam aus dem bunten Leben selbst erwachsenen Buches ist satyrisch, sie kündigt sich in wohlwollender Leichtigkeit an, die Welt zu nehmen, wie sie nun eben ist, und in ironischnaiver Freude daran, sie so zu schildern.“ 3. T. Echtermeyer: Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst. 1838, No. 52, Sp. 413 ff. Die Abentheuer des Simplicissimus. Ein Roman des dreißigjährigen Krieges. Hg. E. v. Bülow. Hier wird zum ersten Mal der Vergleich zwischen „Simplicissimus“ und „Parzifal“ vorgenommen, der bis heute noch angeführt wird. 4. A. Passow: Christoffel von Grimmelshau-sen, der Verfasser des Abentheuerlichen Simplicissimus [...] In: Blätter für literarische Unterhaltung, 1843, S. 1042 ff. Er empfiehlt zum Vergleich mit dem Hauptwerk Grimmelshausen den „Eulenspiegel“ heranzuziehen. Siehe auch G. Herbst: Die Entwicklung des Grimmelshausenbildes in der wissenschaftlichen Literatur. Bonn 1956, S. 54 ff., hier besonders S. 70-77
[7] H. Seidler: Die Dichtung. Wesen - Form - Dasein. Stuttgart 1959, S. 5
[8] Als Beispiele dieser Richtung lassen sich anführen 1. A. Birlinger: Studien zu Grimmelshausens Simplicissimus. 1882 2. R. v. Payer: Eine Quelle des Simplicissimus. 1889-90 3. A. Bechthold: Zur Quellengeschichte des Simplicissimus. 1910/11 4. J. H. Scholte: Probleme der Grimmelshausenforschung. 1912
[9] K. Könnecke: Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur, ²1895, S. 189
[10] Die Vertreter dieser Richtung waren nicht immun gegen die Gefährdung durch Antihistorismus und Mythenbildung. Mayer urteilt scharf: „Die Substanz dieser Schule? Preußisch-deutsche Ideologie. Die Methode? Deutsche Philologie als Selbstzweck?“ H. Mayer, Literaturwissenschaft …, aaO (Anm. 5), S. 327
[11] V. Lange: Epische Gattungen. In: Das Fischer Lexikon. Literatur 2/1, aaO (Anm. 5)S. 227
[12] H. Seidler: Die Dichtung .., aaO (Anm. 7), S. 558
[13] W. Scherer: Geschichte der Deutschen Literatur. 12. Auflage. Berlin 1911, S. 380 f.
[14] F. Gundolf: Grimmelshausen und der Simplicissimus. In: DVJ, Bd. 1, Jg. 1, Halle 1923, S. 339
[15] F. Gundolf: Grimmelshausen…, aaO (Anm. 14), S. 351
[16] Zitiert nach G. Herbst: Die Entwicklung des Grimmelshausenbildes in der wissenschaftlichen Literatur. Bonn 1956, S. 123
[17] F. Halfter: Bildsymbolik und Bildungsidee in Grimmelshausens Simplicius Simplizissimus. In: Euphorion, 17. Ergänzungsheft 1924
[18] H. H. Borcherdt: Geschichte des Romans und der Novelle in Deutschland. I. Teil. Leipzig 1926 (Vorwort)
[19] H. H. Borcherdt: Geschichte…, aaO (Anm. 18), S. 3
[20] H. H. Borcherdt: Geschichte…, aaO (Anm. 18), S. 4
[21] H. H. Borcherdt: Geschichte…, aaO (Anm. 18), S. 161
[22] H. H. Borcherdt: Geschichte…, aaO (Anm. 18), S.162
[23] H. H. Borcherdt: Geschichte…, aaO (Anm. 218), S. 164
Häufig gestellte Fragen
In welche literarischen Gattungen wird Grimmelshausens „Simplicissimus“ eingeordnet?
Die Forschung diskutiert primär zwei Einordnungen: als Schelmenroman (Picaroroman) oder als frühen Vorläufer des Bildungs- und Entwicklungsromans.
Was spricht für die Einordnung als Bildungsroman?
Vertreter wie Gundolf sehen im Werk die geistige Entwicklung des Helden von der „Tumbheit“ zur religiösen Läuterung und Frommheit, ähnlich der Struktur von Wolframs „Parzival“.
Warum wird das Werk oft als Schelmenroman bezeichnet?
Die positivistische Forschung betont den Kunstcharakter und die episodische Struktur, in der ein Außenseiter (Picaro) durch eine chaotische Welt wandert und verschiedene soziale Rollen einnimmt.
Wie unterschieden sich die Forschungsmethoden bis 1968?
Es gab einen Gegensatz zwischen der positivistischen Methode (Quellenforschung, Biografie) und der geisteswissenschaftlich-psychologischen Methode (Suche nach metaphysischem Sinn und Gattungsideen).
Welche Rolle spielt die Romantik in der Grimmelshausen-Rezeption?
Die Romantik löste sich von rein normativen Gattungsbegriffen und begann, Literatur stärker im Kontext von Philosophie und der Entwicklung des menschlichen Geistes zu betrachten.
- Arbeit zitieren
- Dr. Wilma Ruth Albrecht (Autor:in), 2011, Literaturwissenschaftliche Interpretationen zur Gattungsproblematik von Grimmelshausen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179206