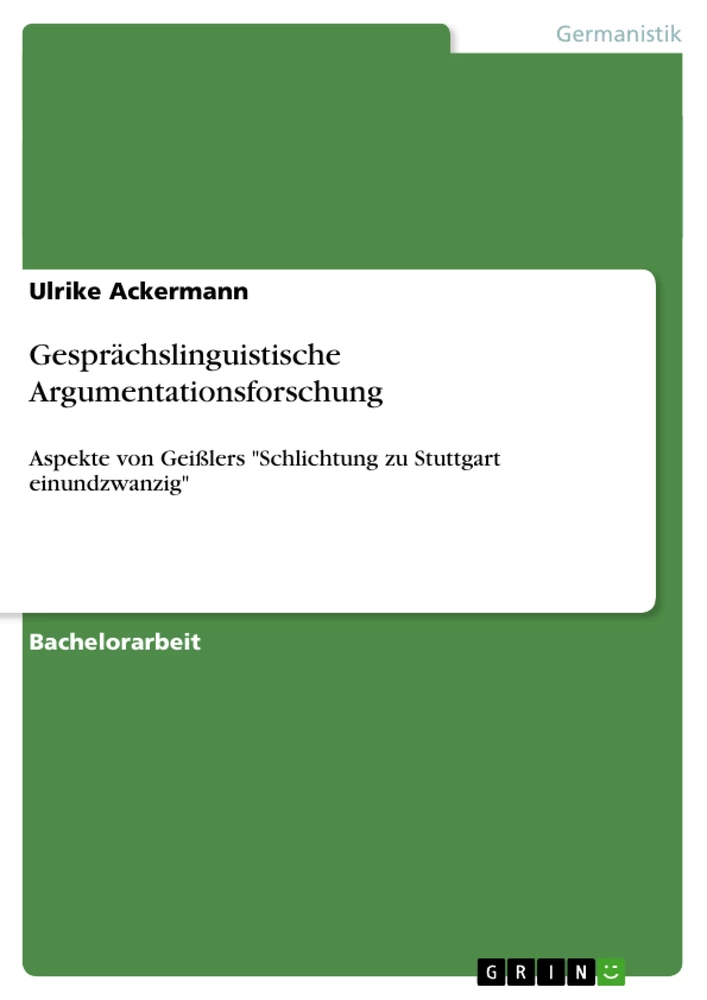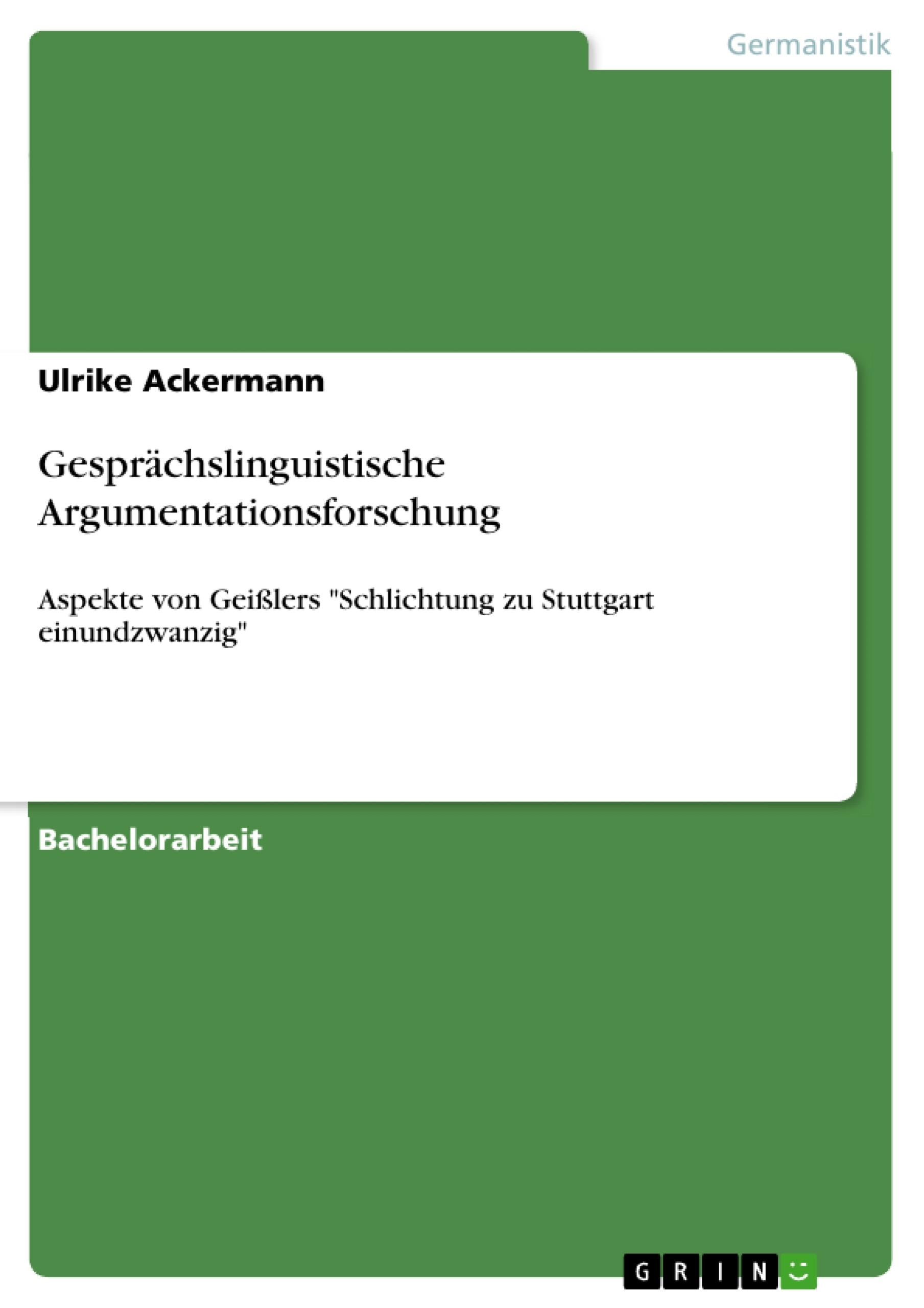Stuttgart 21 ist ein groß angelegtes Bauvorhaben, in dem der gegenwärtige 'überirdische' Stuttgarter Kopfbahnhof in einen 'unterirdischen' Durchgangsbahnhof umgebaut und das Schienennetz in und um Stuttgart herum ausgebaut werden soll. Das Bauprojekt wurde bereits 1988 zur Optimierung des Verkehrssystems vorgeschlagen. Als am 02.02.2010 die ersten Bauarbeiten am Stuttgarter Hauptbahnhof begannen, trat das Bauvorhaben in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und stieß zunehmend auf Widerstand in der Bevölkerung und der Politik. Am 30.10.2010 eskalierte die Situation und aus dem „Streit um den Stuttgarter Bahnhof“ wurde ein „Kampf um den Bahnhof“ (SWR.de 2010: Der Tag X). Das Scheitern einer friedlichen Lösung um den Konflikt veranlasste die KontrahentInnen, sich in einer öffentlichen Schlichtung mit den Konfliktpunkten auseinanderzusetzen. Diese Maßnahme ist in ihrer Art einmalig, da die Öffentlichkeit daran teilhaben und der gesamte Schlichtungsverlauf über einen langen Zeitraum nachvollzogen werden kann. Mit der Aufgabe des Schlichters wird Dr. Heiner Geißler betraut. Ihm obliegt hier einerseits die Aufgabe eine dritte Perspektive auf den Sachverhalt zu eröffnen und die verhärteten Fronten zurück in einen konstruktiven Diskurs zu führen und andererseits die Bevölkerung über die Sachverhalte zu informieren. Die vorliegende explorative induktive Analyse beruht auf einer Dauer von insgesamt 19:49 Stunden. Aus diesem Zeitraum werden exemplarisch rhetorische Phänomene anhand von Transkripten beschrieben. Grundlage ist die These, dass Geißler während der Schlichtung auf unterschiedlichen Ebenen argumentieren muss, um die DiskutantInnen innerhalb der Schlichtung in einen konstruktiven Diskurs zu lenken. Dabei steht die Frage nach seinen rhetorischen Verfahren und deren Realisierung im Fokus der Analyse, ebenso wie ihre Wirkung und Effizienz. Die erste Ebene bezieht sich auf die Rhetorik der Moderationsaktivität. Diesem Punkt folgt die Analyse der konversationellen Beziehungsarbeit, die Geißler innerhalb der Schlichtung leisten muss, um die Basis für einen konstruktiven Diskurs zu schaffen. Während sich die dritte Ebene auf explizite rhetorische Strategien zur inhaltlichen Konsensbahnung bezieht, welche Geißler selbst anwendet. Durch das deskriptive Vorgehen kann im Rahmen dieser Arbeit nachvollzogen werden, wie Geißler die Dissensverhandlung schlichtet, welchen Herausforderungen er sich stellt und wie er selbst Dissens verhandelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Die Schlichtung
- 2 Argumentationsanalyse: Logik und Pragmatik
- 3 Beschreibung des Konflikts
- 4 Rhetorik der Moderationsaktivität
- 4.1 Verbale Selbstdarstellung
- 4.1.1 Explizite Selbstaussagen
- 4.1.2 Implizite Selbstaussagen
- 4.2 Selbststilisierung
- 4.2.1 Der etwas Unbeholfene
- 4.2.2 Der Anwalt der RezipientInnen
- 4.2.3 Die humorvoll entspannte Autorität
- 4.1 Verbale Selbstdarstellung
- 5 Konversationelle Beziehungsarbeit
- 5.1 Konversationelle Beziehungsarbeit zu den RezipientInnen
- 5.1.1 Rhetorische Verfahren der Mehrfachadressiertheit
- 5.1.2 Rhetorisches Stilmittel der Beziehungsarbeit
- 5.2 Konversationelle Beziehungsarbeit unter den DiskutantInnen
- 5.2.1 Rhetorische Verfahren zur Betonung der kooperativen Orientierung
- 5.2.1.1 Wir-Betonung
- 5.2.1.2 Aufeinander Einschwören
- 5.2.2 Umgang mit argumentativen Gesprächsaktivitäten bei
- 5.2.2.1 Umgang mit gesichtsbedrohenden argumentativen
- 5.2.2.2 Umgang mit blockierenden Gesprächsverfahren
- 5.2.1 Rhetorische Verfahren zur Betonung der kooperativen Orientierung
- 5.1 Konversationelle Beziehungsarbeit zu den RezipientInnen
- 6 Rhetorische Verfahren zur inhaltlichen Konsensfindung
- 6.1 Defensiv rhetorische Verfahren zur inhaltlichen Konsensfindung
- 6.1.1 Moderationszyklus
- 6.1.2 Konklusive Sprechhandlungen
- 6.2 Offensiv rhetorische Verfahren zur inhaltlichen Konsensfindung
- 6.1 Defensiv rhetorische Verfahren zur inhaltlichen Konsensfindung
- 7 Zusammenfassung und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Gesprächsführung und Argumentationsstrategien in Geißlers Schlichtung zum Projekt Stuttgart 21. Ziel ist es, die rhetorischen Mittel und kommunikativen Strategien zu untersuchen, die zur Konsensfindung oder zum Scheitern der Konsensfindung beitragen. Die Analyse konzentriert sich auf die sprachlichen Mechanismen der Moderation und deren Einfluss auf den Verlauf der Debatte.
- Analyse der Argumentationsstrukturen im Konflikt um Stuttgart 21
- Untersuchung der rhetorischen Mittel der Moderation
- Beziehungsarbeit zwischen Moderator und Diskutanten
- Konversationelle Strategien zur Konsensfindung
- Wirkung der sprachlichen Gestaltung auf den Konfliktverlauf
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Schlichtung: Die Einleitung beschreibt den Konflikt um Stuttgart 21, ein umstrittenes Bauprojekt, das zu massiven öffentlichen Protesten führte. Sie skizziert die beteiligten Akteure (Politik, Deutsche Bahn, Bevölkerung), die unterschiedlichen Positionen und die Eskalation des Konflikts, die schließlich zur öffentlichen Schlichtung führte. Die Einzigartigkeit dieser Schlichtung liegt in ihrer öffentlichen Ausstrahlung und ihrer Länge. Die Einleitung legt den Fokus auf den Kontext des Projekts und erklärt die Notwendigkeit einer detaillierten Analyse der Kommunikation innerhalb der Schlichtungsgespräche. Der Bezug auf die Eskalation am 30.10.2010 unterstreicht die Brisanz der Situation und die Bedeutung einer erfolgreichen Konfliktlösung.
2 Argumentationsanalyse: Logik und Pragmatik: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text keine weiteren Informationen dazu enthält)
3 Beschreibung des Konflikts: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text keine weiteren Informationen dazu enthält)
4 Rhetorik der Moderationsaktivität: Dieses Kapitel untersucht die rhetorischen Strategien des Moderators. Es analysiert seine verbale Selbstdarstellung (explizite und implizite Selbstaussagen) und die Selbststilisierung, die er durch verschiedene sprachliche Mittel wie Humor oder die Rolle des Anwals der Rezipienten schafft. Die Analyse zeigt auf, wie der Moderator durch seine rhetorischen Fähigkeiten das Gespräch lenkt und beeinflusst und wie seine Selbstdarstellung die Interaktion mit den Konfliktparteien prägt. Es wird beispielsweise untersucht wie der Moderator mit unterschiedlichen Rollen und Präsentationen agiert, um den Verlauf der Debatte effektiv zu gestalten. Die verschiedenen Facetten seiner Kommunikation werden im Detail beleuchtet, um das Gesamtbild seiner Rolle als Mediator darzustellen.
5 Konversationelle Beziehungsarbeit: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Beziehungsarbeit des Moderators, sowohl zu den Rezipienten als auch zu den Diskutanten. Es werden die rhetorischen Verfahren der Mehrfachadressiertheit und die sprachlichen Stilmittel untersucht, die zur Herstellung und Pflege von Beziehungen verwendet werden. Ein wichtiger Aspekt ist der Umgang des Moderators mit argumentativen Gesprächsaktivitäten, insbesondere mit gesichtsbedrohenden und blockierenden Verfahren. Durch die Analyse der "Wir-Betonung" und des "Aufeinander Einschwörens" wird der Fokus auf die kooperative Orientierung des Moderators gelegt, die er durch seinen sprachlichen Stil zu fördern versucht. Es werden die verschiedenen Strategien und Techniken zur Schaffung eines positiven und kooperativen Gesprächsklimas untersucht, und deren Einfluss auf den Konfliktverlauf wird analysiert.
6 Rhetorische Verfahren zur inhaltlichen Konsensfindung: In diesem Kapitel werden die rhetorischen Mittel analysiert, die der Moderator zur Erreichung eines inhaltlichen Konsenses einsetzt. Untersucht werden sowohl defensive als auch offensive Verfahren. Der Moderationszyklus und konklusive Sprechhandlungen als defensive Mittel dienen dazu, den Dialog aufrecht zu erhalten und die Konfliktparteien an einen Konsens heranzuführen. Offensivere Strategien zielen darauf ab, die Parteien zu konkreten Lösungen zu bewegen und den Diskussionsprozess aktiv zu gestalten. Hierbei wird der Fokus auf die sprachlichen und kommunikativen Strategien gelegt, die zur Überwindung von Differenzen und zur Herbeiführung einer gemeinsamen Position beitragen. Die Analyse beleuchtet die Wirksamkeit der verschiedenen Ansätze und deren Einfluss auf die Konfliktlösung.
Schlüsselwörter
Gesprächslinguistik, Argumentationsforschung, Stuttgart 21, Schlichtung, Rhetorik, Moderation, Konversationelle Beziehungsarbeit, Konsensfindung, Konfliktlösung, Sprachliche Strategien, Verbale Selbstdarstellung, Mehrfachadressiertheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Schlichtung Stuttgart 21
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert die Gesprächsführung und Argumentationsstrategien in der öffentlichen Schlichtung zum Projekt Stuttgart 21. Der Fokus liegt auf den rhetorischen Mitteln und kommunikativen Strategien des Moderators und deren Einfluss auf die Konsensfindung.
Welche Aspekte der Schlichtung werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Argumentationsstrukturen im Konflikt, die rhetorischen Mittel der Moderation, die Beziehungsarbeit zwischen Moderator und Diskutanten, konversationelle Strategien zur Konsensfindung und die Wirkung der sprachlichen Gestaltung auf den Konfliktverlauf.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in diesen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 beschreibt den Konflikt Stuttgart 21 und die Schlichtung. Kapitel 2 (zusammenfassende Informationen fehlen im vorliegenden Text) behandelt die Argumentationsanalyse. Kapitel 3 (ebenfalls ohne Zusammenfassung) beschreibt den Konflikt. Kapitel 4 untersucht die Rhetorik der Moderationsaktivität, inklusive verbaler Selbstdarstellung und Selbststilisierung des Moderators. Kapitel 5 konzentriert sich auf die konversationelle Beziehungsarbeit des Moderators zu Rezipienten und Diskutanten. Kapitel 6 analysiert rhetorische Verfahren zur inhaltlichen Konsensfindung (defensive und offensive Strategien). Kapitel 7 bietet eine Zusammenfassung und ein Resümee.
Welche Rolle spielt die Rhetorik des Moderators?
Die Analyse untersucht detailliert die rhetorischen Strategien des Moderators, wie seine verbale Selbstdarstellung (explizit und implizit), seine Selbststilisierung (z.B. als "Anwalt der Rezipienten") und seinen Umgang mit argumentativen Gesprächsaktivitäten. Es wird gezeigt, wie er durch sprachliche Mittel das Gespräch lenkt und beeinflusst.
Wie wird die Beziehungsarbeit des Moderators analysiert?
Die Analyse betrachtet die Beziehungsarbeit des Moderators sowohl zu den Rezipienten (Publikum) als auch zu den Diskutanten. Es werden rhetorische Verfahren der Mehrfachadressiertheit und sprachliche Stilmittel untersucht, die zur Herstellung und Pflege von Beziehungen dienen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Umgang mit gesichtsbedrohenden und blockierenden Gesprächsverfahren und der Förderung einer kooperativen Orientierung.
Welche rhetorischen Verfahren zur Konsensfindung werden betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen defensiven und offensiven rhetorischen Verfahren zur Konsensfindung. Defensiv werden der Moderationszyklus und konklusive Sprechhandlungen genannt. Offensivere Strategien zielen auf die aktive Gestaltung des Diskussionsprozesses und die Herbeiführung konkreter Lösungen ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesprächslinguistik, Argumentationsforschung, Stuttgart 21, Schlichtung, Rhetorik, Moderation, Konversationelle Beziehungsarbeit, Konsensfindung, Konfliktlösung, Sprachliche Strategien, Verbale Selbstdarstellung, Mehrfachadressiertheit.
Für wen ist diese Analyse relevant?
Diese Analyse ist für Wissenschaftler*innen im Bereich der Gesprächslinguistik, Argumentationsforschung und Kommunikationswissenschaft relevant. Sie bietet Einblicke in die komplexen kommunikativen Prozesse bei der Konfliktlösung und kann für die Ausbildung von Mediator*innen und in der Konfliktforschung genutzt werden.
- Quote paper
- Ulrike Ackermann (Author), 2011, Gesprächslinguistische Argumentationsforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179229