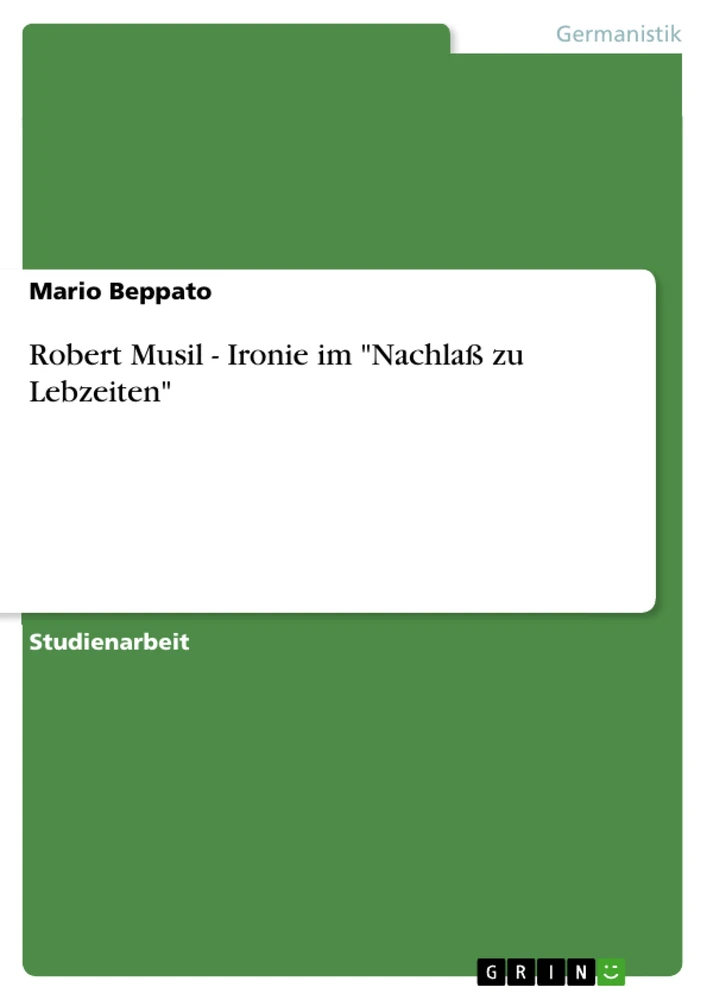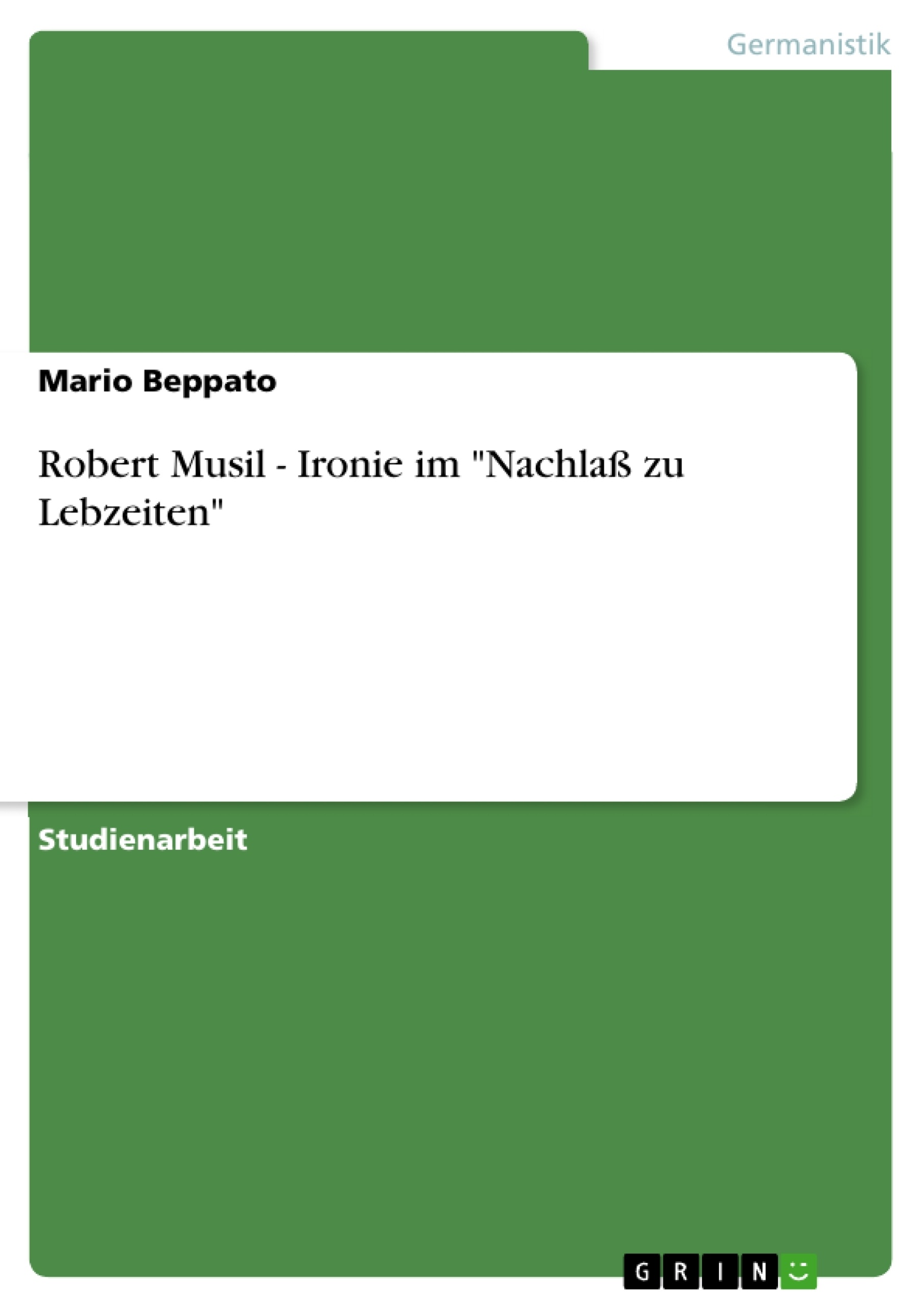In den Texten, die in dieser Hausarbeit vertieft worden sind, kommt immer dasselbe Thema vor, das für Musil als Hauptziel seiner späteren Werke gilt: die Notwendigkeit, unsere Welt mit einem anderen, neuen, zu entwickelnden Blick zu beobachten. Aus diesem Grund kann das musilsche Erzählen als ein "kaleidoskopisches Erzählen" definiert werden: Wie ein Kaleidoskop, in dem ein aus mehreren Teilen bestehendes Bild durch Schütteln ganz anders zusammengesetzt wird, unterzieht sich unsere Umgebung – und jeder vom Autor betrachtete Vorfall – einer Vielfalt von Andeutungen und Interpretationen, und dabei ist jede Perspektive nur Ausdruck einer vorläufigen und subjektiven Sinneswahrnehmung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung ins Thema
- Biographische Aspekte
- Was ist der Nachlaß zu Lebzeiten?
- Eine Gliederung des Werkes
- 2. Biographische Aspekte
- 3. Was ist der „Nachlaß zu Lebzeiten\"?
- 3.1. Eine Gliederung des Werkes
- 3.2. Eine ironische Gesellschaftskritik
- 3.3. Das Fliegenpapier
- 3.4. Schafe, anders gesehen
- 3.5. Kann ein Pferd lachen?
- 3.6. Die Amsel: eine Novelle
- 4. Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit Robert Musil, einem österreichischen Schriftsteller und Analytiker der Menschenwelt. Der Fokus liegt auf der Analyse der (zweiten) Phase seines Lebens, in der er sich intensiv mit zwischenmenschlichen, äußerlichen Verhältnissen auseinandersetzte. Die Arbeit untersucht die Entwicklung von Musils Ironie-Begriff und deren Verwendung in seinem Werk „Nachlaß zu Lebzeiten“ als Kritik an der Moderne.
- Die Entwicklung von Musils Ironie-Begriff
- Der Riss zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit in der modernen Welt
- Die Kritik an der Kulturindustrie und der Unaktualität des echten Schriftstellers
- Der Übergang von der Makrologie zur Mikrologie in Musils Werk
- Die Bedeutung von biographischen Ereignissen für Musils Schaffen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die biographischen Aspekte sowie die Struktur des Werks "Nachlaß zu Lebzeiten" vor. In Kapitel 3 werden die verschiedenen Teile des Werkes vorgestellt und es wird gezeigt, wie Musil seine Ironie einsetzt, um die Moderne zu kritisieren. Kapitel 3.3 analysiert das Fliegenpapier als Metapher für die Oberflächlichkeit der modernen Welt. Kapitel 3.4 beschäftigt sich mit der Frage, wie Musil Schafe und die menschliche Gesellschaft in Beziehung setzt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe, die diese Arbeit beleuchten, sind: Robert Musil, Ironie, "Nachlaß zu Lebzeiten", Moderne, Kulturindustrie, Unaktualität, Makrologie, Mikrologie, biographische Aspekte.
- Quote paper
- Mario Beppato (Author), 2004, Robert Musil - Ironie im "Nachlaß zu Lebzeiten", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179311