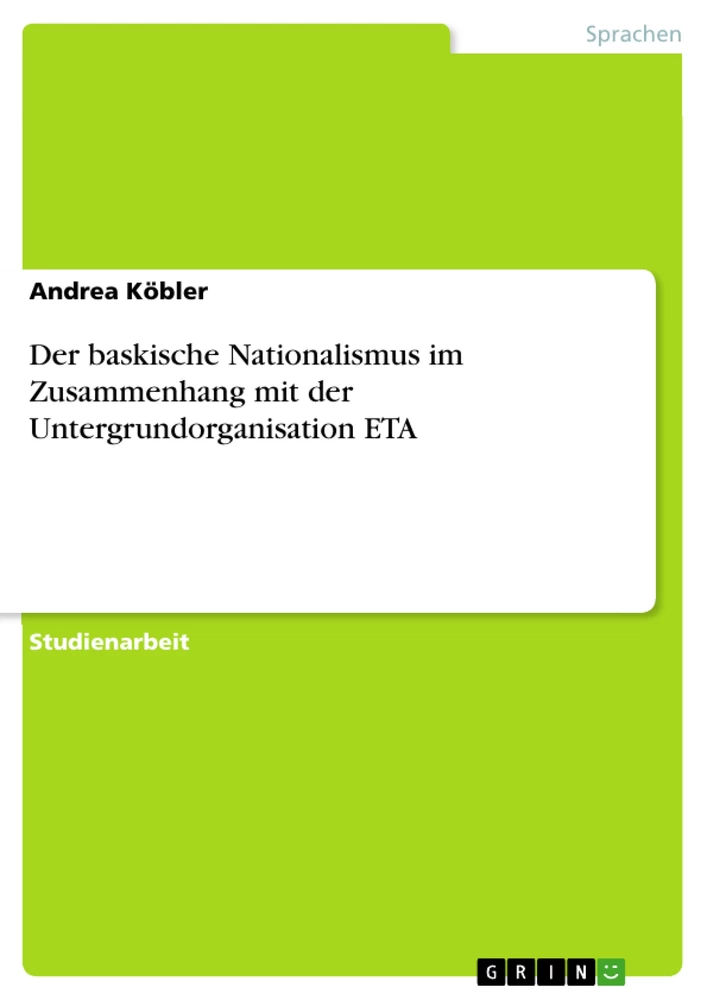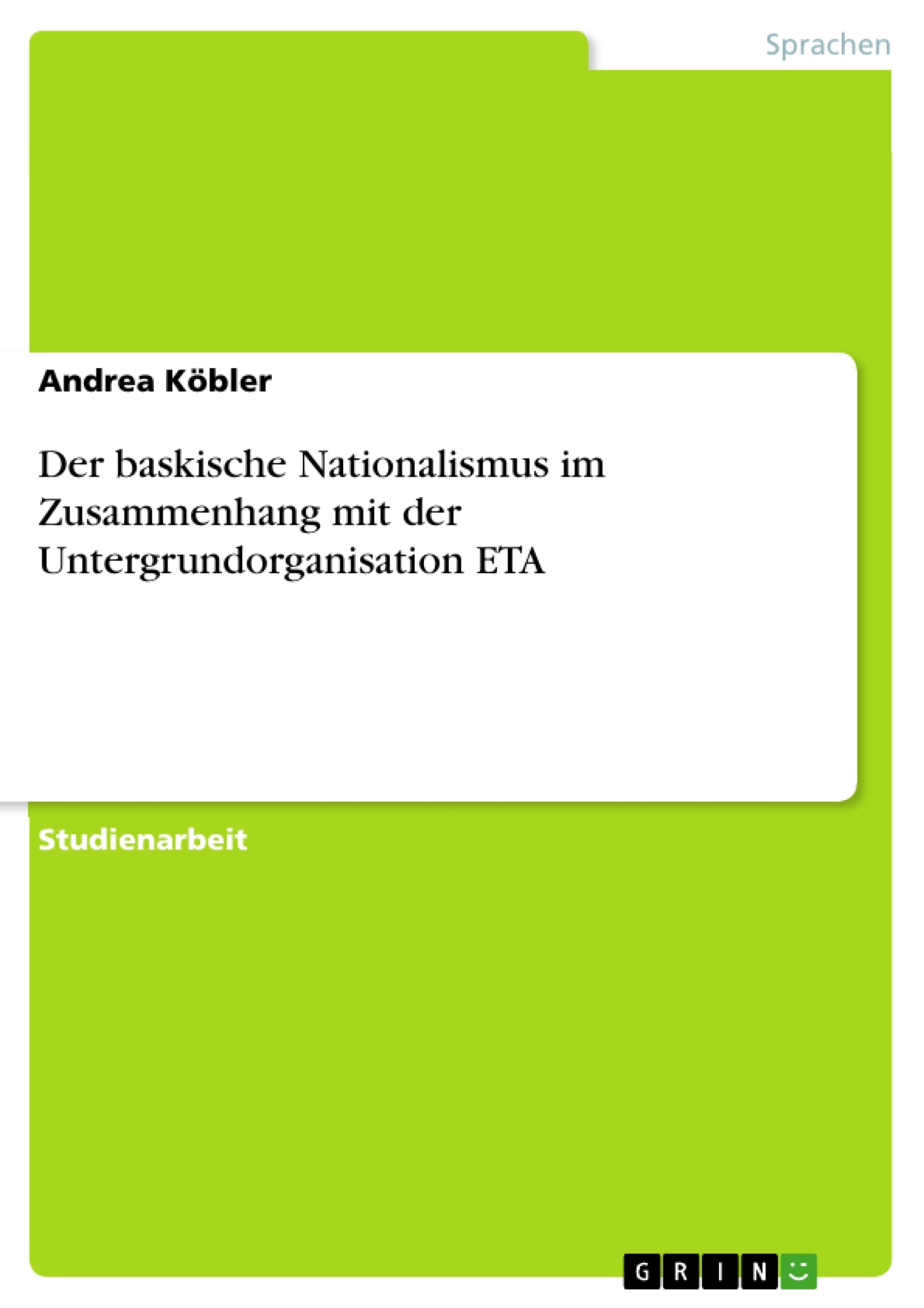Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass das Baskenland schon immer eine Sonderstellung in Spanien hatte. Das Rechtsystem, das heute als Fuero bekannt ist, hatte die Versammlungen von Nachbarschaften als Grundlage, die sich in den "Juntas Generales" (Generalversammlung) als oberstes Regierungsorgan jedes Territoriums vertreten ließen. In Bizkaia fanden diese Versammlungen in der "Casa de Juntas de Guernica" statt. Dieses Gebäude befindet sich neben einer tausendjährigen Eiche, die seit dem 15. Jahrhundert Symbol der Freiheiten des Baskenlandes ist. Die drei Territorien der Baskischen Autonomen Gemeinschaft (Bizkaia, Gipuzkoa und Alava), die im Laufe des 8. Jahrhunderts unter diesen Namen in die Geschichte ein gingen, wurden ab dem Jahr 1200 in die Krone Kastiliens integriert, behielten dabei aber ihre traditionellen Institutionen. Die Basken besaßen Steuerfreiheiten gegenüber der Krone, konnten den Kriegsdienst im eigenen Territorium ausführen und ihre internen Organisationsfreiheiten wurden anerkannt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts verlor das baskische Volk, teilweise durch Abschaffung und unvollständige Wiederherstellung, die Eigenheiten, die es geprägt hatten. Erst die Wiederherstellung der Demokratie in Spanien war Anlass zum Autonomiestatut von Guernica. Dieses Autonomiestatut wurde durch Volksabstimmung in einem Referendum 1979 erlassen. Das baskische Volk gründete sich damit als Ausdruck seiner Nationalität und als Mittel zur Erlangung der Selbständigkeit als Autonome Gemeinschaft. Doch während der Zeit der Unterdrückung des Baskenlandes, vor allem unter Franco, bildeten sich einige Widerstandsgruppen, die die Souveränität des Baskenlandes zu ihrem obersten Ziel erklärten. Die wichtigste und bekannteste Organisation ist bis heute die ETA, die 1959 gegründet wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Die besondere Situation des Baskenlandes
- Die Entstehungsgeschichte der ETA
- Identitätsverlust durch Industrialisierung
- Sabino Arana Goiri
- Die Situation des Baskenlandes unter Franco
- Die Entwicklung der ETA in den Jahren 1959 – 1975
- Organisation und Aufbau
- Die Entwicklung der ETA von ihrer Gründung bis 1975
- Das Ende des Franquismus - Ein Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entstehung der baskischen Terrororganisation ETA im Kontext der politischen und sozialen Entwicklung des Baskenlandes. Sie beleuchtet die besonderen historischen und kulturellen Umstände, die zur Radikalisierung baskischer Nationalisten führten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Identitätsverlusts durch Industrialisierung und die Rolle des Franquismus.
- Die besondere Situation des Baskenlandes und seine historische Entwicklung
- Der Einfluss der Industrialisierung auf die baskische Identität
- Die Rolle Sabino Aranas und seiner Ideologie
- Die Repression während des Franquismus und deren Beitrag zur Entstehung der ETA
- Die Organisation und Entwicklung der ETA
Zusammenfassung der Kapitel
Die besondere Situation des Baskenlandes: Das Baskenland, bestehend aus sieben Herrialdes, verteilt auf Spanien und Frankreich, besitzt eine lange Geschichte der regionalen Eigenständigkeit. Die "Fueros", traditionelle Rechtsvorschriften, gewährten den Basken Steuerfreiheiten, besondere Militärrechte und Autonomie. Die Integration in die Krone Kastiliens im 13. Jahrhundert bewahrte diese teilweise. Der 19. Jahrhundert brachte jedoch den Verlust vieler dieser Eigenheiten. Die Wiederherstellung der Demokratie in Spanien mündete im Autonomiestatut von Guernica (1979), doch die Unterdrückung unter Franco führte zur Entstehung von Widerstandsgruppen wie der ETA.
Die Entstehungsgeschichte der ETA: Die Entstehung der ETA ist vielschichtig. Die Franco-Diktatur, mit ihrer Unterdrückung baskischer Identität und Sprache, war ein entscheidender Faktor. Der radikale baskische Nationalismus, mit seiner fundamentalen Ablehnung spanischer Einflüsse, wie sie auch in Sabino Aranas Ideologie zum Ausdruck kommt, bildete einen weiteren Nährboden. Der Vergleich mit dem heutigen französischen Rechtsextremismus unterstreicht den Aspekt der Bedrohung einer traditionellen Ordnung durch Immigration und Modernisierung.
Identitätsverlust durch Industrialisierung: Die Industrialisierung im Baskenland, insbesondere in Bilbao, führte zu massiver Immigration aus anderen spanischen Regionen. Der damit verbundene Bevölkerungswachstum brachte negative Folgen wie Umweltverschmutzung, Verarmung kleiner Betriebe und fehlende soziale Infrastruktur mit sich. Die ethnische Vermischung und der rasche Wandel vom Agrar- zum Industrieland führten zu Unsicherheit und Identitätskrisen innerhalb der baskischen Bevölkerung, die ihre traditionellen Lebensweisen bedroht sahen.
Schlüsselwörter
Baskischer Nationalismus, ETA, Franquismus, Industrialisierung, Identitätsverlust, Sabino Arana, Fueros, Autonomie, regionale Sonderrechte, spanischer Zentralismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Die Entstehung der ETA
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Entstehung der baskischen Terrororganisation ETA im Kontext der politischen und sozialen Entwicklung des Baskenlandes. Sie beleuchtet die historischen und kulturellen Umstände, die zur Radikalisierung baskischer Nationalisten führten, mit einem Schwerpunkt auf Identitätsverlust durch Industrialisierung und der Rolle des Franquismus.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die besondere Situation des Baskenlandes, seine historische Entwicklung, den Einfluss der Industrialisierung auf die baskische Identität, die Rolle Sabino Aranas und seiner Ideologie, die Repression während des Franquismus und deren Beitrag zur Entstehung der ETA, sowie die Organisation und Entwicklung der ETA selbst.
Wie wird die besondere Situation des Baskenlandes beschrieben?
Das Baskenland, bestehend aus sieben Herrialdes in Spanien und Frankreich, hatte eine lange Geschichte regionaler Eigenständigkeit mit den "Fueros", traditionellen Rechtsvorschriften, die Steuerfreiheiten, besondere Militärrechte und Autonomie gewährten. Die Integration in die Krone Kastiliens bewahrte diese teilweise, jedoch ging im 19. Jahrhundert ein Verlust vieler Eigenheiten einher. Die Wiederherstellung der Demokratie in Spanien mündete im Autonomiestatut von Guernica (1979), doch die Unterdrückung unter Franco führte zur Entstehung von Widerstandsgruppen wie der ETA.
Welche Rolle spielte die Industrialisierung in der Entstehung der ETA?
Die Industrialisierung im Baskenland, besonders in Bilbao, führte zu massiver Immigration und damit verbundenen Problemen wie Umweltverschmutzung, Verarmung kleiner Betriebe und fehlender sozialer Infrastruktur. Die ethnische Vermischung und der rasche Wandel vom Agrar- zum Industrieland führten zu Unsicherheit und Identitätskrisen innerhalb der baskischen Bevölkerung, die ihre traditionellen Lebensweisen bedroht sahen. Dies trug zum Identitätsverlust bei und schuf einen Nährboden für Radikalisierung.
Welche Rolle spielte Sabino Arana?
Sabino Arana und seine Ideologie sind ein wichtiger Aspekt der Entstehung der ETA. Sein radikaler baskischer Nationalismus mit fundamentaler Ablehnung spanischer Einflüsse bildete einen Nährboden für die spätere Radikalisierung.
Wie wird die Rolle des Franquismus dargestellt?
Die Franco-Diktatur und ihre Unterdrückung baskischer Identität und Sprache waren ein entscheidender Faktor in der Entstehung der ETA. Die Repression unter Franco trug maßgeblich zur Radikalisierung baskischer Nationalisten bei.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Darstellung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Die Kapitel befassen sich mit der besonderen Situation des Baskenlandes, der Entstehungsgeschichte der ETA (inklusive der Rolle der Industrialisierung und Sabino Aranas), und einem Ausblick auf das Ende des Franquismus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Baskischer Nationalismus, ETA, Franquismus, Industrialisierung, Identitätsverlust, Sabino Arana, Fueros, Autonomie, regionale Sonderrechte, spanischer Zentralismus.
- Arbeit zitieren
- Andrea Köbler (Autor:in), 2007, Der baskische Nationalismus im Zusammenhang mit der Untergrundorganisation ETA, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179312