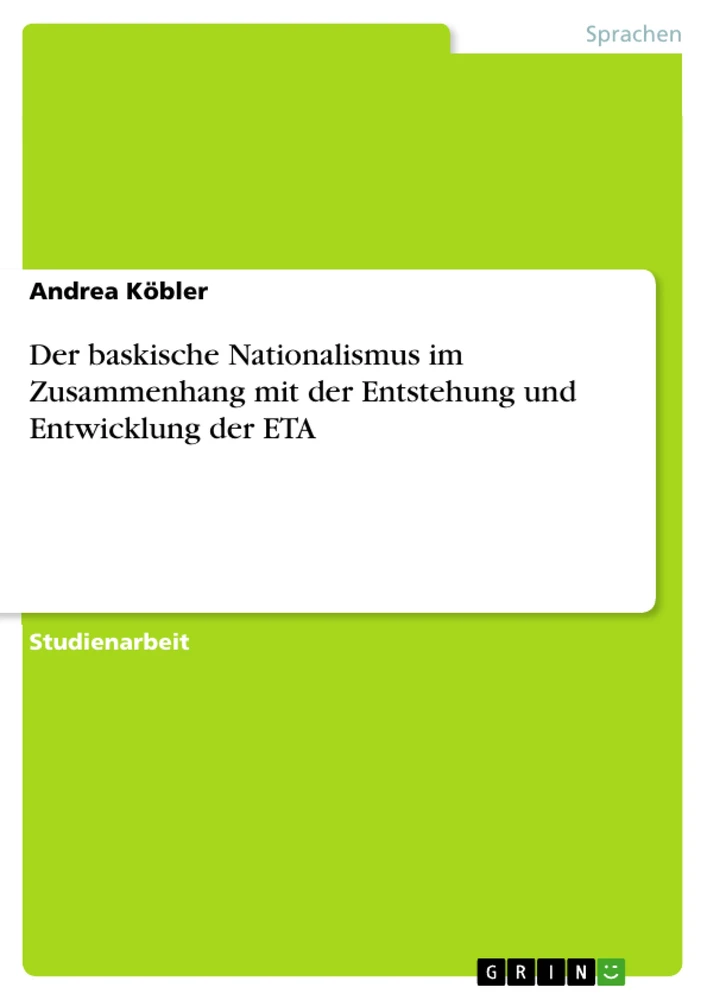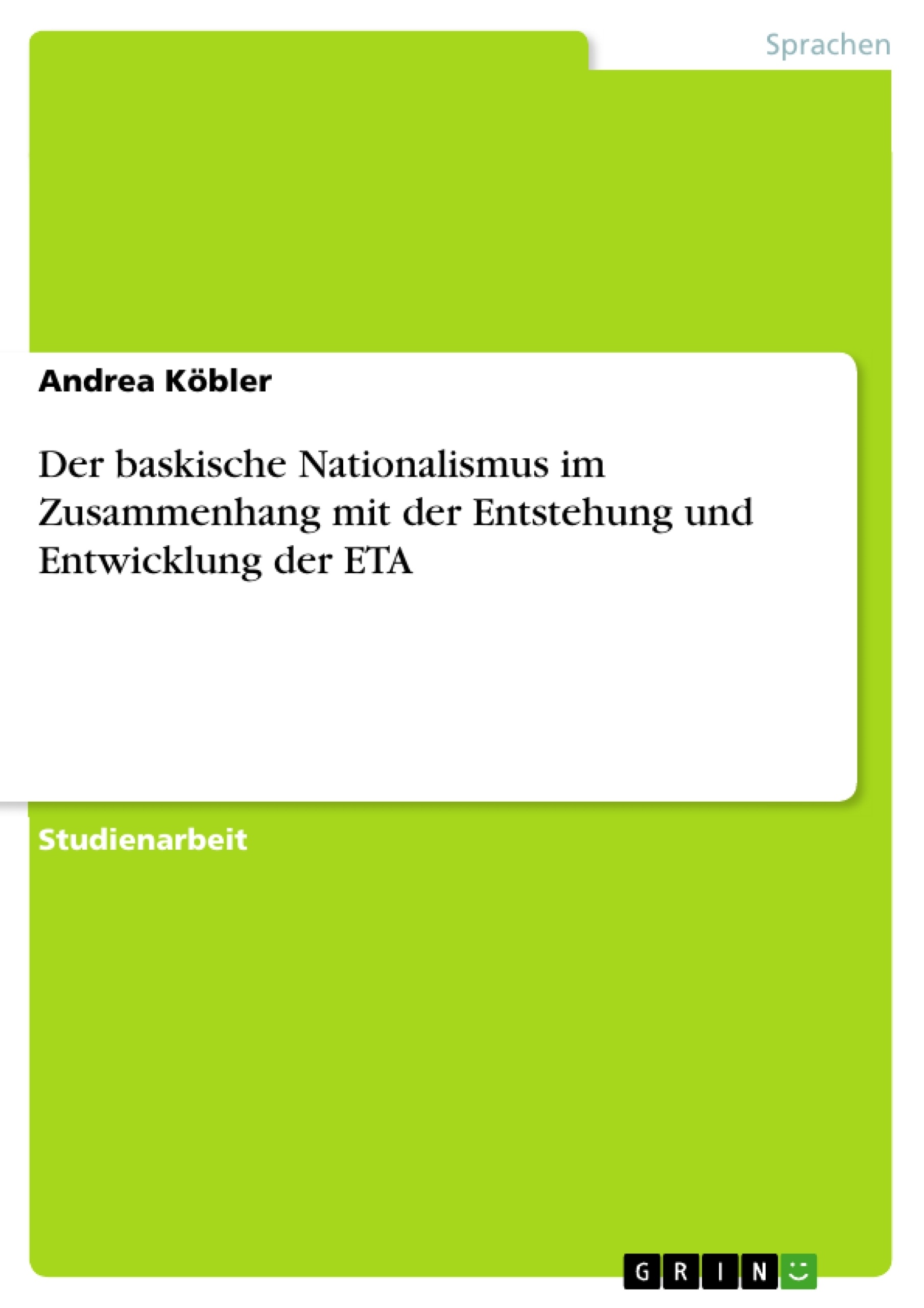[...] Es existiert eine Reihe von Theorien darüber, wie es zu diesem gewaltsamen Auf-begehren kommen konnte. Marxistische Autoren führen die Gründung der ETA auf die „franquistische Wirtschaftspolitik“ zurück und vertreten damit eine ökonomisch-soziologische Theorie. Die PNV (Partido Nacionalista Vasco) ist der Auffassung, die ETA sei aus einem Generationenkonflikt heraus entstanden. Payne vertritt die These, dass politische Differenzen ausschlaggebend für die Gründung der ETA waren. Lang erkennt richtigerweise, dass all diese Erklärungsansätze „eine […] methodische Schwäche“ haben, denn „sie greifen ein Erklärungselement heraus und verabsolutieren es.“ Einen weitaus umfassenderen Ansatz liefert Waldmann, indem er ein analytisches Schema zu den Ursachen des ETA-Terrorismus aufstellt. Er unterteilt drei Ebenen: Die Quellen der allgemeinen Unzufriedenheit, die Lenkung der Unzufriedenheit in Richtung politischen und sozialen Protests und schließlich die Umsetzung des Potentials in organisierte Gewalt. Diese Arbeit soll nicht die aufgestellten Theorien, sondern vielmehr die Ursachen analysieren. Zwar orientiert sie sich an einem Kausalmodell nach dem Vorbild Waldmanns, doch verfolgt sie die Untersuchung nicht auf den genannten Ebenen. Es soll zuerst die Entstehung des baskischen Nationalismus im 19. Jahrhundert betrachtet werden, um anschließend sein Verhalten in der Franco-Ära zu erforschen. Im Zweiten Teil wird eingehend der gesellschaftliche Kontext zu untersuchen sein, der von Industrialisierung und Repression geprägt war. Letztlich wird die Perspektive auf die ETA selbst gerichtet, um herauszufinden, ob innerhalb der Organisation Gründe für die Gewaltanwendung zu finden sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Historischer Abriss des baskischen Nationalismus.
- Die Anfänge des baskischen Nationalismus.
- Die baskische Regierung im Exil...
- Gesellschaftlicher Kontext der Gewalteruption ..
- Wirtschaftlicher und sozialer Wandel....
- Das Problem der Sprache.......
- Baskische Kultur im Franquismus .
- Die Rolle der Kirche
- Franquistische Repressionspolitik
- Die Sondersituation der Provinzen Guipúzcoa und Vizcaya..\li>
- Eigendynamik der Gewalt...
- Entstehung und Entwicklung der ETA .
- Ideologie und Ziele der ETA
- Fazit...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem baskischen Nationalismus und dessen Zusammenhang mit der Entstehung und Entwicklung der Terrororganisation ETA. Sie untersucht die historischen Wurzeln des baskischen Nationalismus, die Rolle der baskischen Sprache und Kultur, sowie die gesellschaftlichen und politischen Faktoren, die zur Gewalteruption führten. Die Arbeit analysiert die Ideologie und Ziele der ETA und beleuchtet die verschiedenen Ebenen, auf denen sich die Unzufriedenheit im Baskenland manifestierte.
- Die historische Entwicklung des baskischen Nationalismus
- Der Einfluss der Sprache und Kultur auf die baskische Identität
- Die Rolle der Franquistischen Repressionspolitik in der Entstehung der ETA
- Die Ideologie und Ziele der ETA
- Der gesellschaftliche Kontext der Gewalteruption
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit stellt den baskischen Nationalismus im Kontext des spanischen Regionalismus und Nationalismus vor. Sie untersucht die Frage, ob das Baskenland als Nation betrachtet werden kann und analysiert die Entstehung der ETA als gewaltbereite Organisation. Historischer Abriss des baskischen Nationalismus: Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge des baskischen Nationalismus, insbesondere die Abschaffung der fueros nach den Karlistenkriegen und die Auswirkungen der Industrialisierung. Es wird auch auf die Rolle der baskischen Sprache und Kultur für die nationale Identität eingegangen. Gesellschaftlicher Kontext der Gewalteruption: Dieses Kapitel untersucht den gesellschaftlichen Kontext, der zur Entstehung der ETA beitrug. Es beleuchtet die Auswirkungen der Industrialisierung, die Rolle der Sprache und Kultur im Franquismus, die Repressionspolitik Francos und die Sondersituation der Provinzen Guipúzcoa und Vizcaya. Eigendynamik der Gewalt: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und Entwicklung der ETA. Es beleuchtet die Ideologie und Ziele der Organisation und untersucht die Ursachen für die Gewaltanwendung.
Schlüsselwörter
Der baskische Nationalismus, ETA, Franquismus, fueros, baskische Sprache, Kultur, Repression, Industrialisierung, Gewalteruption, Ideologie, Ziele.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstand der baskische Nationalismus?
Der baskische Nationalismus entstand im 19. Jahrhundert, verstärkt durch die Abschaffung der Fueros (Sonderrechte) nach den Karlistenkriegen und die sozialen Umbrüche der Industrialisierung.
Was war die ETA und warum wurde sie gegründet?
Die ETA (Euskadi Ta Askatasuna) entstand als Reaktion auf die Unterdrückung der baskischen Identität und Kultur unter dem Franco-Regime sowie aus politischen Differenzen innerhalb der baskischen Nationalbewegung.
Welche Rolle spielte die baskische Sprache (Euskara) für den Nationalismus?
Die Sprache ist ein zentrales Element der baskischen Identität. Ihre Unterdrückung während des Franquismus war ein wesentlicher Quell der Unzufriedenheit und des Protests.
Wie beeinflusste das Franco-Regime die Entstehung der Gewalt?
Die repressive Politik Francos, die Verbote baskischer Symbole und die polizeiliche Gewalt führten zu einer Radikalisierung und zur Umsetzung politischen Protests in organisierte Gewalt.
Was waren die Ideologien und Ziele der ETA?
Die ETA verfolgte nationale Unabhängigkeit für das Baskenland und kombinierte dies oft mit marxistisch-leninistischen revolutionären Ideen.
Welche Provinzen waren besonders von der Repression betroffen?
Besonders in den Provinzen Guipúzcoa und Vizcaya herrschte eine Sondersituation mit starker industrieller Prägung und intensiver staatlicher Repression.
- Quote paper
- Andrea Köbler (Author), 2010, Der baskische Nationalismus im Zusammenhang mit der Entstehung und Entwicklung der ETA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179431