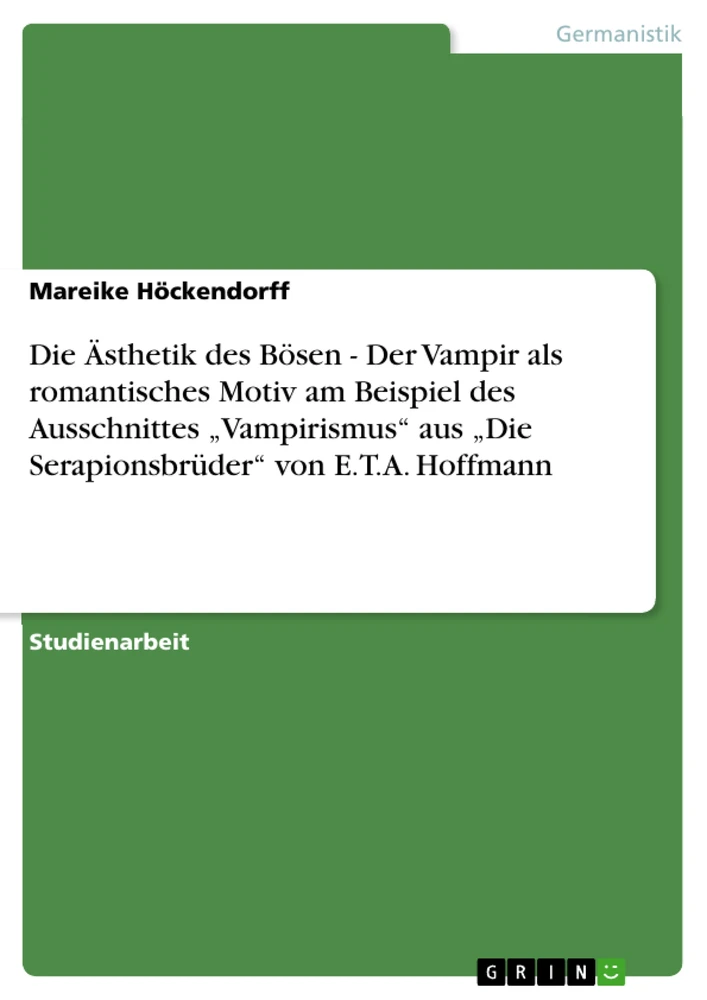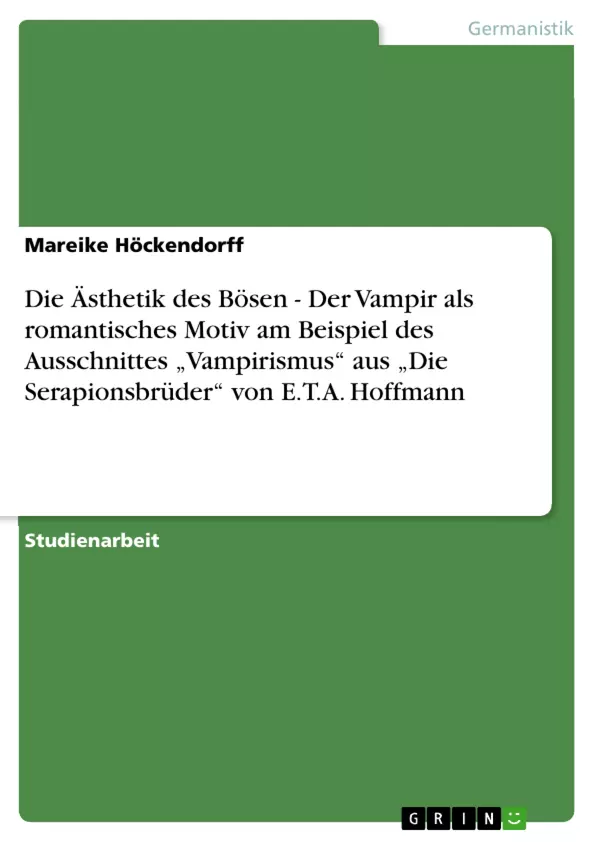Im Gegenstrom zur Aufklärung wendet sich die Romantik dem Dunklen, Heimlichen und Geheimnisvollen zu. Viele Poeten fühlen sich zur Nacht, zum Schlaf und gar zum Tod hingezogen. Dem Forschungsdrang des Idealismus setzen sie Beobachtung und intensives, nicht-bewertendes Erleben ihrer Umwelt entgegen. Doch was zunächst als relativ sanfte Strömung beginnt, wandelt sich später zur Hinwendung zum Schauerlichen und gar Bösen. Das Heimliche wird zum Unheimlichen, das Zauberhafte zur dunklen Magie. In der vorliegenden Arbeit wird die Frage untersucht: Was macht den Reiz bzw. die Ästhetik des Bösen in der Literatur der Romantik aus?
Ich nähere mich der Forschungsfrage auf zwei grundlegend verschiedene Weisen. Zunächst soll der Versuch unternommen werden, ein Bild der damaligen literarischen Strömung in Bezug zu Bürgerlichkeit und Konzeptionen des Anderen bzw. Bösen zu entwerfen. Hierzu werden verschiedene Literaten der Zeit in ihren Reflexionen zum Zeitgeschehen und zur Rolle der Poesie exemplarisch angeführt. Anschließend wird die Position E.T.A. Hoffmanns gesondert untersucht, da er als ein herausragender Vertreter der Schauerromantik gilt. Auf der Folie der Positionen seiner Zeitgenossen soll sein spezifischer Standpunkt erläutert werden.
Im zweiten Teil der Arbeit wird ein konkretes Beispiel von Hoffmanns schauerlicher Literatur analysiert. Hierzu wähle ich einen Abschnitt aus den „Serapionsbrüdern“, was sich besonders anbietet, da dieser Erzählzyklus sowohl einleitende reflexive als auch rein narrative Teile enthält. Aus diesen Gründen und weil neben das Andere des Bürgerlichen hier noch das Andere der Weiblichkeit tritt, konzentriert sich diese Arbeit auf einen Abschnitt des Zyklus, der von Hoffmann nicht betitelt wurde, der im Nachhinein aber als „Eine grässliche Geschichte“, „Vampirismus“ oder „Die Vampirin“ bezeichnet wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung und Kerngedanken der Romantik
- Positionen einzelner Romantiker innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft
- Das Bürgerliche und das Böse bei E.T.A Hoffmann
- Die Serapionsbrüder und der Abschnitt „Vampirismus“
- Konzepte des Philistertums im Abschnitt „Vampirismus“ der „Serapionsbrüder“
- Das Böse im Abschnitt „Vampirismus“
- Der traditionelle Vampirmythos
- Hoffmanns Vampirin
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Ästhetik des Bösen in der Literatur der Romantik und untersucht, wie dieses Motiv in der Schauerromantik von E.T.A. Hoffmann zur Geltung kommt. Hierbei liegt der Fokus auf dem Abschnitt „Vampirismus“ aus den „Serapionsbrüdern“ und der Analyse des Vampirs als romantisches Motiv.
- Die Entwicklung der Romantik als Gegenströmung zur Aufklärung
- Die Konzeption des Bürgerlichen und des Bösen in der Romantik
- Die Darstellung des Vampirs in der Literatur der Romantik
- Die Rolle des Philistertums in der Schauerromantik
- Die Verbindung von Tradition und Innovation im Vampirmythos
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Ästhetik des Bösen in der Romantik ein und skizziert die Forschungsfrage. Dabei wird das Aufkommen des Bürgertums als Kontext für die Konzeption des Anderen und des Bösen im Blick behalten. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung der Romantik und ihre Kerngedanken im Spannungsfeld zu Aufklärung und Bürgerlichkeit. Verschiedene Literaten der Zeit werden exemplarisch vorgestellt, um ihre Positionen und Reflexionen zum Zeitgeschehen zu beleuchten. E.T.A. Hoffmann wird als herausragender Vertreter der Schauerromantik genauer betrachtet und seine spezifische Position innerhalb des Kontextes der Zeitgenossen erläutert. Kapitel 3 widmet sich der Analyse eines konkreten Beispiels von Hoffmanns schauerlicher Literatur. Der Abschnitt „Vampirismus“ aus den „Serapionsbrüdern“ wird untersucht, um die Darstellung des Bösen in Form des Vampirs und dessen Beziehung zu Konzepten des Philistertums und des Anderen zu analysieren. Der traditionelle Vampirmythos wird im Vergleich zu Hoffmanns eigener Interpretation der Vampirin beleuchtet.
Schlüsselwörter
Romantik, E.T.A. Hoffmann, Schauerromantik, Vampir, Ästhetik des Bösen, Philistertum, Bürgerlichkeit, Anderes, traditioneller Vampirmythos, Vampirin.
Häufig gestellte Fragen
Was macht die "Ästhetik des Bösen" in der Romantik aus?
In der Romantik wandelte sich das Zauberhafte zum Dunklen und Schauerlichen. Das Böse faszinierte als Gegenstrom zur rationalen Aufklärung durch das Geheimnisvolle und Unheimliche.
Warum gilt E.T.A. Hoffmann als zentraler Vertreter der Schauerromantik?
Hoffmann verknüpfte das bürgerliche Alltagsleben meisterhaft mit dem Einbruch des Dämonischen und Grauenhaften, was seinen spezifischen literarischen Standpunkt prägte.
Worum geht es im Abschnitt "Vampirismus" in den "Serapionsbrüdern"?
Dieser Teil des Erzählzyklus behandelt eine grässliche Geschichte über eine Vampirin und thematisiert das Eindringen des monströs Weiblichen in die bürgerliche Welt.
Was ist der Unterschied zwischen dem traditionellen Vampirmythos und Hoffmanns Darstellung?
Die Arbeit analysiert, wie Hoffmann traditionelle Mythen aufgreift, sie aber durch psychologische Tiefe und die Konfrontation mit dem Philistertum modernisiert.
Was bedeutet "Philistertum" in diesem Kontext?
Philister bezeichnen engstirnige, rein materiell orientierte Bürger, die für das Wunderbare oder Schauerliche keinen Sinn haben und oft als Kontrastfiguren zum Bösen dienen.
Warum wendet sich die Romantik dem Tod und dem Nachtseitigen zu?
Es war eine Reaktion auf den Forschungsdrang des Idealismus; man suchte die Wahrheit im intensiven, nicht-bewertenden Erleben des Verborgenen und Mystischen.
- Arbeit zitieren
- Mareike Höckendorff (Autor:in), 2011, Die Ästhetik des Bösen - Der Vampir als romantisches Motiv am Beispiel des Ausschnittes „Vampirismus“ aus „Die Serapionsbrüder“ von E.T.A. Hoffmann, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179435