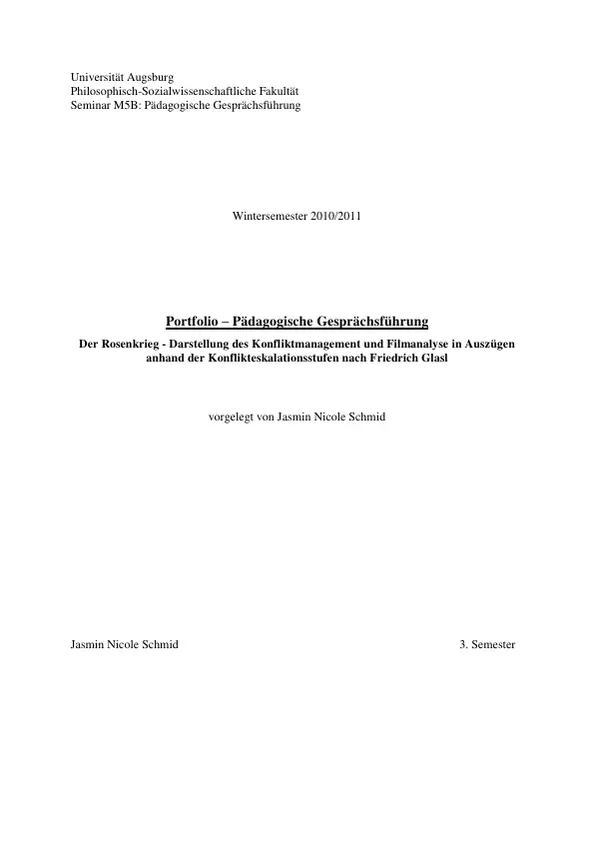Sprache und Gespräche sind allgegenwärtig. Jeder von uns befindet sich mehrmals täglich in Kommunikationsprozessen, sei es in der Straßenbahn, im Büro oder zuhause mit dem Partner. Beginnend bei den strahlenden Mutteraugen lernt der Mensch mit dem ersten Wort „Mama“, dass Sprache etwas sehr wichtiges ist, etwas, das Emotionen hervorruft. Durch empirisch belegte Sprachentwicklung verfolgt die medizinische Fachkraft den sprachlichen Werdegang des Zöglings und stellt Mängel oder Förderungsbedarf fest. So sollten alle Buchstaben bis zum Schuleintritt richtig ausgesprochen und leichte Sätze formuliert werden können. Doch reicht dies allein schon aus?
Der Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun hat sich mit der Vielseitigkeit der menschlichen Kommunikation tiefgehend auseinander gesetzt. Das Kommunikationsquadrat ist das bekannteste und inzwischen auch am weitesten verbreitete Modell von ihm. Bekannt geworden ist dieses Modell auch als „Vier-Ohren-Modell“, welches die vier Ebenen der menschlichen Kommunikation beschreibt. Es ist also nicht nur wichtig, was wir sagen, sondern auch wie wir etwas sagen und der Empfänger unsere Mitteilungen versteht und interpretiert. Bei all den komplexen Theorien und Interpretationsmöglichkeiten des Gegenübers stellte sich mir schon immer die Frage: Wo lernt man, „richtig“ zu kommunizieren? Wie kann man Gespräche tatsächlich bewusst steuern?
Auch mein Kommilitone Alexander Schwalm und ich hielten im Rahmen des Seminars ein dreistündiges Referat. Dabei behandelten wir die neun Eskalationsstufen nach Friedrich Glasl, veranschaulicht anhand von Filmausschnitten. Auf diese und Glasls Definition von Konflikt, sowie zwei Modelle der Konfliktdiagnose wird nun im weiteren Verlauf des Portfolios näher eingegangen. Dabei stellt Glasl Buch Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte und Berater durchgängig meine Hauptliteratur dar. Des Weiteren werden die vorgestellten neun Eskalationsstufen, wie auch im Referat, beispielhaft mit Ausschnitten des Films Der Rosenkrieg (1989) von Danny DeVito illustriert. Zum Schluss erfolgt eine Zusammenfassung, verbunden mit einer weiterführenden Reflexion.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Konfliktmanagement nach F. Glasl
2.1 Sozialer Konflikt
2.2 Konfliktdiagnose
2.2.1 Typologisierung nach Streitgegenst,,nden
2.2.2 Typologisierung nach Erscheinungsformen
2.3 Phasenmodell der Eskalation
3. Filminterpretation
3.1 Stufe eins: Verh,,rtung
3.2.2 Stufe zwei: Verbale Gewalt
3.2.3 Stufe drei: Taten statt Worte!
3.2.4 Stufe vier: Sorge um Image und Koalition
3.2.5 Stufe fünf: Gesichtsverlust
3.2.6 Stufe sechs: Drohstrategien
3.2.7 Stufe sieben: Begrenzte Vernichtungsschl,,ge
3.2.8 Stufe acht: Zersplitterung
3.2.9 Stufe neun: Gemeinsam in den Abgrund
4. Schluss
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Jasmin Nicole Schmid (Author), 2011, Konfliktmanagement nach Friedrich Glasl. Dargestellt am Film "Der Rosenkrieg", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179464