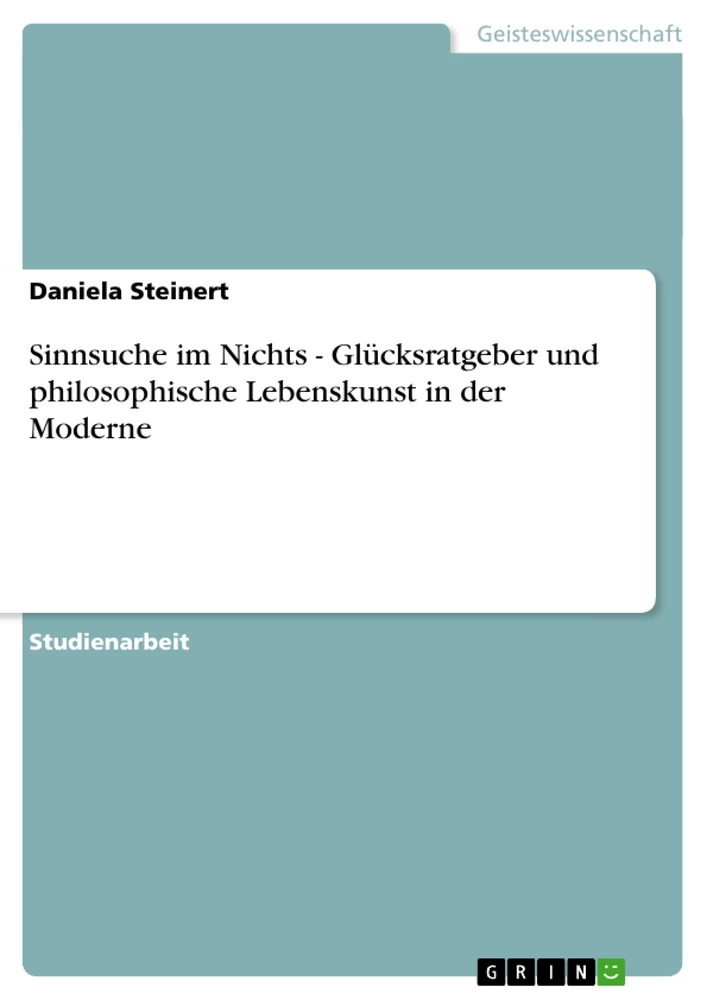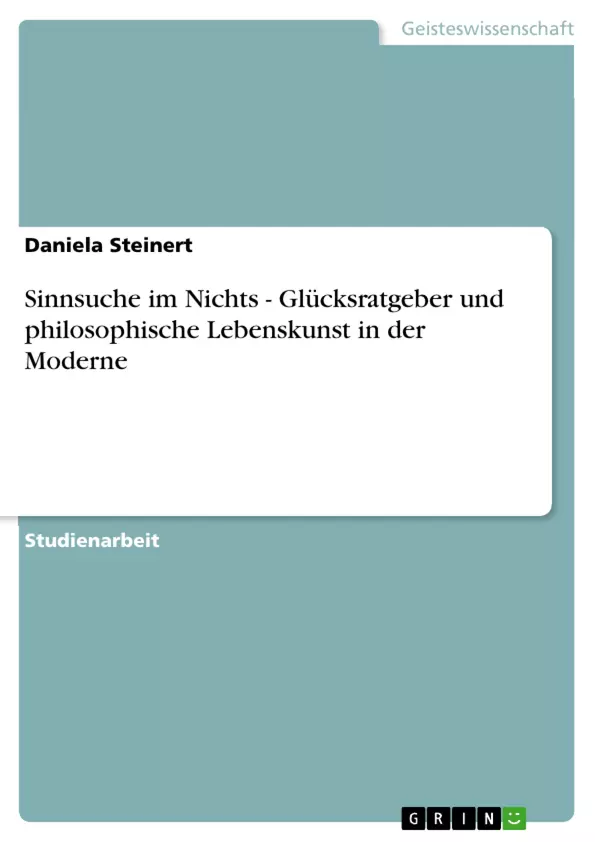„Sei glücklich!“ Ein Imperativ, der sich seiner Unmöglichkeit nicht bewusst zu sein scheint. Denn
Glück ist vermeintlich überall zu kaufen: Es existiert ein unüberschaubares Angebot an Glücks-
Gummibärchen, Glücks-Schokolade, Glücks-Tee, Glücks-Bonbons. Glücklich sein ist demnach
nicht nur Lebensziel und auch nicht so ungreifbar und zufällig wie der Ausdruck „Glück haben“.
Vielmehr handelt es sich um einen jederzeit herstellbaren Zustand – so suggerieren es die
Konsumgüter, die das Glücksversprechen als Label tragen. Doch was, wenn das Glücksbonbon
nicht glücklich macht, sondern lediglich süß schmeckt und den Mund verklebt? Wenn sich der
Symbolgehalt der Verpackung nicht erfüllt, das Bonbon nur „Materie“ bleibt und nicht zu einer
emotionalen Explosion führt, sich weder die Sicht auf das eigene Leben noch die Stimmung
verändert? Möglicherweise wurde das Bonbon nicht mit der richtigen Einstellung gegessen, mit
einer falschen oder einer pessimistischen Grundhaltung. Die Gedanken aber sind in der Moderne
steuerbar. Das Bonbon kann glücklich machen, wenn dies nur gewollt ist. Es sind die kleinen
Dinge, die glücklich machen, weil diese Symbolcharakter haben, der die Umsetzung in Glück
einzig in den Menschen selbst hinein verlegt. So wird ein Bonbon zum Medium für einen
Zustand, der immer da, immer nah und erreichbar ist. Zu dem die Menschen aber hingeleitet
werden müssen. Glück ist immer individuelles Glück und Glück ist immer machbar. Dies
suggerieren nicht nur symbolbehaftete Konsumgüter, sondern auch – so die Ergebnisse einer
Studie Stefanie Duttweilers – die zeitgenössische Lebenshilfeliteratur. Die vorliegende Arbeit
möchte dieses Mantra des erreichbaren glücklichen Lebens betrachten. Dafür setzt sie sich mit der
Studie Duttweilers „Sein Glück machen. Arbeit am Glück als neoliberale Regierungstechnologie“
auseinander und fragt anschließend nach philosophischen Anleitungen zum Glück. Welche
Orientierungen hält die Philosophie der (Post-)Moderne für die Menschen bereit? Diese letzte
Frage stellt sich vor allem deshalb, weil der Lebensbewältigungspsychologie der modernen
Beratung seit dem >>Psychoboom<< (Duttweiler, S. 61) Tür und Tor offen scheint dafür, die
führende Rolle der Anleitung des orientierungslosen modernen Subjekts einzunehmen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Regierung der Gegenwart
2.1 Gouvernementalität im Neoliberalismus
2.2. Das Subjekt der Beratung
3. Stefanie Duttweiler: Arbeit am Glück als neoliberale Regierungstechnologie
3.1 Duttweilers Analyse anhand der Problematisierungsformel „Glück“
3.2 Die Ergebnisse der Studie Duttweilers
3.2.1 Konstellationen des Glücks in Ratgebern
3.2.3 Techniken des Glücks in Ratgebern
3.2.4 Glück als neoliberale Regierungstechnologie
4. Philosophie und Lebenskunst: Philosophische Anleitungen in der Moderne?
4.1 Die Debatte um Lebenskunst
4.2 Lebenskunst in der Moderne - Paradoxe Selbstermächtigung?
5. Fazit
1. Einleitung
„Sei glücklich!“ Ein Imperativ, der sich seiner Unmöglichkeit nicht bewusst zu sein scheint. Denn Glück ist vermeintlich überall zu kaufen: Es existiert ein unüberschaubares Angebot an Glücks- Gummibärchen, Glücks-Schokolade, Glücks-Tee, Glücks-Bonbons. Glücklich sein ist demnach nicht nur Lebensziel und auch nicht so ungreifbar und zufällig wie der Ausdruck „Glück haben“. Vielmehr handelt es sich um einen jederzeit herstellbaren Zustand - so suggerieren es die Konsumgüter, die das Glücksversprechen als Label tragen. Doch was, wenn das Glücksbonbon nicht glücklich macht, sondern lediglich süß schmeckt und den Mund verklebt? Wenn sich der Symbolgehalt der Verpackung nicht erfüllt, das Bonbon nur „Materie“ bleibt und nicht zu einer emotionalen Explosion führt, sich weder die Sicht auf das eigene Leben noch die Stimmung verändert? Möglicherweise wurde das Bonbon nicht mit der richtigen Einstellung gegessen, mit einer falschen oder einer pessimistischen Grundhaltung. Die Gedanken aber sind in der Moderne steuerbar. Das Bonbon kann glücklich machen, wenn dies nur gewollt ist. Es sind die kleinen Dinge, die glücklich machen, weil diese Symbolcharakter haben, der die Umsetzung in Glück einzig in den Menschen selbst hinein verlegt. So wird ein Bonbon zum Medium für einen Zustand, der immer da, immer nah und erreichbar ist. Zu dem die Menschen aber hingeleitet werden müssen. Glück ist immer individuelles Glück und Glück ist immer machbar. Dies suggerieren nicht nur symbolbehaftete Konsumgüter, sondern auch - so die Ergebnisse einer Studie Stefanie Duttweilers - die zeitgenössische Lebenshilfeliteratur. Die vorliegende Arbeit möchte dieses Mantra des erreichbaren glücklichen Lebens betrachten. Dafür setzt sie sich mit der Studie Duttweilers „Sein Glück machen. Arbeit am Glück als neoliberale Regierungstechnologie“ auseinander und fragt anschließend nach philosophischen Anleitungen zum Glück. Welche Orientierungen hält die Philosophie der (Post-)Moderne für die Menschen bereit? Diese letzte Frage stellt sich vor allem deshalb, weil der Lebensbewältigungspsychologie der modernen Beratung seit dem >>Psychoboom<< (Duttweiler, S. 61) Tür und Tor offen scheint dafür, die führende Rolle der Anleitung des orientierungslosen modernen Subjekts einzunehmen. Hat die Philosophie der Antike Normen und Werte debattiert, Lebensentwürfe und Handlungsanweisungen vorgeschlagen, so scheint diese Aufgabe in der Moderne ausgelagert. Managementliteratur, Glücksratgeber, sozio-psychologische Beratung - das Individuum steht mehr als vorher im Zentrum gesellschaftlicher Betrachtung. Die_der Einzelne wird sichtbar gemacht in den eigenen „Daten“ - in den Eigenschaften, Fähigkeiten etc. Was also tut die Philosophie - wie reagiert sie auf die Unsicherheiten der Moderne, was setzt sie der modernen Lebenshilfeliteratur entgegen? Duttweiler spricht die aktuelle wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage um das gelungene Leben nur am Rand an: Zwar arbeiten einige Vertreter_innen der Philosophie an einer „Lebenskunst“, die eigentliche Auseinandersetzung mit individuellem guten Leben finde aber außerhalb wissenschaftlicher Auseinandersetzung statt (vgl.: Duttweiler, S. 11f.). Die vorliegende Arbeit widmet sich zunächst Duttweilers Studie und der modernen Regierungsweise als deren Fundament. Anschließend soll die zeitgenössische Lebenskunst am Beispiel von Wilhelm Schmid und einiger seiner Kritiker stark verkürzt betrachtet werden. Ziel der Arbeit ist es, nicht nur den Umgang mit Glück in der Moderne zu thematisieren, sondern auch die Frage anzusprechen und teilweise zu beantworten, inwieweit wissenschaftliche und außer-wissenschaftliche Ratgeberkultur auf ähnlichen Annahmen fußt. Kann die philosophische Lebenskunst Anleitungen geben, ohne sich zum Wegbereiter des Neoliberalismus zu machen - wie es die Glücksratgeberliteratur tut?
2. Regierung der Gegenwart
Stefanie Duttweiler verbindet in Ihrer Arbeit „Sein Glück machen. Arbeit am Glück als neoliberale Regierungstechnologie“ das Foucaultsche Konzept der Gouvernementalität, den Neoliberalismus und das unternehmerische Selbst der Beratung mit einer eigenen Studie zu Glücksratgebern. Diese Begrifflichkeiten, die als Grundpfeiler und Rahmen der Arbeit Duttweilers dienen, sollen im Folgenden zusammenfassend dargestellt werden. Dabei konzentriert sich der Text auf die Frage, wie in der Moderne regiert wird und in welchen Wechselwirkungen sich Staatsform und Subjektform befinden. Kapitel 2.1 behandelt die Gouvernementalität zu Zeiten des Neoliberalismus, Kapitel 2.2 das Subjekt der modernen Beratung.
2.1 Gouvernementalität im Neoliberalismus
Die folgende Darstellung der Gouvernementalität verzichtet auf die Erläuterung der Entstehung des Begriffs „Gouvernementalität“ und der Foucaultschen Herleitung anhand antiker und christlich-religiöser Führungstechniken, um den Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu überschreiten. Desweiteren ist eine solche Ausführung für die Darstellung der modernen Gouvernementalität im Glücksdiskurs nicht zwingend notwendig.
Der Gouvernementalitätsbegriff nach Michel Foucault bezeichnet das Regieren im modernen Staat und denkt somit zwei Dinge zusammen: Subjektivierung und Staatsformierung (vgl.: Duttweiler, S. 18). Damit stellt er eine Verbindung her zwischen der Regierung von und der (Selbst-)Regierung durch Individuen. Regierung ist demnach nicht nur das Regieren durch einen Souverän, sondern bezeichnet zahlreiche und unterschiedliche Handlungsformen und Praxisfelder, die in vielfältiger Weise auf die Lenkung, Kontrolle und Leitung von Individuen und Kollektiven zielen und gleichermaßen Formen der Selbstführung wie Techniken der Fremdführung umfassen. Durch diese Art der Staatsführung und der Selbstregierung werden die Individuen subjektiviert. In Institutionen, die durch zeitgenössisches Wissen über die Welt und die Menschen entstehen, manifestieren sich Vorgehensweisen und Praktiken, mit denen die Menschen angeleitet werden. So zum Beispiel Schulen, Universitäten oder Ämter wie z.B. die Bundesagentur für Arbeit: Hier wird das jeweilige Wissen über Pädagogik in Bildungseinrichtungen als Führungsform umgesetzt. Das jeweilige Menschenbild schlägt sich z.B. in der Vergabe der Sozialleistungen nieder. Werden Menschen zu „Sozialfällen“ oder „Kunden“, so steckt hinter diesen Bezeichnungen immer ein aktueller politischer und gesellschaftlicher Diskurs, der sowohl von Außen an die Subjekte herangetragen wird als auch das Verhältnis derer zu sich selbst bedingt. Lemke schreibt dazu: „Das charakteristische Merkmal von Regierung besteht darin, dass sie eine Form der Macht etabliert, die Individuen nicht direkt unterwirft oder beherrscht, sondern sie durch die Produktion von „Wahrheit“ anleitet und führt.“
(Lemke 1997, S. 328). Mithilfe der Produktion und der Verbreitung von Wahrheiten, die Menschen auf sich selbst beziehen und anhand derer Politik als Führung von Menschen gemacht wird, werden Menschen in der Moderne angeleitet. Ein rein repressiver Regierungsbegriff ist hierbei nicht mehr haltbar. Dieses Verständnis von Regierung spiegelt auch Foucaults Machtverständnis wieder, das nicht von einem einlinearen Prozess des Machtausübens ausgeht, sondern von einem fließenden, kriegerischen Prozess einer Macht „im Kleinen“, der Mikrophysik der Macht (Foucault 1976, S. 115). Macht wird nicht besessen und ist auch nicht von Reichtum oder Herkunft abhängig (ebd.). Angeleitet durch eine Wahrheit, die in diesem Machtspiel entsteht, richten die Menschen ihr Selbstbild und ihr Handeln nach den mit dieser Wahrheit verbundenen Menschenbildern aus. So wird unter einem spezifischen pädagogischen Verständnis auch ein_e Schüler_in dem durch diese Pädagogik vermittelten Menschenbild folgen und z.B. Arbeitsweise, Lebensstil und Selbstverständnis danach ausrichten. Auch werden die Subjekte sich selbst auf die Ansprüche des Arbeitsmarktes formen. Diese Macht der (Selbst-) Subjektivierung bezeichnet Foucault als „eine zugleich individualisierende und totalisierende Form der Macht“ (Foucault 1982, S. 152.). Damit sagt er, dass die Macht der modernen Regierung den Menschen zwar auf sich selbst zurückwirft, also individualisiert, indem sich das Individuum „frei“ an Möglichkeiten und Wissen orientieren kann, dass die Macht zugleich aber den Menschen in seiner Gesamtheit durchzieht: Sie reicht „ bis in die letzte Faser des Individuums“ (Miller 1995, S. 440), beeinflusst also Körper, Denken, Seele, Lebensausrichtung. Nichts ist jemals schon da, sondern ist immer dahingehend zu betrachten, inwiefern es produziert wird - indem Wahrheiten von außen auferlegt und selbst angenommen werden. Das macht es plausibel, dass Foucault vor allem auch die Wissenschaften als Tragende der moderne Regierung kenntlich macht. Denn diese geben vor, das Subjekt in dessen Natur zu erfassen. Durch das Festschreiben von Wahrheiten über den Menschen erschaffen die Wissenschaften diesen allerdings erst und schreiben ihm eine Natur vor, die Foucault „Quasi-Subjekt“ nennt:
„Wir sind noch sehr weit von einer Hermeneutik des Subjekts entfernt. Es geht vielmehr darum, das Subjekt mit einer Wahrheit auszurüsten, die es nicht bereits kannte und die nicht bereits in ihm vorhanden war. Es geht darum, aus der gelernten, dem Gedächtnis einverleibten und schrittweise in Anwendung gebrachten Wahrheit ein Quasi-Subjekt zu machen, das souverän in uns herrscht.“ (Foucault 2005, S. 434) Das, was später Ulrich Bröckling eine „Realfiktion“ nennt, hat Foucault hier bereits beschrieben:
Das von der Wahrheit konstruierte Subjekt. Der Vorgang von Individualisierung und Totalisierung, Unterwerfung und Selbstunterwerfung wird hier beschrieben als Prozess der Wissensproduktion und der Wissensaneignung: Nicht nur nimmt zum Beispiel der_die Schüler_in ein Menschenbild auf und richtet sich daran aus, sondern vielmehr ist dieses Menschenbild eine Fiktion, etwas von den Wissenschaften produziertes und als Wahrheit deklariertes. Wissenschaft beobachtet und beschreibt nicht nur das Subjekt, sondern produziert es entlang dieser Beobachtung und durch die Erstellung von Theorien. So nähern sich die Schüler_innen, die die eigene Arbeitsweise und das Selbstverständnis an dieser Fiktion ausrichtet, auch in Eigenarbeit an diese Fiktion der Wissenschaften an, die Fiktion wird real. Institutionen also, sowohl Bildungseinrichtungen als auch Verwaltungseinrichtungen geben Wissen weiter, die anfängliche Fiktion institutionalisiert sich, realisiert sich in Strukturen, welche wiederum das Verständnis von Menschen prägt und sie dazu zwingt bzw. anhält, sich an diesem Menschenbild auszurichten. Je nach zeitgenössischem Menschenbild wird zum Beispiel Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Kindergeld vergeben oder nicht vergeben, es werden Menschen danach erzogen, etc. Diese Totalisierung fußt in der Moderne darauf, dass die Bevölkerung verstärkt zum Gegenstand der Beobachtung wird (vgl.: Lemke, S. 162f.; S. 222f.): Gesellschaft wird statistisch beschreibbar, sichtbar. Indem sich der Bevölkerung als Potenzial (der Arbeitskraft, der Streitmacht etc.) gewidmet wird, ihr Verhalten zum Ziel der Kontrolle wird, regiert in der Moderne keine repressive Macht, sondern Wissen, das Gesellschaften in ihrer Gesamtheit im Blick hat und Abweichungen durch Statistiken erfasst, beobachtet und durch Wahrheiten eindämmt. Hier bezieht sich die Totalisierung durch die modernen Regierungsweisen auf den gesamten Gesellschaftskörper.
Des weiteren bedingt diese Art der Kontrolle des Gesellschaftskörpers eine Anpassung der Individuen, die wiederum totalisierend wirkt, weil die Bedingungen von Ausgrenzung in die Individuen selbst eingeschrieben sind und so auf eine radikale Art und Weise unumkehrbar und stark selektierend wirken. Dies wird kurz erläutert: Die Ausgrenzungen der modernen Gesellschaft verlaufen entlang der Grenzen des eigenen Willens: In Zeiten des flexiblen, unternehmerischen Subjekts, das nur durch Leistung, nicht durch Status oder Herkunft bewertet wird, liegt das Leben ganz in der Verantwortung des_der Einzelnen (siehe unten). Dieses Prinzip der modernen Regierungen, das im neuen Kapitalismus das unternehmerische Subjekt als Menschenbild produziert, ist insofern totalisierend, als es Einschließung und Ausschließung ebenfalls in den Menschen hineinverlagern. Die Individualisierung wird zum Zwang. Selbstverantwortung macht Scheitern zu einem unmöglichen Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, das denjenigen, die etwas nicht erreichen, das Recht nimmt, etwas einzufordern. Vielmehr macht Scheitern Menschen auf eine Art und Weise unsichtbar, die ihnen das Recht, als gleichwertig in einer selbstverantwortlichen Welt zu gelten, abspricht. Die Wirkungen der Selbstverantwortung in der modernen Gouvernementalität ist auch wichtiger Bestandteil der Duttweilerschen Analysen und Kennzeichen der neoliberalen Gouvernementalität. Diese besondere Regierung des Neoliberalismus wird nun kurz zusammengefasst:
Das zeitgenössische Verständnis von Glück bettet sich ein in den Kapitalismus und den Neoliberalismus, aus denen das Subjekt - das unternehmerische Selbst, also die_der selbstverantwortliche Unternehmer_in in eigener Sache - hervorgeht. Kapitalismus wird als eine Marktform bezeichnet, die von der sozialen Marktwirtschaft zu trennen ist (vgl.: Boltanski; Chiapello, S. 40) und deren Eigenschaft es ist, dass eine dauerhafte Kapitalakkumulation stattfindet, für die es keinen Sättigungsgrad gibt (vgl: ebd., S. 39). In einer ständigen Wettbewerbssituation muss nicht nur das Produkt, sondern auch das Subjekt ein eigenständiges Profil entwickeln, um einzigartig und somit auf dem Markt begehrt zu sein: Der Mensch macht sich selbst zum Kapital, zum Produkt mit einzigartiger Identität bzw. Persönlichkeit (vgl.: Michalitsch, S. 14). Durch diese Forderung nach Authentizität und Persönlichkeit entsteht also für das Subjekt ein Imperativ zur Eigenvermarktung. Auch wird Selbstverwirklichung gefordert: laut Boltanski und Chiapello entspringt die der Kritik an entfremdeten Arbeits- und Gesellschaftsstrukturen aus der 1968er-Bewegung (vgl: Boltanski; Chiapello, S. 48; S. 64). Durch die Forderung nach authentischer, kreativer Beschäftigung wird Arbeit zur Berufung: Arbeit muss eine Quelle der Begeisterung sein (vgl.: 54). Vom kapitalistischen System übernommen wird dies zu einem Muss: Möchte der_die Arbeitend_e Erfolg haben, muss Arbeit als Berufung ausgeübt werden und somit als Selbstverwirklichung verstanden werden. Dies sind die neuen Wertigkeiten des Kapitalismus (vgl.: ebd., S. 13ff.). Selbstverwirklichung und freiheitliches Leben fungieren als Motivation, sich dem Markt gemäß auszurichten und das eigene Leben in den Dienst eines Berufs zu stellen. Deswegen hebt sich die Trennung von Arbeits- und Privatleben auf und es geht nun darum, den gesamten Menschen an dessen Beruf zu binden und ihm die Möglichkeit zu geben, darin „aufzugehen“. Auf diese Art und Weise eignet sich der neoliberale Kapitalismus die Forderung nach Freiheit und Selbstverwirklichung an und nutzt sie. Die Bildung von Humankapital lässt sich in diesem System nicht vom Prozess der Selbstkonstituierung trennen - durch das Überschneiden von Fremd- und Selbstführung bedingen sie sich. Die Besonderheit des Neoliberalismus ist zudem das Marktparadigma als Kennzeichen, das deutlich macht, dass der Markt zum regulierenden und organisierenden Prinzip wird und der Staat so unter der Kontrolle des Marktes steht (vgl.: Lemke 1997, S.241). Hat der Liberalismus das Menschenbild eines regierten, aber eines durch seine menschliche Natur freien Individuums als Ausgangspunkt, so gründet der Neoliberalismus gemäß Lemke auf einer künstlichen Natur des Menschen (vgl.: ebd.). Damit meint der Autor, dass der Markt im Verständnis des Liberalismus deswegen frei agieren kann, weil freie Individuen aus ihrer Natur heraus rational handeln.
Die Voraussetzung eines rationalen Handelns ist demnach die Freiheit, also das Nicht-Regulieren der Geschehnisse auf dem Markt. Der Neoliberalismus aber führt die Rationalität des Handelns auf unternehmerisches Verhalten zurück. Der Markt soll also frei sein, weil Menschen rational handeln, wenn sie unternehmerisch handeln. Unternehmerisch sein ist hier gleichbedeutend mit „frei“ sein und „natürlich“ sein. Das Unternehmertum wird auf diese Art und Weise naturalisiert und als Norm für rationales und freies Agieren gesetzt. Die beschriebene künstliche Natur des Menschen ermöglicht ein Subjekt, das sich vollständig durch Eigenvermarktung definiert: das unternehmerische Selbst ist eine Realfiktion - ein Quasi-Subjekt (s.o.) -, das vorwiegend von den Wirtschaftswissenschaften implementiert wird (vgl.: Boltanski; Chiapello, S. 48; Michalitsch, S.15). Die Deutungshoheit über das Verständnis vom Subjekt und dessen Natur haben demnach aktuell die Wissenschaften, die den homo oeconomicus und daraus entstehend das unternehmerische Subjekt propagieren.
2.2. Das Subjekt der Beratung
Stefanie Duttweiler betrachtet das Konstrukt des unternehmerischen Subjekts auch in dessen Eigenschaft, ein beratenes zu sein. Damit steht ihre Studie im Kontext der Zeit des „Psychobooms“ - in der der Mensch „alles im Hinblick auf psychologisches Wissen“ interpretieren muss. Die Betrachtung des Menschen - und dessen Selbstbetrachtung - zielen im Neoliberalismus auf den Menschen in seiner Gesamtheit ab, also auch auf das, was vorher als „verborgen“ oder nicht zugänglich galt: die moderne Gouvernementalität ist demnach eine Regierung auch der Psyche. Das Immaterielle scheint in den Vordergrund getreten zu sein Diese neue Weise des Selbstbezugs wird mit einem Anstieg an Beratungs- und Therapienangeboten institutionalisiert (vgl.: Duttweiler, S. 61). Zwar gibt es Beratung bereits seit dem Kaiserreich, doch erfuhr sie im 20. Jahrhundert erheblichen Aufschwung (vgl.: Nußbeck, S. 13): Nachdem 1927 die staatliche Berufsberatung per Gesetz eingeführt wurde, um arbeitsuchende Menschen zu unterstützen, erfuhr Beratung vor allem nach den 68er Jahren einen Wandel hin zu psycho- sozialer Beratung (vgl.: ebd., S. 15). Spezifische Problemlagen und das Individuum treten nun in den Vordergrund, Beratung lehnt sich stärker an psychotherapeutische Verfahren an. In diesem Rahmen weiten sich auch die Felder der beratenden Berufsfelder aus: In den 1960er Jahren etablierten sich Bildungsberatung und Studienberatung als neue Zweige (vgl.: ebd., S. 16), in den 1970er Jahren bilden sich Selbsthilfegruppen. Auf die Gründe für diese Entwicklung und die Entstehungsbedingungen des Psychobooms im allgemeinen, soll hier nur wenig eingegangen werden. Lediglich ist zu erwähnen, dass die Moderne eine Zeit ist, die sich durch Ratlosigkeit der Menschen auszeichnet (vgl.: Duttweiler, S.47). Dies meint unter anderem den Verlust universeller Werte, der Handlungsmöglichkeiten sowie Welt- wie Selbstverhältnisse stark vervielfacht. Denn von einem festen Wissen, von einer Wahrheit, wird nicht mehr in dem gleichen Maß wie vorher ausgegangen (vgl.: ebd., S. 54; 56f.). Des weiteren verliert der Mensch insofern sein Leben aus der Hand, dass die Postmoderne - als Verstärkung der Moderne - extrem beschleunigend wirkt (vgl.: Schmid, S. 101) und grenzenlos werdende Freiheit gleichzeitig begrenzend wirkt (vgl.: ebd., S. 113). Diese (post-)modernen Umstände führen zu dem zeitgenössisch starken Beratungsbedarf. Beratung aber verändert sich in deren Wirkung und Ausrichtung: Boris Traues Genealogie des Beratungswissens diagnostiziert einen Bruch zwischen dem frühen 20. Jahrhundert und den sich seit den 1970er Jahren verbreitenden Beratungspraktiken (vgl.: Traue, S. 262), den die kybernetische Wende mit sich bringt. Diese These wird im Folgenden knapp nachvollzogen. Zunächst wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestimmte Strömungen, auch die kulturkritische Strömung, von der Psychoanalyse ausgegrenzt und von den humanistischen Therapien aufgegriffen. Humanistische Therapien beinhalteten Ansätze, die sich mit „ alternativen Wirklichkeiten“ auseinandersetzten, mit der „Vorstellung der Entfaltung ‚ innerer Potenziale ’ in therapeutischen Gruppen ‚ gegen ’ die Gefahr der Vereinnahmung durch Maschinen, ‚ kulturelle Konserven ’ undökonomisches Denken“ (ebd., S. 263). Das Anrufen der Eigenkräfte des Menschen war also zunächst ein kritisches Element, das sich gegen die Mechanisierung von Menschen in der zunehmenden Industrialisierung und Technisierung und gegen die ökonomische Indienstnahme richtete. Aus diesen humanistischen Therapien heraus etabliert sich nach Traue in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren Beratung als „Element deröffentlichen Daseinsvorsorge“ (ebd.): So werden ab 1975 aufgrund der Psychiatrie-Enquète Beratungs- und Betreuungsangebote für psychisch kranke Menschen außerhalb von Psychiatrie innerhalb der Beratung geschaffen (vgl.: Nußbeck, S. 16). Von Angeboten institutionalisierte sich Beratung aber auch als Pflicht, als Einschränkung für Entscheidungen: Seit 1976 ist vor einem Schwangerschaftsabbruch ein Beratungsgespräch verpflichtend (vgl.: ebd.). Die kybernetische Wende, die einen Bruch in den Human- und Ingenieurwissenschaften herbeiführte, erfolgte aufgrund des Verständnisses der Kybernetik von Leben, Technik und Gesellschaft: Die Kybernetik nimmt an, der „Lebendigkeit von Organismen und ihrer Anpassungsfähigkeit“ liege ein „Prinzip der Selbststeuerung “ zugrunde (ebd., S. 264). Wie beispielsweise das Regulat der Heizung durch Rückkopplung von Informationen über Temperatur eine konstante Wärme erzeugt, so funktionieren auch Gesellschaften nach dem Prinzip der Selbstregulierung. So werden kapitalistische Prinzipien kybernetisch begründet (vgl.: ebd., S. 158) wie zum Beispiel das Prinzip der freien Märkte, die durch Individuen gestaltet werden (vgl.: ebd.). Die Individuen werden über Rückkopplungen gesteuert bzw. steuern sich selbst anhand der Reaktionen auf dem Markt, also anhand der Reaktionen anderer. So herrscht immer gewisse Kontinuität auf dem Markt, weil Ausbrüche in verschiedene Richtungen sind nicht möglich. So schlägt sich Kybernetik in der Beratung nieder als Verständnis von Gesellschaft und Individuum als sich selbst regulierend. Damit einher geht zum Beispiel die Ablehnung zentraler oder hierarchischer Regulierung von Verhalten (vgl.: ebd., S. 265). Denn Regulierung wird über Eigenregulierung initiiert, die über die Einrichtung von „Feedbackschleifen“ (ebd.) möglich wird. Das Wort Feedback, das mittlerweile in den Alltagsgebrauch übergegangen ist, bedeutet Rückmeldung. Diese kann auch in der Beratung in beide Richtungen - sowohl an Beratende_n als auch an Berater_in gehen - so z.B. in der Supervision wie sie Nußbeck beschreibt. Niemand ist von Feedback ausgeschlossen: Auch die beratende Person kann beobachtet werden, erhält im Anschluss ebenfalls eine Beratung durch Rückmeldung zu der geleisteten Arbeit. Feedback wird hier vor allem als Bestätigung wichtig, als emotionale Absicherung und zur Vorbeugung von Burn-outs: „Er [ der Berater; Anmerk. d. Verf. ] kann Bestätigung für seine Bemühungen bekommen, die er trotz hohen Einsatzes vom Klienten oft nicht erhält.“ (Nußbeck, S. 123) Auch können in einer Feedbackrunde Dinge angesprochen werden, die der_mjenigen, die_der Feedback erhält nicht selbst aufgefallen sind, vor allem Gefühle, die hier als verborgen und von außen besser beobachtbar scheinen (vgl.: ebd.). Der Berater, der hier beraten wird, wird damit im jeweiligen Zustand erfasst, unterstützt und durch Anerkennung im eigenen Tun bestätigt. Der Berater, der möglicherweise nach seinem Gespräch mit der Klientel negative Gefühle hätte, negative Selbstbezüge herstellen könnte, entwickelt diese nicht bzw. die Negativität soll abgefangen werden, möglichst ins Positive verkehrt werden. Der feedback-gebenden Person ist es so erlaubt, als „objektive“ Instanz das Selbstbild zu korrigieren. Damit wird Feedback zu einem ausrichtenden Instrument, das Menschen durch Mitteilungen steuert. Boris Traue schreibt über Feedback im Beratungskontext:
Formen der Kontrolle und Messung von Leistungen geben dem Individuum ‚ Feedback ’über das Gelingen oder Scheitern der selbst angestrebten oder von Organisationen eingeforderten Ziele. Die Verallgemeinerung des ‚ Feedbacks ’ als Metapher impliziert, dass eine große Anzahl von Mitteilungen nicht als Kritik, als Lob, als Gemeinheit, als Drohung etc. sondern eben als Feedback, d.h. als Informationüber das eigene Handeln verstanden werden (soll). (Traue, S. 285)
Zunächst auffällig ist, dass Beratung „Beobachtung von Leistung“ ist. Feedback misst diese Leistung. Für Beratung bedeutet dies, dass Rückmeldung wichtiger Bestandteil, Instrument und somit relevant dafür ist, dass die beratenen Personen Leistungs-Ziele erreichen. Der feedback- gebenden, beratenden Person wiederum wird die Legitimation gegeben, Rückmeldung zu geben und somit die Situation zu beurteilen, die beratenen Menschen zu beurteilen. Mit dem Begriff ‚Feedback’ als Metapher wird deutlich, wie stark die Aussagen neutralisiert werden. Feedback ist eine eigene Art von Aussage, eine Form von Information, mit der keine spezifische Wertung verbunden sein soll. Feedback in der Beratung, das über Scheitern und Gelingen der beratenen Person entscheidet, verlegt den Inhalt, die Wertung des Gesagten, in das beratene Individuum. Die Information, die gegeben wird, ist eine über innere Prozesse des Menschen, die nun sichtbar gemacht werden (vgl.: Traue, S. 157). Feedback geht nach Traue mit Selbstreflexion einher (vgl.: ebd.) Das moderne Subjekt der Beratung ist deshalb ein kybernetische Subjekt: es steuert sich anhand von Selbstreflexion und Feedback, das in die Selbststeuerung einfließt. Dieses Subjekt der Beratung, das zugleich das der Kybernetik ist, gründet auf der Selbstbestimmung des Menschen. Hier weist Duttweiler auf das Paradox der Beratung hin: Beratung hat zum Ziel, Menschen zu mehr Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit zu verhelfen (vgl.: Duttweiler 2004, S. 24), setzt aber hierfür zugleich ein Subjekt voraus, das in der Lage ist, sich selbst zu verändern, zu bestimmen. Beratung ist so bereits immer ein widersprüchliches Konstrukt (vgl.: ebd.). „Damit errichtet die Form der Beratung einen >>paradoxen Zwang zur Freiheit<< [ ... ] , indem sie die Ratsuchenden als selbstbestimmt handelnde Subjekte adressiert und auf diese Position verpflichtet.“ (Duttweiler 2007, S. 73) Der Mensch muss also frei sein, um die Beratung wählen zu können, sich ihr zuzuwenden und in ihr verändern zu können. Durch Beratung aber wird das Subjekt kontinuierlich in der Schwebe, also dauerhaft offen gehalten für Veränderung. Es kann sich nicht für weniger Freiheit und Selbstbestimmung entscheiden. Selbstbestimmung fungiert des weiteren als Einsatzpunkt von Beratung: wer sich beraten lässt, sucht Rat, also eine Entlastung der Selbstbestimmtheit (vgl.: ebd.); sie fungiert als Fluchtpunkt der Beratung: so hat das Individuum freie Wahl in der individuellen Lebensentfaltung, darf sich der Wahl und somit der Selbstbestimmung aber nicht verweigern (vgl.: ebd., S. 74). Durch Selbstbestimmung als voraussetzendes sowie strukturierendes Prinzip und zugleich als Ziel wird in der Beratung der Ratlosigkeit der Moderne nicht entgangen (vgl.: ebd., S. 75). Vielmehr verstärkt sich diese, da die Beratung Möglichkeiten vervielfältigt. Traue bezeichnet die moderne Gesellschaft deswegen als „Optionalisierungsgesellschaft“ (Traue, S. 259) Die Beratung ist demnach eine Form der helfenden Kommunikation, die auf die Zukunft und deren Potenziale gerichtet ist und nicht, wie die Psychoanalyse, auf die Vergangenheit. Damit hat die Beratung den Gegenstand der individuellen Optionen: „In der Beratung werden unterschiedliche Handlungsprobleme als Problem der Generierung von Optionen, zwischen denen sich entschieden werden muss, aufgefasst.“ (ebd., S. 284) Die Welt der Individuen wird also vielfältiger durch Kommunikation über Gelegenheiten, Chancen etc.. Hierdurch wird aber die Anforderung an das Individuum wiederum höher und die Bewältigung des Lebens durch selbstverantwortliches Handeln führt zurück zum unternehmerischen Subjekt. Traue unterstützt hiermit die These Duttweilers, Beratung erweise sich durch den Zwang zur kontinuierlicher Neujustierung als passgenau zu der ambivalenten Freiheit im Neoliberalismus (vgl.: Duttweiler, S. 76). In seiner Studie, die auf der Grundlage des Konzepts der Gouvernementalität und der sozialen Technologie im Sinne einer strategischen Bearbeitung des Sozialen fußt (vgl.: Traue, S. 25f.), zeigt die Verbindung von Therapie und Ökonomie:
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text hauptsächlich?
Dieser Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Er befasst sich mit der Analyse von Glück im Kontext des Neoliberalismus und der modernen Beratung, unter Berücksichtigung philosophischer Perspektiven auf Lebenskunst und Selbstermächtigung.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind: Gouvernementalität im Neoliberalismus, das unternehmerische Selbst, die Rolle der Beratung in der modernen Gesellschaft, die Verbindung von Glück und Konsum, die philosophische Auseinandersetzung mit Lebenskunst sowie die Kritische Reflexion aktueller Ratgeberkultur.
Wer ist Stefanie Duttweiler und welche Rolle spielt ihre Arbeit in diesem Text?
Stefanie Duttweiler ist eine Forscherin, deren Studie "Sein Glück machen. Arbeit am Glück als neoliberale Regierungstechnologie" eine zentrale Rolle spielt. Der Text setzt sich intensiv mit ihrer Analyse auseinander, die Glücksratgeber als Werkzeuge neoliberaler Regierungstechnologien untersucht.
Was bedeutet Gouvernementalität im Kontext dieses Textes?
Gouvernementalität bezieht sich auf das Regieren im modernen Staat, wobei Subjektivierung und Staatsformierung zusammen gedacht werden. Es beschreibt, wie Individuen durch unterschiedliche Handlungsformen und Praxisfelder gelenkt, kontrolliert und geleitet werden, und wie diese Formen der Selbstführung und Fremdführung die Individuen subjektivieren.
Was ist das unternehmerische Selbst und wie hängt es mit dem Neoliberalismus zusammen?
Das unternehmerische Selbst ist ein Konzept, das den Einzelnen als Unternehmer in eigener Sache betrachtet. Es ist eng mit dem Neoliberalismus verbunden, da es die Selbstverantwortung und Eigenvermarktung des Individuums betont, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein. Der Mensch macht sich selbst zum Kapital und muss ein einzigartiges Profil entwickeln.
Welche Rolle spielt die Philosophie in der modernen Lebensbewältigung?
Der Text fragt, welche Orientierungen die Philosophie der (Post-)Moderne für die Menschen bereithält und wie sie sich zur modernen Lebenshilfeliteratur verhält. Es wird untersucht, ob die Philosophie Anleitungen zum Glück geben kann, ohne sich zum Wegbereiter des Neoliberalismus zu machen.
Was versteht man unter dem "Psychoboom" und wie beeinflusst er die moderne Beratung?
Der "Psychoboom" bezeichnet eine Zeit, in der Menschen dazu tendieren, alles im Hinblick auf psychologisches Wissen zu interpretieren. Dies führt zu einem Anstieg an Beratungs- und Therapieangeboten, da die moderne Gouvernementalität auch die Psyche des Menschen beeinflusst.
Was ist die kybernetische Wende und welche Auswirkungen hat sie auf die Beratung?
Die kybernetische Wende ist ein Paradigmenwechsel, der das Prinzip der Selbstregulierung in den Vordergrund stellt. Sie beeinflusst die Beratung, indem sie das Individuum und die Gesellschaft als sich selbst regulierend versteht und die Bedeutung von Feedback als Instrument zur Selbststeuerung betont.
Welches Paradoxon wird in Bezug auf die moderne Beratung angesprochen?
Das Paradoxon besteht darin, dass Beratung das Ziel hat, Menschen zu mehr Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit zu verhelfen, aber gleichzeitig ein Subjekt voraussetzt, das bereits in der Lage ist, sich selbst zu verändern und zu bestimmen. Dies führt zu einem "paradoxen Zwang zur Freiheit".
Was ist die "Optionalisierungsgesellschaft" und wie hängt sie mit der Beratung zusammen?
Die "Optionalisierungsgesellschaft" ist ein Begriff, der die moderne Gesellschaft beschreibt, in der es eine Vielzahl von Optionen und Wahlmöglichkeiten gibt. Die Beratung trägt dazu bei, diese Vielfalt zu generieren, erhöht aber gleichzeitig die Anforderungen an das Individuum, selbstverantwortlich zu handeln.
- Arbeit zitieren
- Daniela Steinert (Autor:in), 2011, Sinnsuche im Nichts - Glücksratgeber und philosophische Lebenskunst in der Moderne, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179489