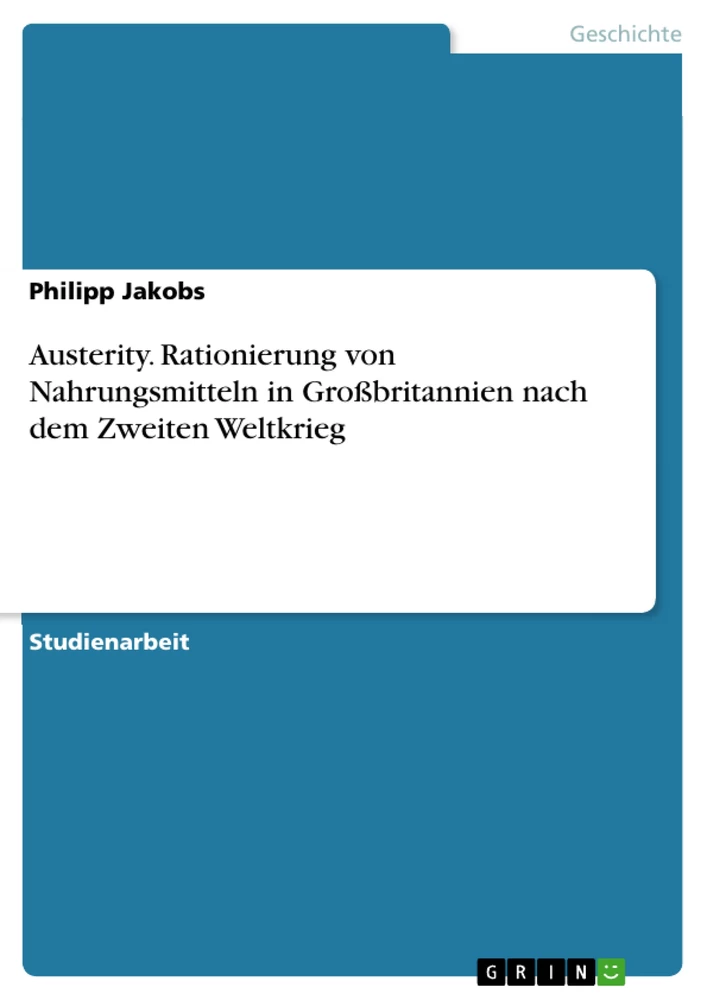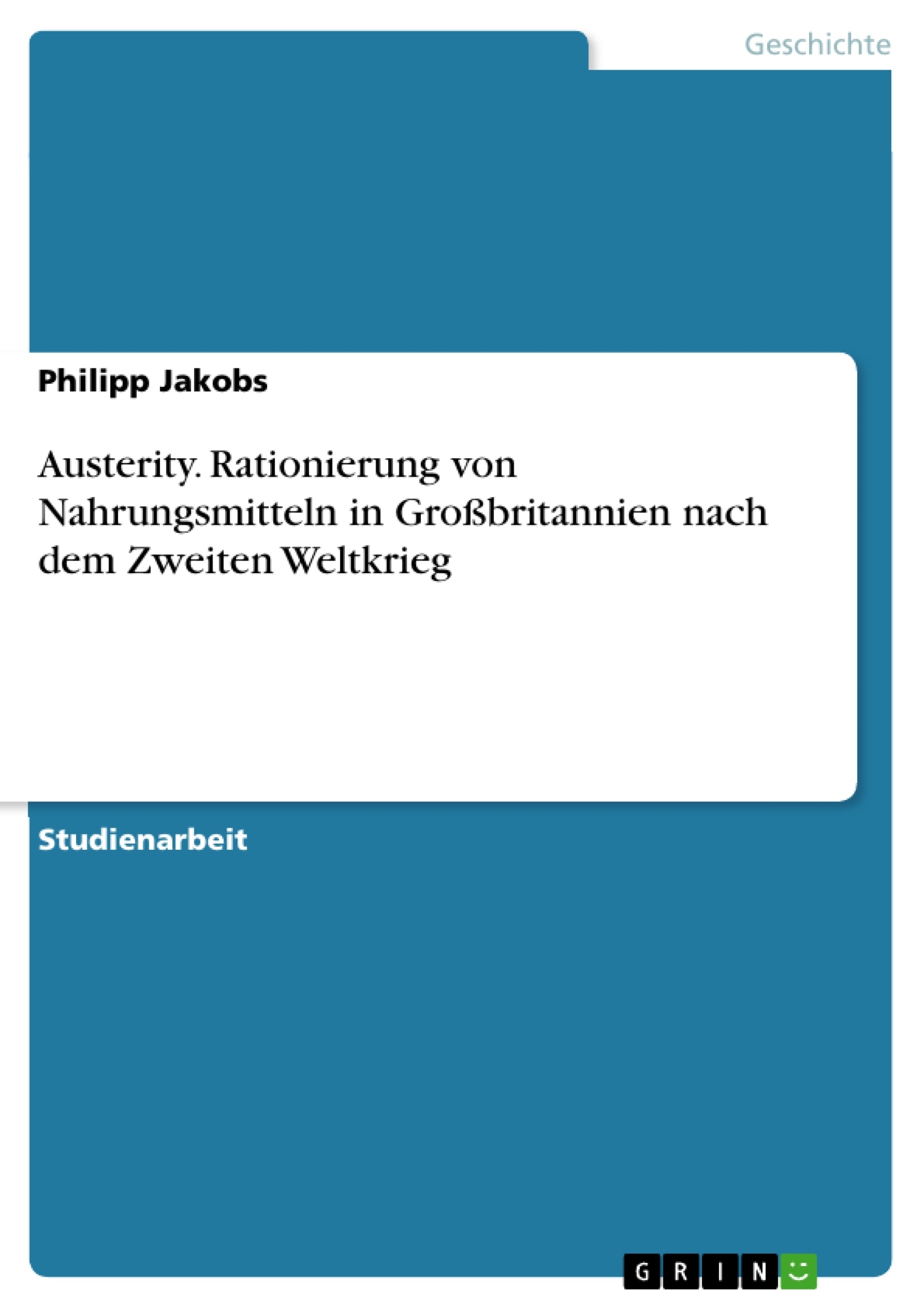„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“ 1 „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.“2 „Der ersparte Pfennig ist redlicher als der erworbene.“3 Sprichwörter wie diese sagen aus, dass der einzelne Mensch sparsam mit seinem Besitz umgehen soll. Auch der Staat als größeres Gemeinwesen hat ein Interesse daran, vorsichtig zu wirtschaften. Heutzutage hat z.B. die Bundesrepublik Deutschland eine Schuldenbremse in der Verfassung verankert4, wenngleich diese als Lösungsstrategie umstritten ist5. In Kriegsphasen und den Jahren danach müssen Staaten des Öfteren nicht nur selbst eine besonders sparsame Haushaltspolitik betreiben, sondern auch bestimmte Güter rationieren, wenn die Nachfrage über einen längeren Zeitraum das Angebot überschreitet; die Gefahr ist in solchen Phasen eher gegeben als in stabilen Friedenszeiten6. Diese Hausarbeit wird klären, weshalb in Großbritannien welche Rationierungsmaßnahmen speziell im Hinblick auf Nahrungsmittel noch nach dem Zweiten Weltkrieg erforderlich waren, ob diese eine Besonderheit der Jahre nach dem Kriege darstellten und welche Sichtweisen auf die Rationierung der Lebensmittel in der politischen Diskussion und in der Bevölkerung möglich waren. Wenngleich die Rationierung nicht nur Nahrung, sondern auch Kleidung, das Hauswesen, Produkte für den Bedarf von Kindern, Kosmetik und Öl betraf7, soll der Schwerpunkt in dieser Arbeit auf Nahrungsmitteln liegen, weil sie in jeder Kultur fürs menschliche Überleben unabdingbar sind.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Klärung des Begriffes Austerity
2. Austerity im Kontext der wirtschaftlichen, sozialen und wirtschaftspolitischen 5 Situation Großbritanniens nach dem Zweiten Weltkrieg
3. Das Vorgehen zur Lenkung der Nachfrage nach Nahrungsmitteln: Das System Beveridge während des Ersten Weltkrieges als Vorbild
4. Nahrungsmangel als Grund für die Rationierung in der Nachkriegszeit
5. Austerity im Verhältnis zum Programm der Labour-Partei
6. Austerity im Kontext des wirtschaftlichen Wiederaufbaus
7. Soziale Akzeptanz und Vermittelbarkeit der Rationierung
8. Austerity als Lösungsstrategie: Ein Erfolg?
9. Die Abschaffung der Austerity als Gegenstand politischer Kontroversen
10. Fazit und Ausblick
Bibliographie
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Austerity“ in der britischen Nachkriegszeit?
Austerity bezeichnet eine Politik der Entbehrung und Sparsamkeit, bei der der Staat den Konsum einschränkt und Güter rationiert, um die wirtschaftliche Erholung nach dem Krieg zu ermöglichen.
Warum mussten Nahrungsmittel in Großbritannien nach 1945 weiter rationiert werden?
Gründe waren massiver Nahrungsmangel, eine schwache Wirtschaftslage, hohe Staatsschulden und die Notwendigkeit, Importe zu begrenzen, um die Währung zu stabilisieren.
Welche Rolle spielte das „System Beveridge“?
Das System aus dem Ersten Weltkrieg diente als Vorbild für die Lenkung der Nachfrage und die gerechte Verteilung knapper Ressourcen in Krisenzeiten.
Wie reagierte die Bevölkerung auf die anhaltende Rationierung?
Die soziale Akzeptanz war ein großes Thema. Während die Notwendigkeit anfangs verstanden wurde, führten die anhaltenden Einschränkungen zu politischen Kontroversen und Unmut in der Bevölkerung.
War die Austerity-Politik aus wirtschaftlicher Sicht erfolgreich?
Die Arbeit untersucht, ob diese Lösungsstrategie den gewünschten Wiederaufbau beschleunigte oder ob sie die wirtschaftliche Dynamik durch zu starke Konsumbeschränkungen eher bremste.
- Quote paper
- Philipp Jakobs (Author), 2011, Austerity. Rationierung von Nahrungsmitteln in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179520