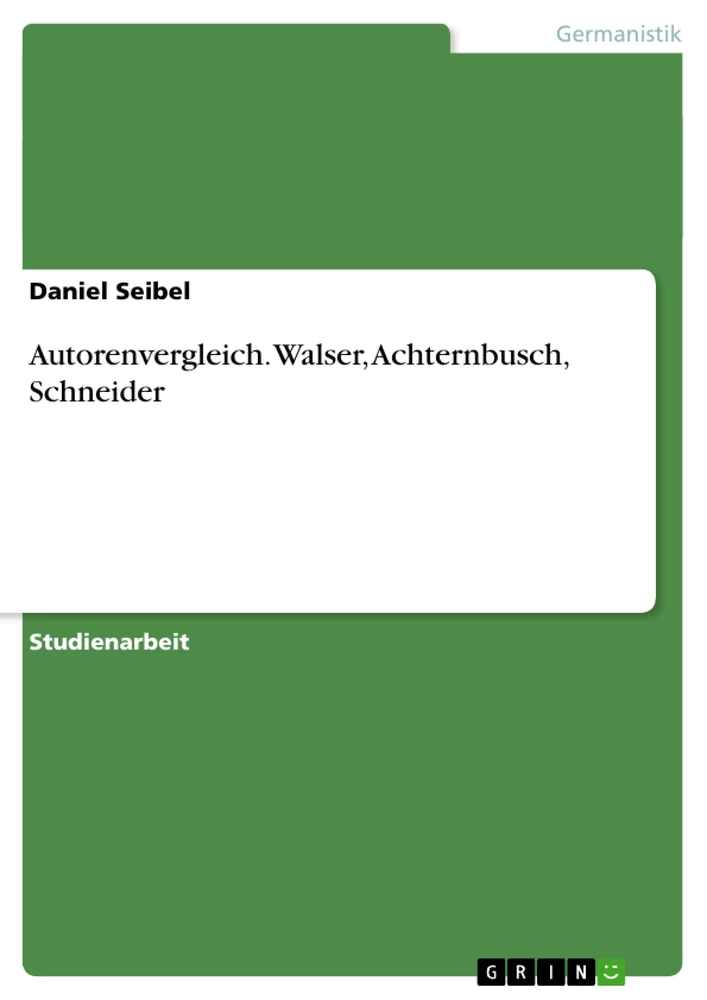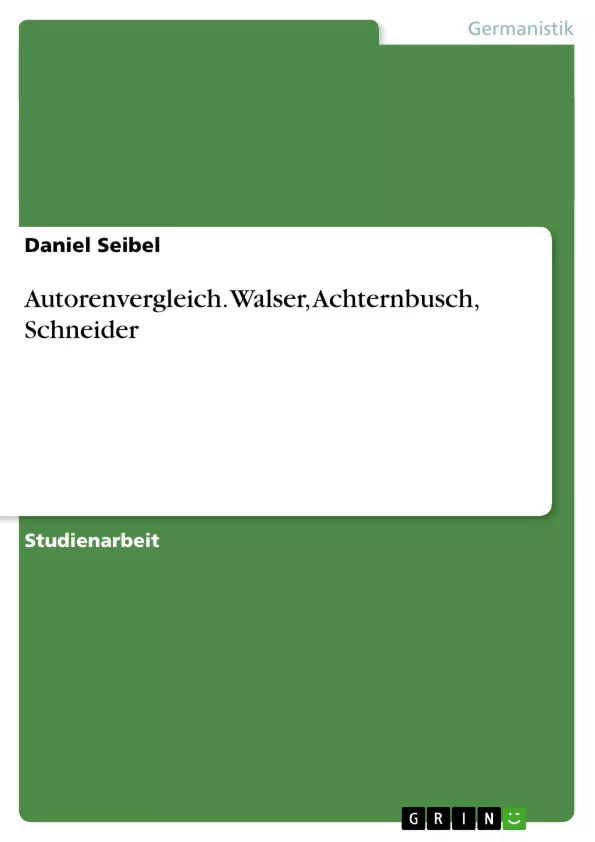– Ich vergleiche, indem ich zwei oder mehr Elemente in Beziehung zueinander setze
und aneinander messe. Hierfür sind unterschiedliche Ausgangssituationen denkbar:
Entweder ich unterziehe die willkürlich ausgewählten Elemente2 A und B einem
Vergleich, oder ich wähle ausgehend von einer Idee bewusst geeignete Elemente3 aus,
um gleiche Phänomene zu erkennen und zu weiteren Erkenntnissen zu gelangen.
– Der Gegenstand der Literaturwissenschaft wird, vereinfacht gesagt, qualitativ
definiert. Qualitativ – wenn etwa Vollkommenheit und Polysemie zum Kriterium
werden oder wenn Orte und Formen4 scheinbar per se über höhere Wertigkeiten
verfügen. Autoren, deren Werke außerhalb der Demarkationslinie des Kanons liegen,
unterliegen der Gefahr, zu Oberflächenphänomenen reduziert zu werden, die Parameter
des Diskurses drohen bedeutende Randerscheinungen zu trivialen Marginalien zu
degradieren. Philologischer Starrsinn und hermeneutische Einfalt erhöhen den
literarischen Rahmen zur unüberwindbaren Barriere - Außergewöhnliches wird dann für
gewöhnlich ausgegrenzt. Nicht besser ist jedoch hingegen der enervierende
Standesdünkel der Subkultur, der Kritik mit Intoleranz verwechselt, in dem
Anhängerschaft Selbstaufgabe heißt.
– Neugier, größtmögliche Unvoreingenommenheit, Werkkenntnis und die Bereitschaft,
spielerisch mit Texten umzugehen, können neue Wege erschließen, auf denen von
überraschenden Begegnungen bis zur Wiederentdeckung von Altbekanntem vieles
möglich ist. Die Arbeitsweise kann sich von philologischer Kleinstarbeit zur
umfassenden Diskursanalyse weiten – der Reiz sollte im Perspektivenwechsel liegen,
der Anspruch ist, statt in Suche nach letztmöglicher Wahrheit, in der Freiheit des Widerspruchs, die Herausforderung im Querdenken zu sehen. [...]
1 Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens, in: Rilke, Rainer Maria: Der ausgewählten Gedichte erster
Teil. Wiesbaden: Insel – Verlag 1951. S.74.
2 In diesem Fall Autoren bzw. Künstler (die Bezeichnungen werden im folgenden, synonym
gebraucht.)
3 Die quasi nach einem Vorvergleich für den Vergleich in Erwägung gezogen wurden.
4 Z.B. Buch und Roman im Gegensatz zu Feuilleton und Fragment.
Inhaltsverzeichnis
- Vorüberlegungen
- Autoren im Auf- und Abtauchen
- Spielverderber und Enttäuscher
- Vergleichsphase I
- Spazierwege, Irrwege
- Text, Selbst und Referenz
- Vergleichsphase II
- Dienen, Krisen, Komik
- Kommunikation cum und versus Nichtkommunikation
- Vergleichsphase III
- Mikrogramm Zensur Missverstehen
- Abschluss und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Werk von Robert Walser, Herbert Achternbusch und Helge Schneider, wobei die einzelnen Künstler in ihrer jeweiligen künstlerischen Praxis und in ihren Biografien miteinander verglichen werden. Das Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei Autoren aufzudecken und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen zu beleuchten.
- Die Rolle der Kunst im Leben und Werk der Autoren
- Die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Leben
- Der Einfluss der gesellschaftlichen und kulturellen Umgebung auf das Werk der Autoren
- Die Rezeption der Werke der Autoren durch die Öffentlichkeit
- Die Bedeutung von Spiel und Ironie in der künstlerischen Praxis der Autoren
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorüberlegungen: Diese Einleitung erläutert die grundlegende Methode des Autorenvergleichs, welche zwei oder mehr Elemente in Beziehung zueinander setzt und miteinander misst. Sie verdeutlicht die Herausforderungen, die sich bei der Analyse von Autoren ergeben, deren Werke außerhalb des etablierten literarischen Kanons liegen.
- Autoren im Auf- und Abtauchen: Dieses Kapitel untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Robert Walser, Herbert Achternbusch und Helge Schneider, wobei ihre künstlerischen Entwicklungen und ihre jeweiligen Positionen im öffentlichen Bewusstsein analysiert werden.
- Spielverderber und Enttäuscher: Dieser Abschnitt behandelt die Art und Weise, wie die drei Autoren in ihrer Arbeit mit Erwartungen spielen und diese zugleich enttäuschen.
- Vergleichsphase I: In diesem Abschnitt werden die Themen Spazierwege und Irrwege, sowie Text, Selbst und Referenz im Kontext der jeweiligen Werke der drei Autoren betrachtet.
- Vergleichsphase II: Dieses Kapitel befasst sich mit den Themen Dienen, Krisen, Komik und Kommunikation im Werk der drei Autoren.
- Vergleichsphase III: Der dritte Vergleich beleuchtet das Mikrogramm Zensur Missverstehen im Rahmen der jeweiligen Werke von Walser, Achternbusch und Schneider.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Künstlervergleich, Robert Walser, Herbert Achternbusch, Helge Schneider, Kunst und Leben, öffentliche Wahrnehmung, Spiel, Ironie, gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse, und Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Welche Künstler werden in diesem Autorenvergleich untersucht?
Die Arbeit vergleicht Robert Walser, Herbert Achternbusch und Helge Schneider hinsichtlich ihrer Werke und Biografien.
Was ist das Ziel dieses unkonventionellen Vergleichs?
Ziel ist es, Gemeinsamkeiten in der künstlerischen Praxis aufzudecken, insbesondere bei Autoren, die oft am Rande des literarischen Kanons stehen.
Was meint der Begriff "Spielverderber und Enttäuscher" im Text?
Er beschreibt die Tendenz der Autoren, Erwartungen des Publikums oder des Kulturbetriebs bewusst zu unterlaufen oder spielerisch zu enttäuschen.
Welche Rolle spielt das Verhältnis von Kunst und Leben?
Die Arbeit untersucht, wie sich die persönliche Existenz der Künstler in ihren Werken widerspiegelt und wie sie sich gegenüber der Öffentlichkeit positionieren.
Warum wird "Querdenken" als methodischer Anspruch genannt?
Statt nach einer "letzten Wahrheit" zu suchen, soll der Vergleich durch Perspektivwechsel und die Freiheit des Widerspruchs neue Erkenntnisse liefern.
- Arbeit zitieren
- Daniel Seibel (Autor:in), 2002, Autorenvergleich. Walser, Achternbusch, Schneider, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17956