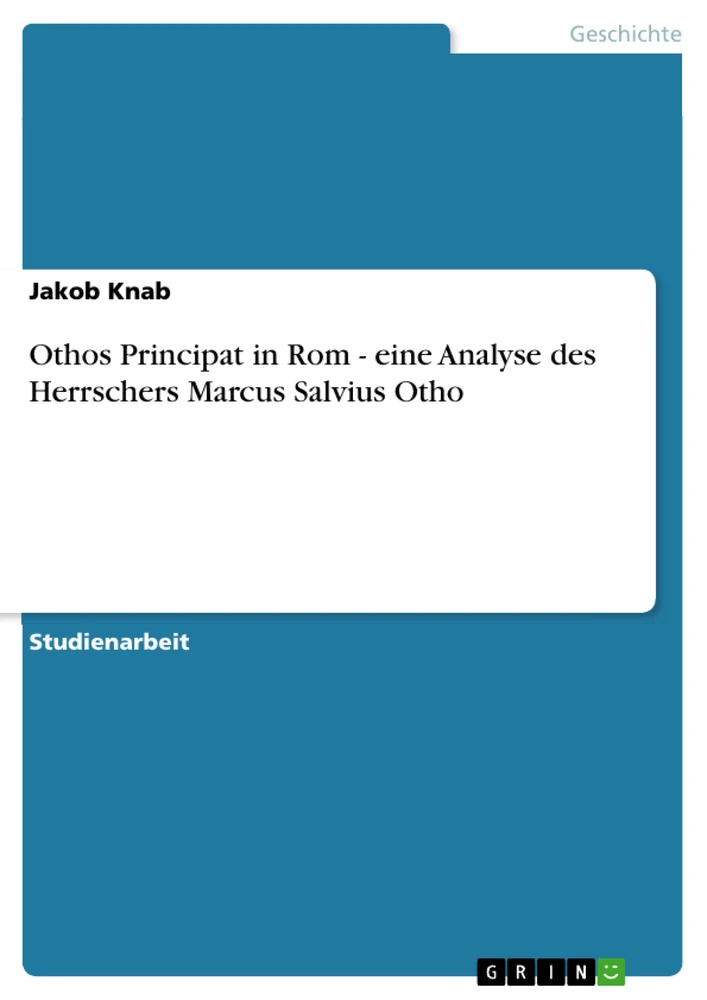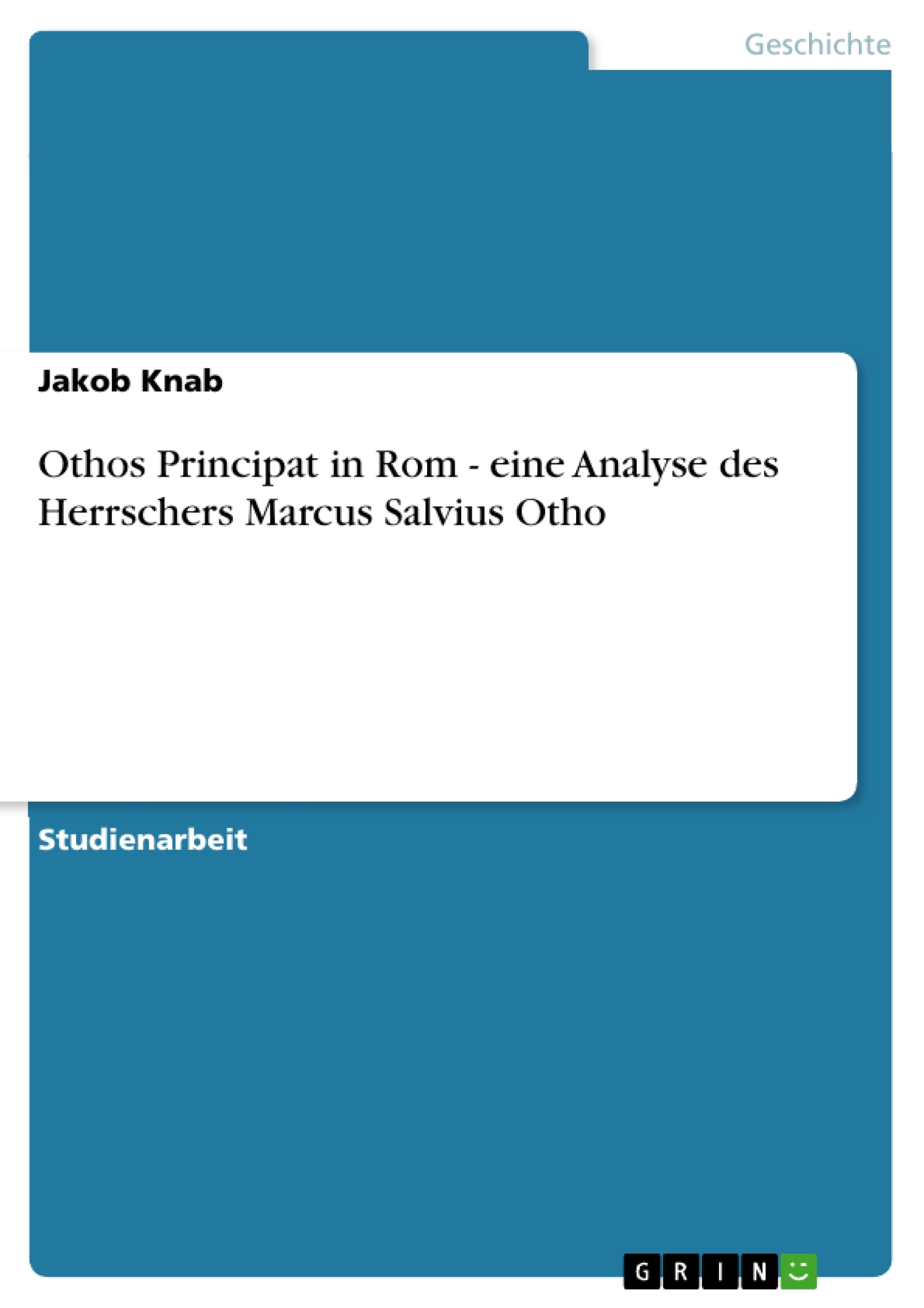Die vorliegende Hauptseminararbeit führt dem Leser die Herrscherpersönlichkeit des Otho vor und geht der Frage nach, ob Othos Principat langfristig Erfolg haben und seine Herrschaft sich stabilisieren hätte können. Hierfür wurden die entsprechenden Werke der wichtigsten antiken Autoren, die Othos Leben schildern, nämlich Publius Cornelius Tacitus, Plutarch, Cassius Dio, Gaius Suetonius Tranquillus sowie Marcus Valerius Martialis, analysiert. Weitere Erkenntnisse zur Beantwortung der Fragestellung wurden aus zahlreichen Darstellungen aus der Sekundärliteratur gewonnen.
Um dem Leser die Verständlichkeit zu erleichtern, werden in der hier vorliegenden Arbeit die Ereignisse chronologisch dargestellt: Otho wird als Person vor seinem Principat mit all seinen menschlichen Schwächen vorgestellt, die ihn, wie man meinen möchte, nicht für einen Princeps qualifiziert hätten. Auch wird seine Motivation, gegen Galba zu putschen genauer beleuchtet, bevor im Hauptteil dieses Werkes Othos zweimonatiges Principat in Rom untersucht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Otho vor dem Principat
- Othos junge Jahre
- Othos Aufstieg
- Othos Putsch
- Othos Hauptproblem: Der Gegenkaiser Vitellius
- Versuch der Konsolidierung
- Münzen
- Das Verhältnis zum Senat
- Das Verhältnis zu den Prätorianern
- Der Prätorianeraufstand
- Umgang mit potenziellen Gegnern
- Populäre Maßnahmen
- Otho - ein zweiter Nero?
- Die Konsolidierung schlägt fehl
- Der Bürgerkrieg und Othos Tod
- Beurteilung von Othos Herrschaft
- Bilderanhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit analysiert die Herrschaft des römischen Kaisers Marcus Salvius Otho, der im Vierkaiserjahr 68/69 n. Chr. für kurze Zeit den römischen Thron bestieg. Sie befasst sich mit der Frage, ob Othos Principat langfristig Erfolg haben und seine Herrschaft sich stabilisieren hätte können.
- Othos Leben vor dem Principat: seine Jugend, Aufstieg und Motivation zum Putsch
- Othos zweimonatiges Principat in Rom: seine Versuche zur Konsolidierung der Macht
- Othos Umgang mit dem Senat und den Prätorianern
- Die Rolle von Othos Charakter und seinen Schwächen in seiner Herrschaft
- Die Ereignisse des Bürgerkriegs und Othos Tod
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext des Vierkaiserjahres 68/69 n. Chr. und die Rolle des Othos dar. Sie erläutert den Fokus und die Herangehensweise der Seminararbeit.
- Otho vor dem Principat: Dieses Kapitel beleuchtet Othos Jugend, seinen Aufstieg am Hofe Neros und seine Motivation, gegen Galba zu putschen.
- Versuch der Konsolidierung: Dieses Kapitel analysiert die Maßnahmen, die Otho ergriff, um seine Herrschaft zu stabilisieren. Dazu gehören seine Münzprägungen, sein Verhältnis zum Senat und den Prätorianern sowie seine populären Maßnahmen.
- Die Konsolidierung schlägt fehl: Dieses Kapitel beschreibt die Gründe, warum Othos Versuche zur Konsolidierung scheiterten.
- Der Bürgerkrieg und Othos Tod: Dieses Kapitel behandelt den Bürgerkrieg zwischen Otho und Vitellius und Othos Tod.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselthemen: römisches Principat, Vierkaiserjahr, Marcus Salvius Otho, Machtkampf, Konsolidierung, Bürgerkrieg, Prätorianer, Senat, Münzprägung, politische Unsicherheit, Herrscherpersönlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Marcus Salvius Otho?
Otho war ein römischer Kaiser, der im sogenannten Vierkaiserjahr (68/69 n. Chr.) nach einem Putsch gegen Galba für nur zwei Monate den Thron bestieg.
Welche antiken Quellen berichten über Othos Leben?
Die wichtigsten Quellen sind die Werke von Tacitus, Plutarch, Cassius Dio, Sueton und Martial.
Warum scheiterte Othos Herrschaft?
Hauptgründe waren die mangelnde Stabilität seiner Machtbasis, der Konflikt mit dem Gegenkaiser Vitellius und die Unruhen innerhalb der Prätorianergarde.
Wurde Otho als ein "zweiter Nero" wahrgenommen?
Die Arbeit untersucht das Verhältnis Othos zu Nero und inwieweit er versuchte, populäre Maßnahmen Neros aufzugreifen, um seine eigene Herrschaft zu legitimieren.
Hätte Othos Principat langfristig Erfolg haben können?
Dies ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit, die Othos Versuche zur Konsolidierung der Macht gegenüber dem Senat und dem Militär analysiert.
- Citar trabajo
- Jakob Knab (Autor), 2011, Othos Principat in Rom - eine Analyse des Herrschers Marcus Salvius Otho, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179691