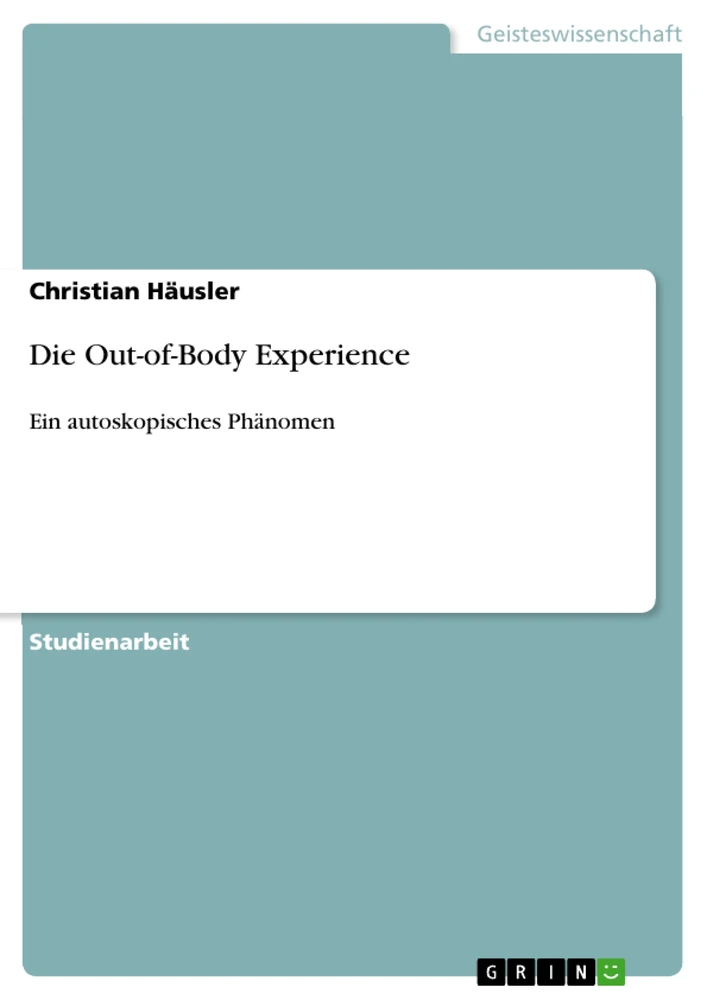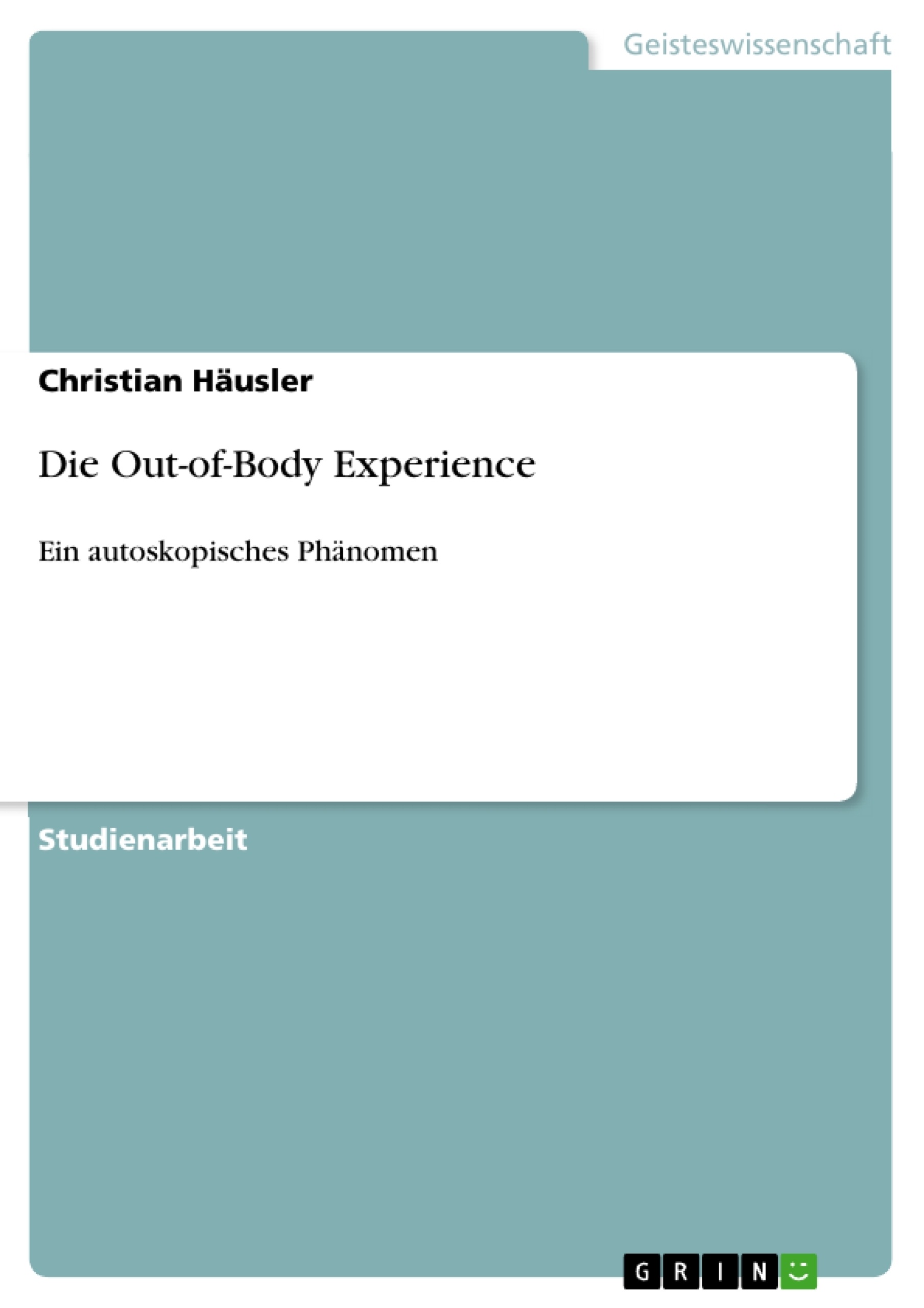Autoskopische Phänomene haben die Menschheit seit jeher fasziniert und sind vielfältig in Mythologie und Folklore eingegangen (Sheils, 1978; Todd & Dewhurst, 1955). Der Begriff Autoskopie stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet "sich selbst sehen" (Anzellotti et al., 2011; Mishara, 2010). Es handelt sich um das illusorisch-visuelle Erleben, ein Abbild des eigenen Körpers im extrakorporalenRaum wahrzunehmen. Zum einen kann dies bei der autoskopischen Halluzination (AH) und bei der Heautoskopie (HAS) aus einer körperinternen Perspektive der Fall sein. Zum anderen bei der ausserkörperlichen Erfahrung, auch Out-of-Body Experience (OBE) genannt, aus einer körperexternen Perspektive (Mishara, 2010).
Der erste medizinische Bericht über Autoskopie lässt sich auf Wigan (1844), die erstmalige Verwendung des Begriffs "Autoskopie" auf Féré (1891) zurückführen. Obwohl auch gesunde Menschen autoskopische Phänomene erleben, gilt neben verschiedenen psychiatrischen und neurologischen Störungen Epilepsie als ihre Hauptursache (Blanke & Arzy, 2005; Dening & Berrios, 1994; Dewhurst, 1954). Nach Jahrzehnten spärlichen Interesses ist aktuell eine Renaissance empirischer Forschung mit Fokus auf die OBE zu beobachten (Metzinger, 2009). Während einer OBE scheint eine Person wach zu sein und ihren Körper und die Welt von einem Ort auÿerhalb des eigenen Körpers wahrzunehmen (Blanke, Landis, Spinelli & Seeck, 2004). Sie stellt daher die empfundene räumliche Einheit zwischen Körper und Selbst, unserem Ich, und damit die Erfahrung eines realen Ich, das sich im eigenen Körper be??det und Zentrum des bewussten Erlebens ist, in Frage (Blanke & Arzy, 2005).
Während die OBE in der Vergangenheit überwiegend als paranormales Ereignis gedeutet wurde, stellten Blanke et al. (2004) ein naturwissenschaftliches Erklärungsmodell vor. Erkenntnisse ausNeurologie und kognitiver Neurowissenschaft der vergangenen Dekade legen nahe, dass OBEs auf ein Defizit multisensorischer Integration in der temporo-parietalen Grenzregion (TPJ) der rechten Gehirnhemisphäre zurückzuführen sind (Blanke et al., 2004). Ausgehend von diesem Modell könnte die zukünftige Erforschung der OBE die Erkenntnisse auf der Suche nach den neuronalen Korrelaten des Ich-Bewusstseins (das Wissen des Individums um seine Identität) fördern (Metzinger, 2009).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Klassifikation und Beschreibung autoskopischer Phänomene
- 2.1 autoskopische Halluzination
- 2.2 Heautoskopie
- 2.3 Out-of-Body Experience (OBE)
- 2.4 Zwischenzusammenfassung
- 3 Geschichte der OBE
- 4 Interpretation der OBE
- 4.1 OBE als Halluzination
- 4.2 OBE als Folge doppelter Desintegration
- 5 Neuronale Korrelate der OBE
- 6 Die Manipulierbarkeit des körperlichen Ich-Bewusstseins
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Out-of-Body Experience (OBE), einer autoskopischen Erfahrung, die durch die Wahrnehmung einer Trennung zwischen dem physischen Körper und dem Ich-Bewusstsein gekennzeichnet ist. Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Facetten der OBE zu beleuchten, die historischen und wissenschaftlichen Hintergründe zu erforschen und aktuelle neurologische Erkenntnisse zu beleuchten.
- Klassifizierung und Beschreibung autoskopischer Phänomene
- Historische Entwicklung des Verständnisses der OBE
- Theorien zur Interpretation der OBE
- Neuronale Korrelate der OBE
- Manipulierbarkeit des Ich-Bewusstseins
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema der autoskopischen Phänomene, insbesondere der OBE, einführt und die Bedeutung des Themas für die Psychologie und Neuropsychologie aufzeigt. Kapitel 2 beschreibt die verschiedenen Facetten autoskopischer Phänomene und unterscheidet zwischen autoskopischer Halluzination, Heautoskopie und OBE. Die Kapitel 3 und 4 widmen sich der historischen Entwicklung des Verständnisses der OBE und präsentieren verschiedene Interpretationen des Phänomens. Kapitel 5 erörtert neurologische Erkenntnisse und Modelle, die die OBE auf neurologische Prozesse zurückführen, und Kapitel 6 diskutiert die Manipulierbarkeit des Ich-Bewusstseins.
Schlüsselwörter
Autoskopie, Out-of-Body Experience (OBE), Halluzination, Heautoskopie, Doppelgänger, Neurologie, temporo-parietale Grenzregion (TPJ), Ich-Bewusstsein, Selbst-Bewusstsein, multisensorische Integration, Wahrnehmung, Realität, Bewusstsein, Körperbild, Erfahrung, Psychologie, Neuropsychologie, Wissenschaft, Forschung, Theorien, Modelle, Erkenntnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Out-of-Body Experience (OBE)?
Eine OBE ist ein autoskopisches Phänomen, bei dem eine Person das Gefühl hat, sich außerhalb ihres physischen Körpers zu befinden und die Welt aus einer externen Perspektive wahrzunehmen.
Wo im Gehirn entstehen außerkörperliche Erfahrungen?
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse weisen auf die temporo-parietale Grenzregion (TPJ) der rechten Gehirnhemisphäre hin, die für die Integration multisensorischer Daten zuständig ist.
Was unterscheidet Heautoskopie von einer OBE?
Bei der Heautoskopie nimmt man ein Abbild des eigenen Körpers wahr, bleibt aber unsicher über die eigene räumliche Position, während man bei einer OBE klar "außerhalb" zu sein scheint.
Sind OBEs immer Anzeichen einer Krankheit?
Nicht zwingend. Obwohl sie bei Epilepsie oder psychiatrischen Störungen auftreten, können auch gesunde Menschen durch extreme Erschöpfung oder Meditation solche Phänomene erleben.
Kann man das Ich-Bewusstsein künstlich manipulieren?
Ja, durch Experimente wie die "Rubber Hand Illusion" oder virtuelle Realität kann die multisensorische Integration gestört werden, um das Gefühl der körperlichen Einheit zu verändern.
- Quote paper
- Christian Häusler (Author), 2011, Die Out-of-Body Experience , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179697