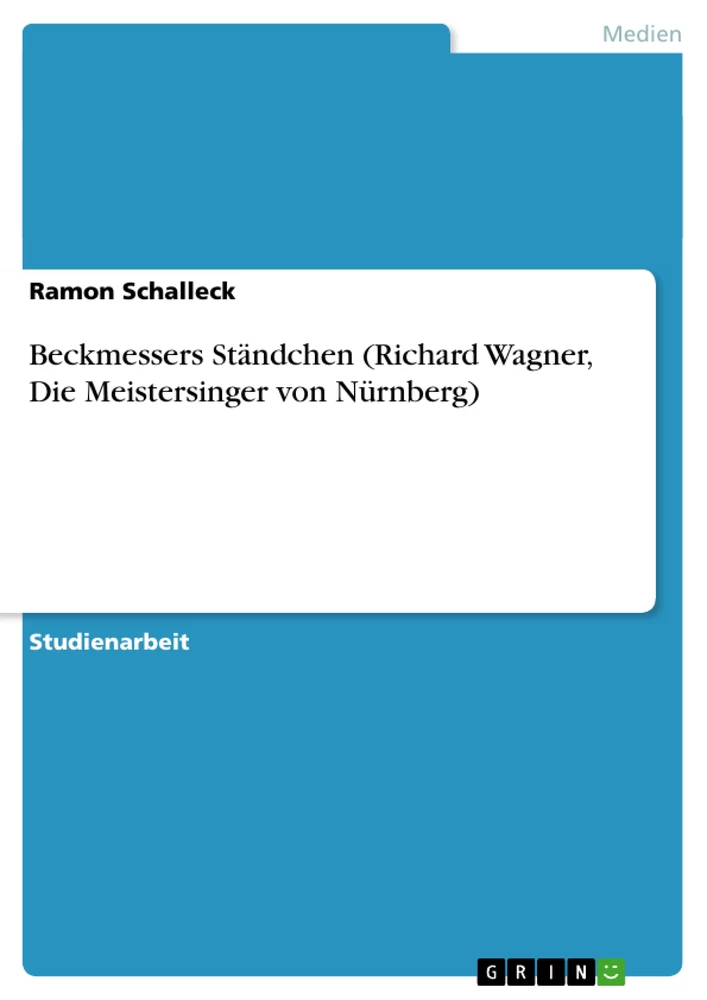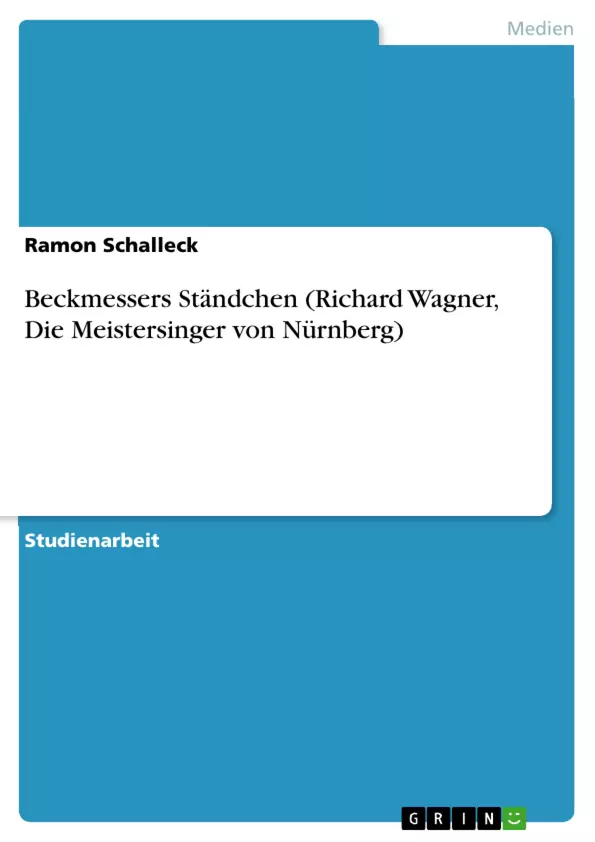In der Mitte des 16. Jahrhunderts hatte sich eine neue soziale Schicht etabliert. Neben den
großen Handelsstädten wie Florenz und Venedig, mit ihren einflussreichen Händlerfamilien
wie den Medici, gab es auch in deutschen Städten ein immer einflussreicher werdendes Bürgertum.
Dazu gehörten vor allem die Handwerker, Händler und Beamte, die einen gewissen
Wohlstand erreicht hatten und dadurch auch die Zeit und Geld hatten, die Kunst als Mittel der
Repräsentation ihrerMacht zu benutzen. Neben den Handwerkerzünften entwickelten sich auch
zunftmäßige Singschulen, wie die Meistersingerzunft in Nürnberg [1], das schon durch die zukunftsweisende
Malerei von Albrecht Dürer zu einem deutschen kulturellen Zentrum geworden
war. Nach festen Regeln und Satzungen konnten dort Lehrlinge neben ihrer beruflichen Laufbahn
zu Meistersingern ausgebildet werden. In der Oper "Die Meistersinger von Nürnberg", die
1868 in München uraufgeführt wurde, befasste sich Richard Wagner mit der Kunst der Meistersinger.
Sowohl die Musik als auch der Text stammen von Richard Wagner. Das Stück zählt
also zu Wagners Musikdramen. Neben seiner langjährigen Arbeit am Tristan schuf Wagner ein
"komisches Spiel"[2].
Das zentrale Thema dieser Arbeit, die im Rahmen des Hauptseminars "Wagner - Die Meistersinger
von Nürnberg"von Professor Dr. Hartmut Schick im Sommersemester 2003 an der
Ludwig-Maximilians-Universität am Institut für Musikwissenschaft entstand, ist das Ständchen
von dem Meistersinger Sixtus Beckmesser in der 6. Szene 2. Akt. In der Arbeit wird darauf
eingegangen, welche Faktoren zum Scheitern Beckmessers führen. Das lässt sich zum Beispiel
aus der missglückten Zusammenführung aus Form und Inhalt der Canzonetta schließen. Aber
auch aus dem herausragenden Element in Beckmessers Ständchen, den Schlägen von Sachs, die
im Kapitel 3.3 behandelt werden.
Zu den Meistersingern gibt es mehrere Klavierausgaben und Partituren. Die Angaben in dieser
Arbeit beziehen sich auf den Klavierauszug [3] der mangels Taktangabe nur mit der Seitenzahl
referiert werden kann. [...]
[1] Ulrich Michels. dtv-Atlas zur Musik. Tafeln und Texte. Band 1. Systematischer Teil: Von
den Anfängen bis zur Renaissance. Deutscher Taschenbuch Verlag, Bärenreiter Verlag, 11.
Auflage, München, Kassel, 1987, Seite 197
[2] Wilhelm Zentner. RichardWagner. DieMeistersinger von Nürnberg. Philipp Reclam Jun.,
Stuttgart, 1966
[3] Richard Wagner. Die Meistersinger von Nürnberg. Klavierauszug mit Text. C.F. Peters,
Leipzig
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Personen
- 2.1 Eva Pogner und Walther von Stolzing
- 2.2 Sixtus Beckmesser und Hans Sachs
- 2.3 Magdalene und David
- 3 Beckmessers Ständchen in den verschiedenen Ebenen
- 3.1 Ebene 1 - Handlung
- 3.2 Ebene 2 - Das Ständchen
- 3.2.1 Form
- 3.2.2 Versmaß
- 3.2.3 Takt
- 3.2.4 Melodik
- 3.2.5 Form und Inhalt
- 3.2.6 Die Laute
- 3.3 Ebene 3 - Die Schläge von Sachs
- 3.3.1 Verteilung der Schläge in Strophe 1 und 2
- 3.4 Ebene 4 - Orchester
- 4 Parallelen
- 5 Fazit
- 6 Klavierauszug
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Ständchen von Sixtus Beckmesser im zweiten Akt der Wagner-Oper "Die Meistersinger von Nürnberg". Das zentrale Ziel ist die Analyse der Faktoren, die zum Scheitern von Beckmessers Auftritt führen. Hierbei werden die musikalischen Aspekte, die Handlungsebene und die Interaktion mit anderen Figuren berücksichtigt.
- Analyse der musikalischen Gestaltung von Beckmessers Ständchen (Form, Melodik, Rhythmus).
- Untersuchung der Handlungsebene und der Rolle von Beckmesser innerhalb des dramatischen Kontextes.
- Bedeutung der Interaktion zwischen Beckmesser, Sachs, Eva und Walther.
- Die Rolle des Zufalls und der Ironie im Scheitern des Ständchens.
- Zusammenhang zwischen Form und Inhalt der musikalischen Komposition und dem Handlungsverlauf.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in den historischen Kontext der Meistersinger und in Wagners Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" ein. Sie beschreibt die gesellschaftliche Stellung des Bürgertums im 16. Jahrhundert und die Bedeutung der Meistersingerzünfte. Die Arbeit konzentriert sich auf das Ständchen Beckmessers und untersucht die Gründe für dessen Misserfolg, wobei die Interaktion von Form und Inhalt des Ständchens, sowie die Rolle von Hans Sachs' Schlägen, im Mittelpunkt steht. Die verwendeten Quellen, insbesondere der Klavierauszug, werden erwähnt.
2 Personen: Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Personen der sechsten Szene des zweiten Akts vor: Eva Pogner und Walther von Stolzing, deren Liebe die Handlung vorantreibt; Sixtus Beckmesser, der rivalisierende Bewerber um Evas Hand und sein Gegenspieler Hans Sachs, der Walther unterstützt; und schließlich Magdalene und David, deren Aktionen das Geschehen zusätzlich beeinflussen. Die Charakterisierung der Figuren beleuchtet ihre Beziehungen zueinander und ihre Rolle im Kontext von Beckmessers Ständchen.
3 Beckmessers Ständchen in den verschiedenen Ebenen: Dieses Kapitel analysiert Beckmessers Ständchen auf verschiedenen Ebenen: der Handlungsebene, der musikalischen Ebene (Form, Versmaß, Takt, Melodik, Form und Inhalt, die Laute), der Ebene der Schläge von Sachs und der Orchesterebene. Es beschreibt detailliert die Ereignisse der sechsten Szene des zweiten Akts, das Misslingen von Beckmessers Auftritt aufgrund von Sachs' Intervention und die daraus resultierende Schlägerei. Die Analyse der verschiedenen Ebenen beleuchtet die vielschichtigen Aspekte des Ständchens und seine Bedeutung für das Gesamtwerk.
Schlüsselwörter
Richard Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg, Sixtus Beckmesser, Ständchen, Canzonetta, Hans Sachs, musikalische Analyse, Handlungsanalyse, Form und Inhalt, Ironie, Scheitern, Meistersinger, Nürnberg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Analyse des Ständchens von Sixtus Beckmesser in Wagners Die Meistersinger von Nürnberg"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Ständchen von Sixtus Beckmesser im zweiten Akt von Richard Wagners Oper "Die Meistersinger von Nürnberg". Der Fokus liegt auf den Gründen für das Scheitern von Beckmessers Auftritt, wobei musikalische, dramaturgische und interaktive Aspekte untersucht werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die musikalische Gestaltung des Ständchens (Form, Melodik, Rhythmus), die Handlungsebene und Beckmessers Rolle im dramatischen Kontext, die Interaktion zwischen Beckmesser, Sachs, Eva und Walther, die Rolle von Zufall und Ironie, sowie den Zusammenhang zwischen musikalischer Form und Handlungsverlauf.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Charakterisierung der wichtigsten Figuren (Eva, Walther, Beckmesser, Sachs, Magdalene und David), eine detaillierte Analyse von Beckmessers Ständchen auf verschiedenen Ebenen (Handlung, Musik, Sachs' Intervention, Orchester), ein Kapitel zu Parallelen (der genaue Inhalt ist nicht spezifiziert), ein Fazit und einen Klavierauszug.
Wie wird das Ständchen von Beckmesser analysiert?
Das Ständchen wird auf vier Ebenen analysiert: der Handlungsebene, der musikalischen Ebene (inkl. Form, Versmaß, Takt, Melodik, Form-Inhalt-Beziehung und der Rolle der Laute), der Ebene von Sachs' Schlägen und der Orchesterebene. Die Analyse beleuchtet die vielschichtigen Aspekte des Ständchens und seine Bedeutung für das Gesamtwerk.
Welche Personen werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit stellt die wichtigsten Personen der sechsten Szene des zweiten Akts vor: Eva Pogner und Walther von Stolzing (Liebende), Sixtus Beckmesser (rivalisierender Bewerber), Hans Sachs (Walthers Unterstützer), sowie Magdalene und David (deren Aktionen das Geschehen beeinflussen).
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit erwähnt explizit die Verwendung eines Klavierauszugs als Quelle. Weitere Quellen werden in der Einleitung detaillierter beschrieben.
Was ist das zentrale Ziel der Arbeit?
Das zentrale Ziel ist die Analyse der Faktoren, die zum Scheitern von Beckmessers Auftritt führen. Es werden die musikalischen Aspekte, die Handlungsebene und die Interaktion mit anderen Figuren berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Richard Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg, Sixtus Beckmesser, Ständchen, Canzonetta, Hans Sachs, musikalische Analyse, Handlungsanalyse, Form und Inhalt, Ironie, Scheitern, Meistersinger, Nürnberg.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels, beginnend mit der Einleitung, die den historischen Kontext und die Forschungsfrage einführt. Es folgt eine Beschreibung der Kapitel zu den Personen, der mehrschichtigen Analyse des Ständchens und schließlich dem Fazit.
- Citar trabajo
- Ramon Schalleck (Autor), 2003, Beckmessers Ständchen (Richard Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17974