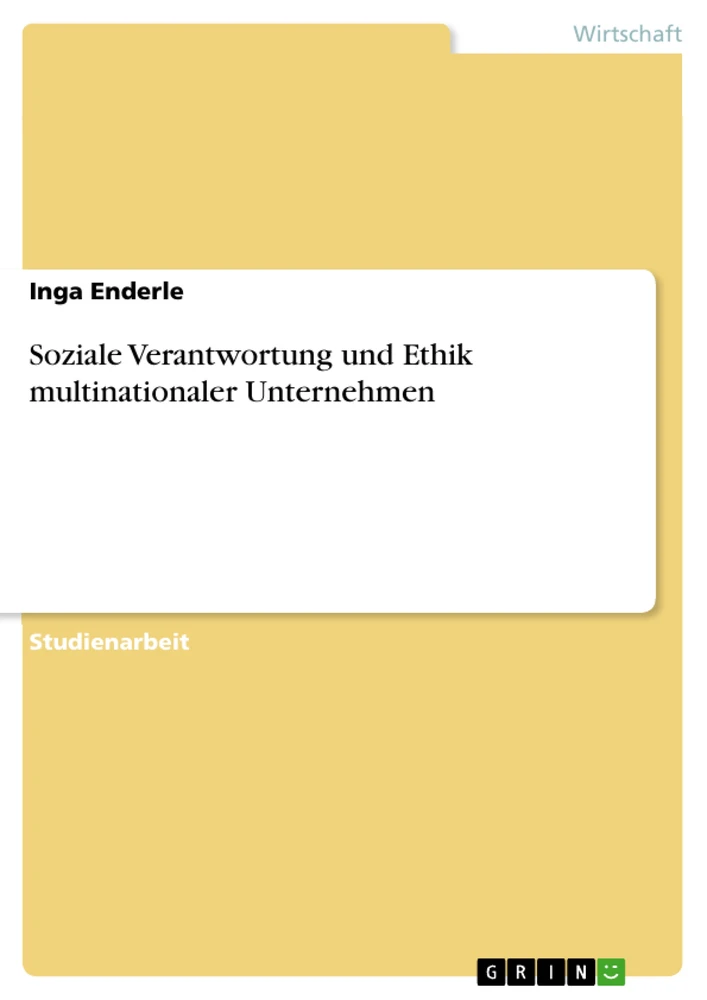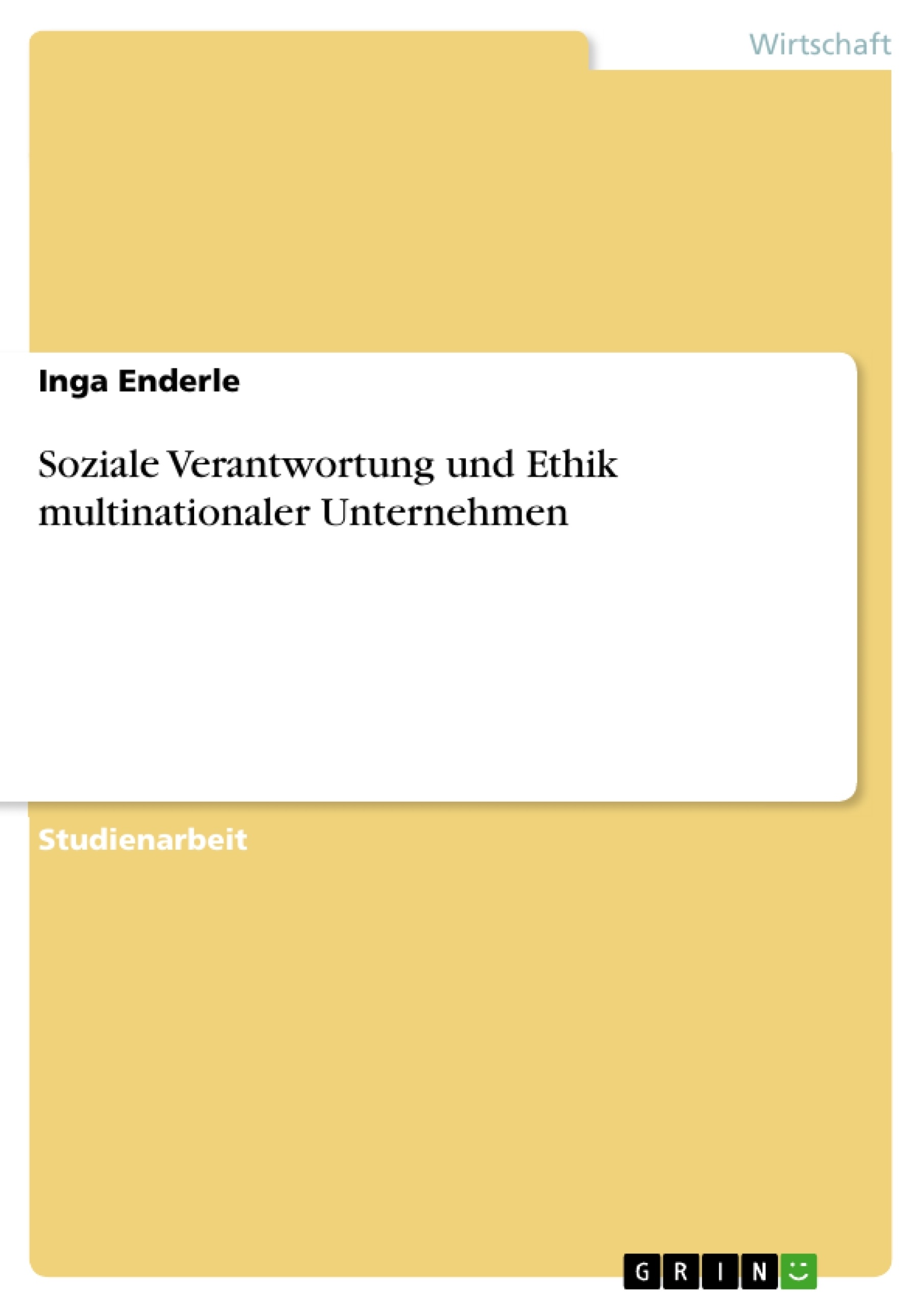Die zunehmende internationale Ausdehnung wirtschaftlicher Aktivitäten birgt zahlreiche Chancen, z. B. weltweit besseren Zugang zu und eine größere Auswahl an Gütern und Dienstleistungen, aber auch Risiken in sich, z. B. Verlagerung von Arbeitsplätzen und in Folge dessen Anstieg struktureller Arbeitslosigkeit in den Industrienationen. Auf multinationale Unternehmen, d. h. Unternehmen, die in vielen Staaten vertreten sind und den Weltmarkt unter Berücksichtigung länderspezifischer Bedürfnisse bearbeiten, kommen neue und immer komplexer werdende Aufgaben und Anforderungen zu. Zudem werden sie von der Öffentlichkeit mit dem Vorwurf konfrontiert, im Zuge der Globalisierung die Freiwilligkeit von sozialen Richtlinien und offensichtliche globale Gesetzeslücken (z. B. Kinderarbeit in Entwicklungsländern) auszunutzen, um im wohlverstandenen Eigeninteresse zu handeln und nicht nachhaltig und verantwortlich im Sinne des Gemeinwohls.
Schwierig hierbei ist es, einen universell gültigen Handlungsrahmen für soziale Verantwortung zu definieren, an dem sich alle Unternehmen orientieren können und der sämtliche regionale Unterschiede von Wertesystemen berücksichtigt. Problematisch ist auch die nicht eindeutige und allgemeinverbindliche inhaltliche Abgrenzbarkeit der Begriffe „Soziale Verantwortung“ und „Ethik“. Wo also die Grenzen von Legalität und gesetzlicher Verpflichtung aufhören und Ethik, moralisches Handeln und soziale Verantwortung anfangen, ist fraglich, genauso, inwieweit einheitliche Regelungen für sozial verantwortliches Handeln in Unternehmen konkretisierbar sind. Es gestaltet sich als anspruchsvolle Herausforderung, Unternehmen zur Einhaltung potentieller Richtlinien zu bewegen und das möglichst auf einer global einheitlichen Art und Weise.
Inhaltsverzeichnis
- Begriffsabgrenzungen und Problemstellung
- Soziale Verantwortung und Ethik
- Soziale Verantwortung der Unternehmen
- Verantwortungsträger_
- Gegenstand sozialer Verantwortung
- Initiativen und Leitsätze zur Umsetzung sozialer Verantwortung
- Einhaltung und Kontrolle sozialer Verantwortung
- Externe Anreize und Bewertungsmöglichkeiten sozialer Verantwortung von Unternehmen
- Interne Motivation der Unternehmen für die Einhaltung sozialer Verantwortung
- Beispiele von sozial verantwortlichen und unverantwortlichen Unternehmen
- Soziale Verantwortung der Unternehmen
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text behandelt die Bedeutung sozialer Verantwortung und Ethik für multinationale Unternehmen in einem globalisierten Kontext.
- Die Herausforderungen der Globalisierung für Unternehmen
- Die Definition und Bedeutung von sozialer Verantwortung
- Die Einhaltung und Kontrolle von sozialer Verantwortung
- Die Rolle von Stakeholdern und Unternehmensethik
- Beispiele für sozial verantwortliche und unverantwortliche Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel setzt sich mit den Begriffsabgrenzungen und der Problemstellung auseinander. Es beleuchtet die Chancen und Risiken der Globalisierung für multinationale Unternehmen und stellt die Bedeutung von sozialer Verantwortung und Ethik in diesem Kontext heraus.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit der sozialen Verantwortung von Unternehmen. Es beleuchtet die Rolle von Verantwortungsträgern, den Gegenstand sozialer Verantwortung, Initiativen und Leitsätze zur Umsetzung sowie die Einhaltung und Kontrolle sozialer Verantwortung. Es geht auch auf externe Anreize und Bewertungsmöglichkeiten sowie interne Motivationen für Unternehmen ein, die soziale Verantwortung wahrnehmen.
- Das dritte Kapitel enthält Beispiele von sozial verantwortlichen und unverantwortlichen Unternehmen. Es zeigt auf, wie Unternehmen ihre soziale Verantwortung in der Praxis umsetzen und welche Folgen ein verantwortungsloses Handeln haben kann.
Schlüsselwörter
Soziale Verantwortung, Ethik, multinationale Unternehmen, Globalisierung, Stakeholder, Verantwortungsträger, Unternehmensethik, Nachhaltigkeit, CSR, Triple Bottom Line.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR bezeichnet die soziale und ökologische Verantwortung von Unternehmen, die über gesetzliche Verpflichtungen hinausgeht und auf Nachhaltigkeit abzielt.
Welche Risiken bringt die Globalisierung für die Unternehmensethik?
Es besteht die Gefahr, dass Unternehmen globale Gesetzeslücken (z. B. Kinderarbeit) ausnutzen, um Kosten zu senken, statt verantwortungsvoll zu handeln.
Wie kann die Einhaltung sozialer Standards kontrolliert werden?
Dies geschieht durch externe Anreize, Bewertungsmöglichkeiten durch Stakeholder sowie interne Motivationssysteme der Unternehmen.
Was ist die "Triple Bottom Line"?
Ein Konzept, das den Unternehmenserfolg nicht nur ökonomisch, sondern auch an sozialen und ökologischen Kriterien misst.
Wer sind die Verantwortungsträger in multinationalen Unternehmen?
Verantwortungsträger sind sowohl die Unternehmensführung als auch die einzelnen Mitarbeiter, die ethische Richtlinien in der täglichen Praxis umsetzen müssen.
Gibt es Beispiele für verantwortungsvolles Handeln?
Die Arbeit stellt Praxisbeispiele gegenüber, um zu zeigen, wie soziale Verantwortung erfolgreich integriert werden kann oder wo sie versagt.
- Quote paper
- Inga Enderle (Author), 2007, Soziale Verantwortung und Ethik multinationaler Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179759