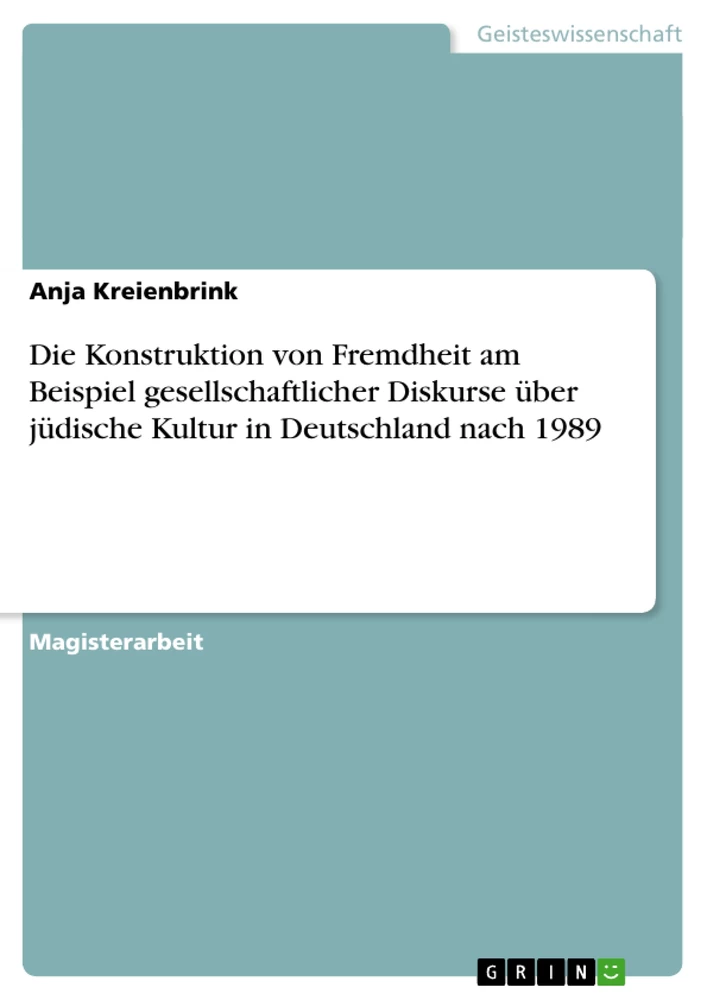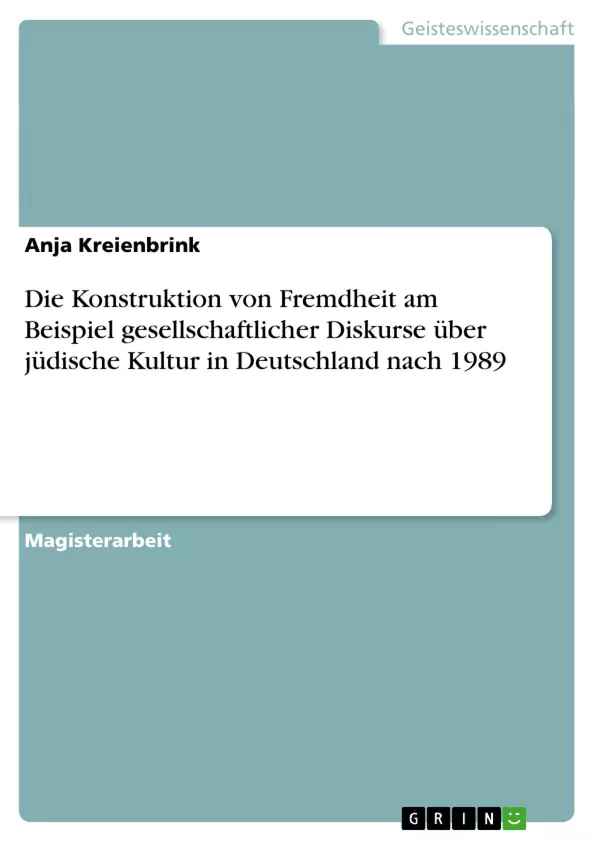Es geht in dieser Arbeit um die Konstruktion ‚jüdischer Kultur‘ in Deutschland nach 1989. Der Fokus liegt dabei auf den letzten 20 Jahren, weil seit dem Ende des Kalten Krieges, der Wiedervereinigung Deutschlands und der Öffnung des ‚Eisernen Vorhangs‘ die Zahl der in der BRD lebenden Juden durch die Einwanderung osteuropäischer Juden enorm gestiegen ist. Dieser demographische Wandel ging (und geht) auf der einen Seite einher mit Tendenzen, die öffentliche Rolle der Juden neu zu bestimmen. Auf der anderen Seite spielen aber auch innerjüdische Identitätskonflikte eine Rolle. Parallel dazu ist das Interesse an jüdischen Themen in zahlreichen europäischen Ländern gewachsen; die Rede ist von einem „Wiedererstehen jüdischer Kultur“, gerade auch in Deutschland. Ausgehend davon soll untersucht welchen, welche Vorstellungen von ‚jüdischer Kultur‘ in diesem Kontext (re-)produziert werden, und weitergehend, welche Motive und Implikationen dem zugrunde liegen. Dabei soll einerseits die historische Eingebundenheit bestimmter Stereotype und die Kontinuität tradierter Vorstellungen aufgezeigt werden. Andererseits soll in einem Ausblick der Konstruktionscharakter gegenwärtiger ‚jüdischer Kultur‘ untersucht werden hinsichtlich der Chancen, die er möglicherweise für einen erweiterten Kultur- und Identitätsbegriff bietet. Der Fokus dieser Arbeit liegt dabei vornehmlich auf der ‚Außenperspektive‘, in dem Bewusstsein, dass Juden so einmal mehr aus einem nicht-jüdischen Blickwinkel gesehen werden. Dies erscheint aber nötig, da es um die konstruierte Fremdheit jüdischer Kultur geht, die ihren Ausgangspunkt eben primär in einer nicht-jüdischen Wahrnehmung hat. Anschließend an die Forderung der Fremdheitsforschung, den Aufbau von Stereotypen und Vorurteilen zu untersuchen, soll also jüdische Kultur als Objekt einer exotisierenden und folklorisierenden Fremdwahrnehmung untersucht und der Frage nachgegangen werden, welche kulturellen Stereotype in der medialen Darstellung kursieren. Dies geschieht am Beispiel der medialen Rezeption der Jüdischen Kulturtage in Berlin. Diese sind deshalb besonders relevant, weil hier die Selbstrepräsentation der Jüdischen Gemeinde auf die gesellschaftlichen Erwartungen und Vorstellungen von ‚jüdischer Kultur‘ treffen, so dass von einer wechselseitigen Beeinflussung ausgegangen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der Fremdheit – eine theoretische Annäherung
- Der historisch-gesellschaftliche Kontext der Fremdwahrnehmung der Juden
- Die,deutsch-jüdische Symbiose
- Die Wahrnehmung der Juden als Fremde in der BRD nach der Shoah
- Das, Sichtbar-Werden der Juden in Deutschland
- Bestimmungsversuche jüdischer Identität und Kultur
- Diskurse über jüdische Kultur als Mittel des Fremdmachens
- Die Jüdischen Kulturtage in Berlin als Teil des exotiszierenden und folklorisierenden Diskurses
- Der Jüdische Raum als Projektionsfläche für Fremdheit und Identität
- Exkurs: Das,Scheunenviertel als Jüdischer Raum
- Das Phänomen der virtuellen jüdischen Kultur
- Probleme und Implikationen einer virtuellen jüdischen Kultur
- Virtuelle jüdische Kultur als Spielfeld neuer Kultur- und Identitätsentwürfe
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Konstruktion von Fremdheit am Beispiel gesellschaftlicher Diskurse über jüdische Kultur in Deutschland nach 1989. Im Fokus stehen die letzten zwanzig Jahre, in denen durch die Wiedervereinigung Deutschlands und die Einwanderung osteuropäischer Juden ein neuartiger Diskurs über jüdische Kultur entstanden ist. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Motive und Implikationen dieser Konstruktionen, indem sie die historische Eingebundenheit bestimmter Stereotype und die Kontinuität tradierter Vorstellungen aufzeigt. Gleichzeitig soll untersucht werden, welche Chancen sich durch diesen Konstruktionscharakter für einen erweiterten Kultur- und Identitätsbegriff bieten.
- Die Konstruktion von ‚jüdischer Kultur‘ in Deutschland nach 1989
- Die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen in der Wahrnehmung jüdischer Kultur
- Die Verbindung von Fremd- und Selbstwahrnehmung im Kontext der ‚jüdischen Kultur‘
- Die Bedeutung der Shoah für die aktuelle Wahrnehmung jüdischer Kultur
- Die Chancen eines erweiterten Kultur- und Identitätsbegriffs
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Arbeit vor: Wie wird ‚jüdische Kultur‘ in Deutschland konstruiert und welche Auswirkungen hat diese Konstruktion auf das Verhältnis von Juden und Nicht-Juden? Die Arbeit betont die Wichtigkeit der ‚Außenperspektive‘, da es um die konstruierte Fremdheit geht, die ihren Ursprung in der nicht-jüdischen Wahrnehmung hat.
- Der Begriff der Fremdheit – eine theoretische Annäherung: Dieses Kapitel widmet sich der theoretischen Fundierung des Begriffs der ‚Fremdheit‘. Es beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Kontexte der Fremdwahrnehmung der Juden und geht auf die Bedeutung von Kultur und Identität in diesem Zusammenhang ein.
- Bestimmungsversuche jüdischer Identität und Kultur: Hier werden verschiedene Diskurse über jüdische Kultur analysiert, die als Mittel des Fremdmachens dienen können. Dazu zählen die Jüdischen Kulturtage in Berlin, die als Beispiel für einen exotiszierenden und folklorisierenden Diskurs dienen, sowie der Jüdische Raum als Projektionsfläche für Fremdheit und Identität.
- Das Phänomen der virtuellen jüdischen Kultur: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen und Implikationen einer virtuellen jüdischen Kultur. Es stellt dar, wie sich neue Kultur- und Identitätsentwürfe im virtuellen Raum entwickeln können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen ‚jüdische Kultur‘, ‚Fremdheit‘, ‚Identität‘, ‚Stereotypen‘, ‚Vorurteile‘, ‚Diskurs‘, ‚Konstruktion‘, ‚Shoah‘, ‚Deutschland‘ und ‚gesellschaftliche Wahrnehmung‘. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss von historischen und aktuellen Diskursen auf die Konstruktion von ‚jüdischer Kultur‘ in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was wird in der Arbeit über jüdische Kultur in Deutschland untersucht?
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von Fremdheit im Kontext gesellschaftlicher Diskurse über jüdische Kultur in Deutschland seit der Wiedervereinigung 1989.
Warum liegt der Fokus auf der Zeit nach 1989?
Seit dem Ende des Kalten Krieges und der Öffnung des "Eisernen Vorhangs" stieg die Zahl der in Deutschland lebenden Juden durch Einwanderung aus Osteuropa enorm an, was zu einem demographischen Wandel und neuen Identitätsdiskursen führte.
Welche Rolle spielt die Außenperspektive in dieser Untersuchung?
Die Arbeit fokussiert auf die nicht-jüdische Wahrnehmung, um zu zeigen, wie jüdische Kultur als Objekt einer exotisierenden und folklorisierenden Fremdwahrnehmung konstruiert wird.
Was ist mit dem Phänomen der "virtuellen jüdischen Kultur" gemeint?
Es beschreibt die mediale und gesellschaftliche (Re-)Produktion von Vorstellungen jüdischer Kultur, die oft auf Stereotypen basieren und als Spielfeld für neue Kultur- und Identitätsentwürfe dienen.
Welche Bedeutung haben die Jüdischen Kulturtage in Berlin für die Arbeit?
An diesem Beispiel wird analysiert, wie Selbstrepräsentation der jüdischen Gemeinde und gesellschaftliche Erwartungen aufeinandertreffen und sich wechselseitig beeinflussen.
- Arbeit zitieren
- Anja Kreienbrink (Autor:in), 2008, Die Konstruktion von Fremdheit am Beispiel gesellschaftlicher Diskurse über jüdische Kultur in Deutschland nach 1989, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179764