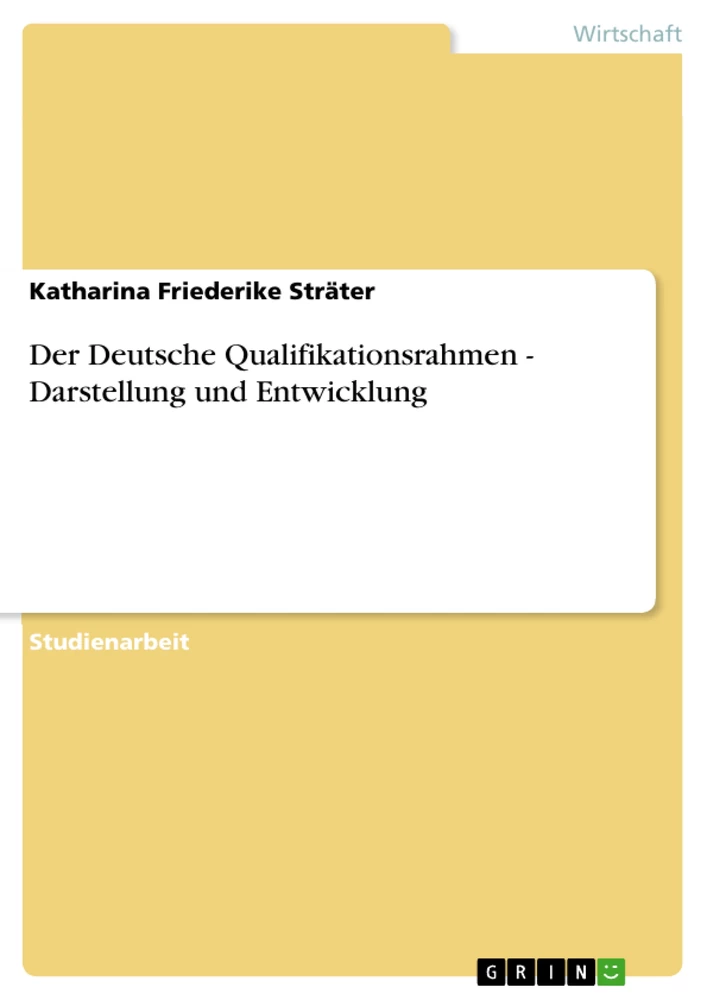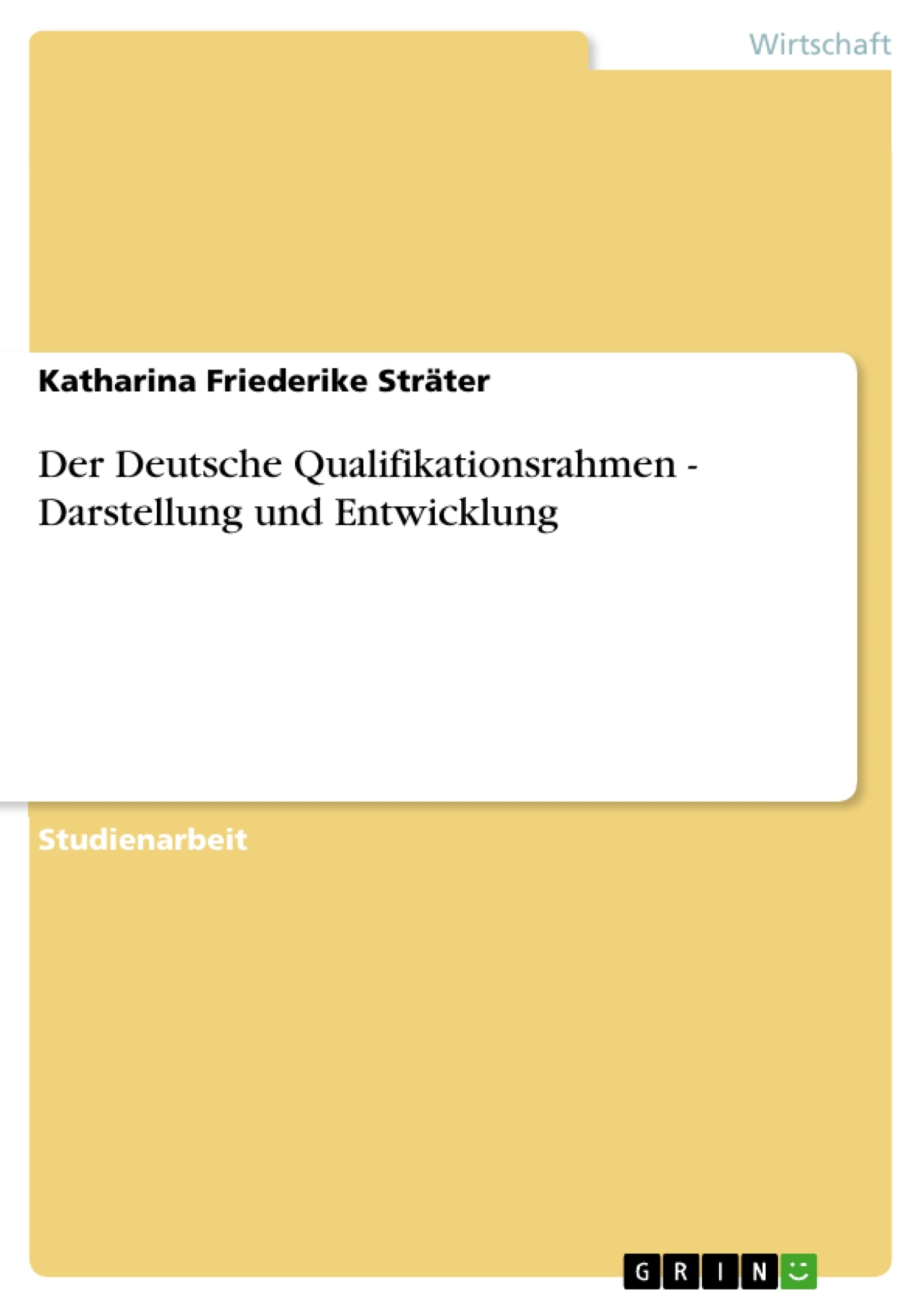Bildung ist in der heutigen Wissensgesellschaft zum wichtigsten Rohstoff geworden und ist gleichzeitig die Grundlage, auf der jeder Einzelne seine Zukunft aufbaut. Alle Mitglieder der Gesellschaft sollen Teil an ihr haben. Der Bildungserwerb beginnt in den Familien, setzt sich in Kindergärten und vorschulischen Einrichtungen, in allen Schulstufen und Schulformen sowie in den Hochschulen fort und endet eigentlich nie, wenn man das Schlagwort vom lebenslangen Lernen ernst nimmt.
Die ständig wachsende Bedeutung lebenslangen Lernens begründet sich auch aus den kurzen Innovationszyklen, welche für unsere heutige wettbewerbsbasierte Wissensgesellschaft charakteristisch sind.
Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) sowie der darauf aufbauende Entwicklungsprozess des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR) sind Ergebnisse aktueller bildungspolitischer Interaktionen mit dem Ziel, allumfassendes lebenslanges Lernen, Durchlässigkeit, Chancengleichheit und Mobilität zu ermöglichen.
Ziel der vorliegenden Seminararbeit ist es, den Deutschen Qualifikationsrahmen sowie seinen Entwicklungsprozess unter Berücksichtigung seiner Potenziale und Schwächen aus Sicht der verschiedenen Anspruchsgruppen darzustellen.
Der nach der ersten Erarbeitungsphase vorgelegte Diskussionsvorschlag eines Deutschen Qualifikationsrahmens soll den Schwerpunkt dafür bilden.
Die zweite Entwicklungsphase ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. Die Aufnahme einiger Aspekte der jüngsten Diskussionen in diese Arbeit sollen die Aktualität sowie die politische Brisanz des Themas noch einmal verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Abgrenzung der Themenstellung
- Definitionen
- Der Europäische Qualifikationsrahmen
- Der Deutsche Qualifikationsrahmen
- Ziele und Forderungen
- Erarbeitungsphase I
- Diskussionsvorschlag
- Erarbeitungsphase II
- Kritik und aktuelle Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit zielt darauf ab, den Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) und seinen Entwicklungsprozess darzustellen und zu analysieren. Dabei werden sowohl Potenziale als auch Schwächen aus der Perspektive verschiedener Anspruchsgruppen beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf dem Diskussionsvorschlag nach der ersten Erarbeitungsphase. Die Einbeziehung aktueller Diskussionen soll die Relevanz und Brisanz des Themas verdeutlichen.
- Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) und seine Ziele
- Der Entwicklungsprozess des DQR: Phasen und Herausforderungen
- Die Rolle verschiedener Anspruchsgruppen im DQR-Prozess
- Kritikpunkte und aktuelle Diskussionen zum DQR
- Der DQR im Kontext des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR)
Zusammenfassung der Kapitel
Abgrenzung der Themenstellung: Die Arbeit untersucht den Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) für lebenslanges Lernen im Kontext der wachsenden Bedeutung von Bildung in der Wissensgesellschaft und den kurzen Innovationszyklen. Sie beleuchtet die Ziele des DQR, Durchlässigkeit, Chancengleichheit und Mobilität zu ermöglichen, und fokussiert auf den Diskussionsvorschlag nach der ersten Erarbeitungsphase, sowie aktuelle Diskussionen in der zweiten Phase. Die Arbeit analysiert den DQR unter Berücksichtigung seiner Potenziale und Schwächen aus Sicht der verschiedenen Anspruchsgruppen.
Definitionen: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie „Fertigkeiten“, „formelles Lernen“, „informelles Lernen“ und „Lernergebnisse“. Es definiert Fertigkeiten als die Fähigkeit, Wissen anzuwenden und Probleme zu lösen, unterteilt in kognitive und praktische Fertigkeiten. Formelles Lernen wird als die organisierte Vermittlung festgelegter Lerninhalte und -ziele beschrieben, während informelles Lernen unbeabsichtigt erfolgt. Lernergebnisse werden als das Wissen, Verstehen und Können nach Abschluss eines Lernprozesses definiert. Diese Definitionen bilden die Grundlage für das Verständnis des DQR.
Der Europäische Qualifikationsrahmen: Dieses Kapitel (nicht im Auszug enthalten) würde vermutlich den europäischen Kontext des DQR erläutern und dessen Einbettung in ein übergeordnetes europäisches System darstellen. Die Bedeutung der Vergleichbarkeit und der internationalen Anerkennung von Qualifikationen würde hier eine zentrale Rolle spielen.
Der Deutsche Qualifikationsrahmen: Dieser Abschnitt befasst sich umfassend mit dem DQR. Unterkapitel wie "Ziele und Forderungen", "Erarbeitungsphase I", "Diskussionsvorschlag", "Erarbeitungsphase II", und "Kritik und aktuelle Diskussion" werden synthetisiert. Die Zusammenfassung würde die verschiedenen Phasen der Entwicklung, die beteiligten Akteure, die zentralen Ziele und die Herausforderungen des Prozesses analysieren. Die Kritikpunkte und die aktuelle Diskussion würden den aktuellen Stand des DQR und seine Weiterentwicklung beleuchten, die unterschiedlichen Perspektiven der Anspruchsgruppen einbeziehend.
Schlüsselwörter
Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR), Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR), lebenslanges Lernen, Bildung, Qualifikation, Chancengleichheit, Durchlässigkeit, Wissensgesellschaft, Erarbeitungsprozess, Kritik, Diskussion.
FAQ: Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) - Seminararbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert den Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) und seinen Entwicklungsprozess. Sie beleuchtet sowohl Potenziale als auch Schwächen des DQR aus der Perspektive verschiedener Anspruchsgruppen, mit besonderem Fokus auf den Diskussionsvorschlag nach der ersten Erarbeitungsphase und aktuellen Diskussionen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Abgrenzung der Themenstellung, Definitionen relevanter Begriffe (Fertigkeiten, formelles/informelles Lernen, Lernergebnisse), den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR), den DQR (inklusive Ziele, Forderungen, Erarbeitungsphasen I & II, Kritik und aktuelle Diskussionen) und ein abschließendes Fazit.
Was sind die Ziele der Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, den DQR und seinen Entwicklungsprozess darzustellen und zu analysieren. Sie möchte Potenziale und Schwächen aufzeigen und die Relevanz und Brisanz des Themas durch Einbeziehung aktueller Diskussionen verdeutlichen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in Kapitel zu: Abgrenzung der Themenstellung, Definitionen, den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR - Zusammenfassung nur angedeutet), den Deutschen Qualifikationsrahmen (mit Unterkapiteln zu Zielen, Forderungen, Erarbeitungsphasen, Kritik und Diskussion) und einem Fazit.
Wie wird der DQR in der Seminararbeit analysiert?
Der DQR wird im Kontext von lebenslangem Lernen, der Wissensgesellschaft und den Herausforderungen durch kurze Innovationszyklen analysiert. Die Arbeit untersucht die Ziele des DQR (Durchlässigkeit, Chancengleichheit, Mobilität) und berücksichtigt die Perspektiven verschiedener Anspruchsgruppen.
Welche Definitionen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie „Fertigkeiten“ (kognitive und praktische Fähigkeiten), „formelles Lernen“ (organisierte Vermittlung von Lerninhalten), „informelles Lernen“ (unbeabsichtigtes Lernen) und „Lernergebnisse“ (Wissen, Verstehen und Können nach einem Lernprozess).
Welche Rolle spielt der EQR in der Seminararbeit?
Der EQR wird im Kontext des DQR behandelt, um den europäischen Kontext des deutschen Rahmens und die Bedeutung von Vergleichbarkeit und internationaler Anerkennung von Qualifikationen aufzuzeigen. Eine detaillierte Darstellung des EQR ist jedoch nicht Teil des vorliegenden Auszugs.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR), Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR), lebenslanges Lernen, Bildung, Qualifikation, Chancengleichheit, Durchlässigkeit, Wissensgesellschaft, Erarbeitungsprozess, Kritik, Diskussion.
Was ist der Schwerpunkt der Seminararbeit?
Der Schwerpunkt liegt auf dem Diskussionsvorschlag nach der ersten Erarbeitungsphase des DQR und der Einbeziehung aktueller Diskussionen, um die Relevanz und Brisanz des Themas zu verdeutlichen.
- Arbeit zitieren
- Katharina Friederike Sträter (Autor:in), 2010, Der Deutsche Qualifikationsrahmen - Darstellung und Entwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179834