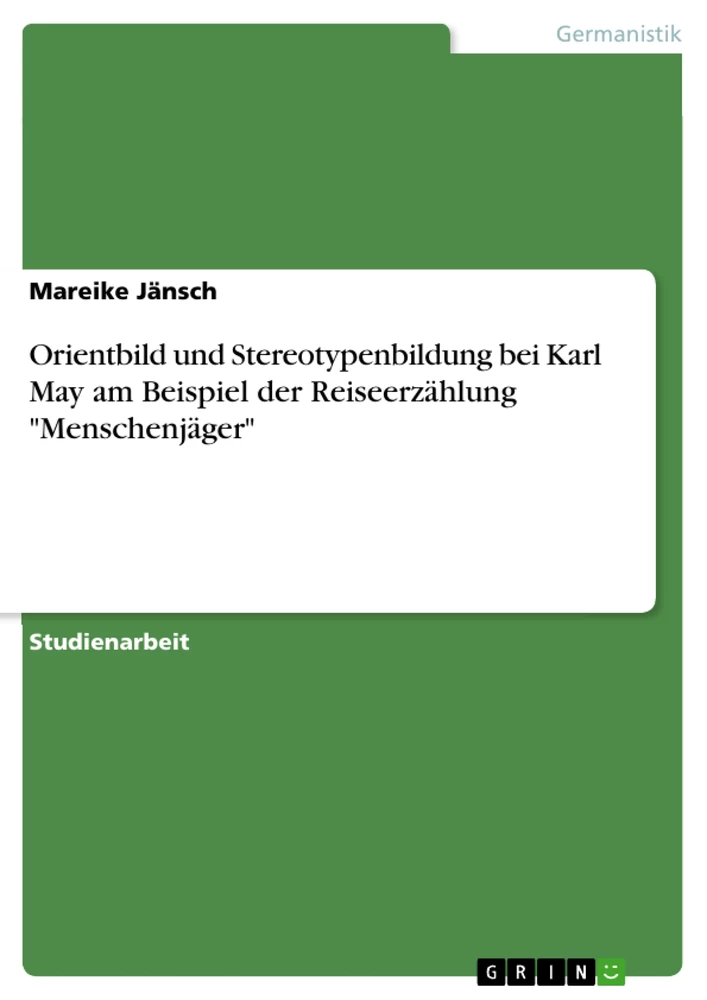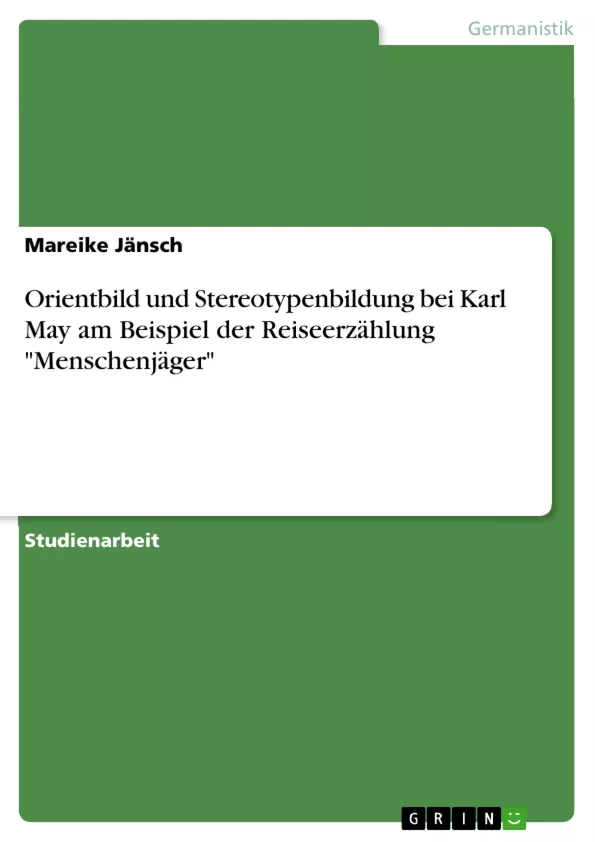Der Begriff Orient weckt kindliche Fantasien von fernen Ländern, von Menschen, die aussehen, als wären sie den Märchen aus Tausend und einer Nacht entstiegen. „Da ziehen Karawanen über gelbe Sanddünen, da sprengen Beduinen auf ihren Araberhengsten heran und werfen sich auf ihren Teppichen zum Gebet nieder, da tanzen schöne Frauen mit goldbereiften Füßen zwischen Springbrunnen auf kostbaren Teppichen vor patriarchalischen Sultanen [...] oder ruhen auf seidenen Kissen während schwarze Sklavinnen ihnen Luft zu fächeln“1, alles glänzt golden, die Luft ist warm und trägt den Duft verschiedenster exotischer Gewürze mit sich.
Dieses Bild vom Orient ist naiv-europäisch, geprägt durch Geschichten und Filme, welche immer ein sehr einseitiges Bild von der Welt und den Menschen südöstlich von Europa zeigen. Der Begriff Orient wird meist weniger in einem politischen oder geografischen sondern eher in einem religiös-kulturellen Sinne verwendet.2
Bildende Kunst, Malerei und Literatur wurden durch die Epochen von orientalischen Vorbildern geprägt und inspiriert. Einen Höhepunkt erreichte diese Inspiration durch die Wiederentdeckung der Altorientalischen Kulturen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der sich hier in der Kunst manifestierende, europäisch koloniale Blick auf den Orient prägt bis heute das westliche Bild des Nahen Ostens.
Wie kam der Schriftsteller Karl May dazu, einen solch großen Beitrag zu einem so nachhaltig wirkenden Orientbild zu leisten? Welche Intention verfolgte Karl May und welche Stereotypen erschuf er in seinen Romanen, die sich bis heute prägend auf die Vorstellung vom Orient auswirken? Im Folgenden werden der Mensch Karl May und sein Bezug zum Orient betrachtet. Am Roman Menschenjäger3 wird exemplarisch Karl Mays Blick auf die Religionen Islam und Christentum untersucht. Weiterhin werden das im Roman dargestellte Bild des Schwarzen und die Sklaverei thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Karl May
- Der Schriftsteller und seine Leserschaft
- Karl Mays Orientbild
- Im Lande des Mahdi
- Menschenjäger
- Christentum und Islambild
- Das Bild des Schwarzen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Orients im Werk von Karl May, wobei der Fokus auf der Reiseerzählung „Menschenjäger“ liegt. Ziel ist es, die Entstehung und Wirkung von Stereotypen im Kontext der orientalischen Kultur und Religionen zu analysieren und die Rolle von Karl May bei der Konstruktion des europäischen Orientbildes zu beleuchten.
- Die Entstehung des europäischen Orientbildes und seine Einflüsse
- Karl Mays Orientbild und seine literarische Umsetzung
- Die Darstellung von Religionen im Werk von Karl May
- Die Stereotypisierung von Schwarzen und Sklaverei
- Die Bedeutung von Karl Mays Werk für die Rezeption des Orients in der europäischen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung definiert den Begriff „Orient“ und zeichnet die historische Entwicklung seiner Bedeutung nach, wobei die prägenden Einflüsse auf das europäische Orientbild hervorgehoben werden.
- Kapitel 2 gibt Einblicke in das Leben von Karl May und skizziert seine frühen Einflüsse, die seine literarische Karriere prägten. Dabei wird der Fokus auf die Entstehung seiner Fantasie gelegt und die Bedeutung seiner Kindheitserfahrungen für seine späteren Werke erörtert.
- Kapitel 3 analysiert die Reiseerzählung „Menschenjäger“ im Detail. Dabei werden die im Roman dargestellten Bilder von Christentum und Islam, die Repräsentation des Schwarzen und die Thematik der Sklaverei untersucht.
Schlüsselwörter
Karl May, Orient, Stereotyp, Orientalismus, Christentum, Islam, Schwarze, Sklaverei, Reiseerzählung, „Menschenjäger“
Häufig gestellte Fragen
Wie prägte Karl May das europäische Bild vom Orient?
Karl May erschuf durch seine Reiseerzählungen ein romantisiertes und oft klischeehaftes Bild des Orients, das Generationen von Lesern nachhaltig beeinflusste.
Worum geht es in Karl Mays Erzählung „Menschenjäger“?
Der Roman thematisiert die Verfolgung von Sklavenhändlern im Sudan und setzt sich mit religiösen und kulturellen Konflikten auseinander.
Wie stellt Karl May das Verhältnis zwischen Islam und Christentum dar?
In seinen Werken zeigt May oft eine eurozentrische Sicht, in der christliche Werte als moralisch überlegen dargestellt werden, während der Islam oft durch Stereotypen charakterisiert wird.
Welche Stereotypen finden sich in Bezug auf Schwarze in seinen Werken?
Die Arbeit analysiert, wie Karl May zeitgenössische rassistische Vorurteile und das Bild des „edlen Wilden“ oder des zu rettenden Sklaven in seine Geschichten integrierte.
War Karl May jemals selbst im Orient, bevor er darüber schrieb?
Nein, Karl May verfasste seine berühmtesten Orient-Romane basierend auf seiner Fantasie und Reiseberichten anderer, bevor er die Region erst viel später tatsächlich besuchte.
- Citar trabajo
- Mareike Jänsch (Autor), 2011, Orientbild und Stereotypenbildung bei Karl May am Beispiel der Reiseerzählung "Menschenjäger", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179998