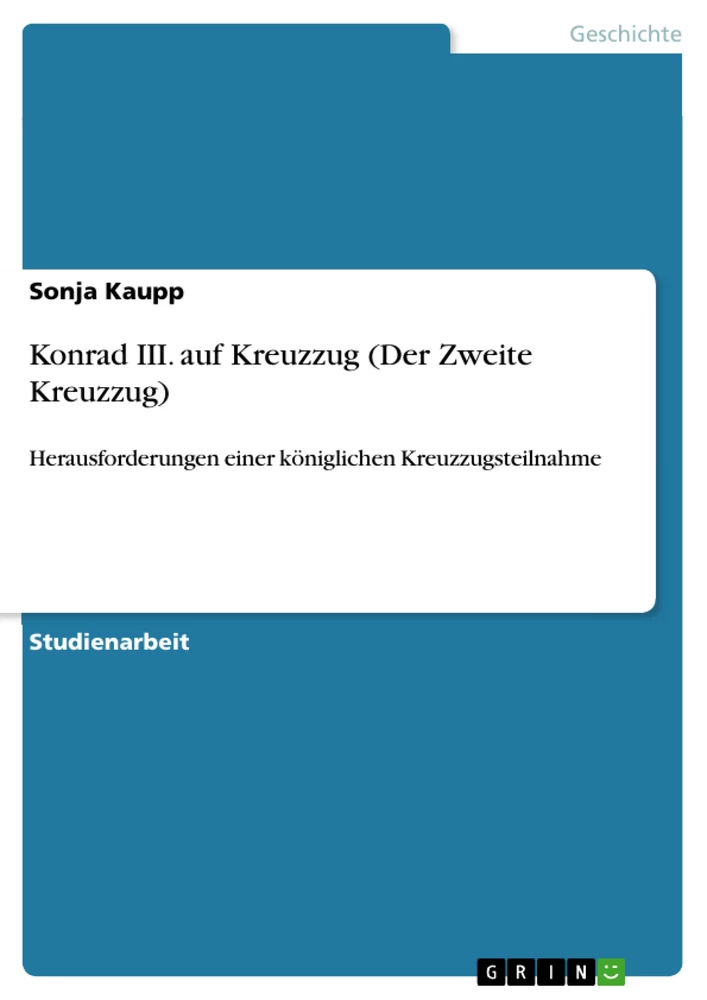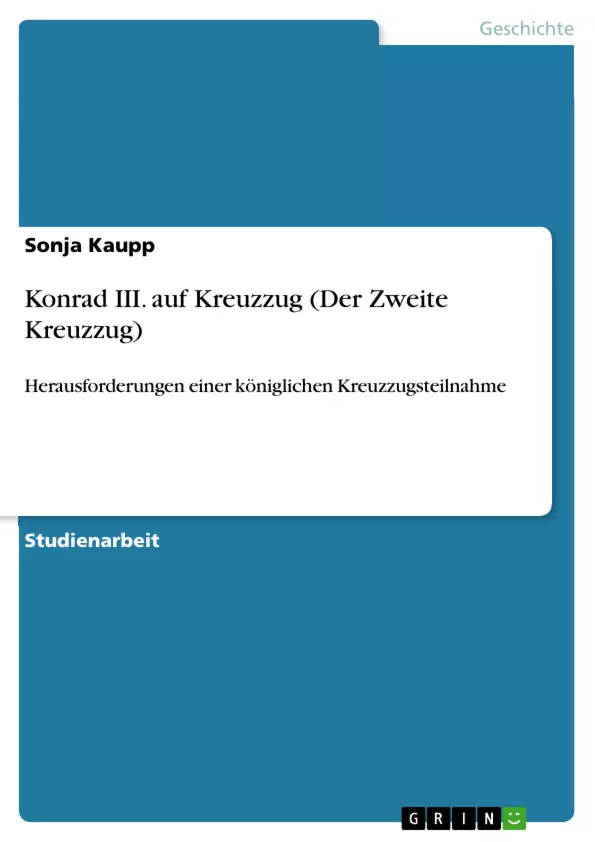Konrad III. war der erste deutsche König, der das Kreuz nahm: Zusammen mit dem französischen König Ludwig nahm er am Zweiten Kreuzzug von 1147-1149 teil. Im Gegensatz zum gemeinen Kreuzfahrer hatte er sich nicht nur um die üblichen Kreuzzugsvorkehrungen zu kümmern, sondern auch um die Verflechtung eines Kreuzzuges mit der Innen- und Europapolitik.
Mit Welf VI. hatte er sich einen Feind gemacht, der seine Abwesenheit sicherlich ausnutzen würde und falls er im Osten sterben sollte, konnte er sich auch nicht mehr um eine Nachfolgeregelung kümmern. Zudem benötigte Papst Eugen III. in Italien seine Hilfe, da er aus Rom vertrieben worden war. All diese Dinge musste er vor seiner Abreise klären, sodass diese Zeit die eigentliche Herausforderung darstellte. Was auf dem langen Weg in Heilige Land passieren würde, das lag ganz allein in Gottes Hand - doch für sein Reich war er verantwortlich.
In dieser Arbeit soll nun untersucht werden, was Konrad zur Kreuznahme veranlasste, wie der Konflikt mit Welf VI. entstanden war und sich entwickelt hatte, und was der König unternahm, um sein Reich trotz dieser Fehde und trotz des Anliegens des Papstes mit gutem Gewissen verlassen zu können. Dabei soll auch die diplomatische Rolle Bernhard von Clairvaux’ näher untersucht werden, der sowohl Welf als auch Konrad zur Kreuznahme bewegte.
Bei der Quellenarbeit wurde sowohl eine Stauferchronik als auch eine der Welfen berücksichtigt, zudem eine Schrift von Bernhard von Clairvaux. Die Quellen sollen an dieser Stelle kurz vorgestellt werden.
Es liegen uns zunächst die Gesta Frederici von Otto von Freising vor, der selbst am Zweiten Kreuzzug teilgenommen hat und diese Chronik auf Wunsch von Friedrich Barbarossa schrieb. Sie enthält unter anderem den Kreuzzugsaufruf von Bernhard von Clairvaux, der in dieser Arbeit der Kreuzzugsbulle von Papst Eugen III. gegenüberstellt werden soll, die nach ihren Anfangsworten Quantum praedecessores benannt ist.
Die von Bernhard von Clairvaux selbst verfasste fünfbändige Schrift De consideratione wurde auf Drängen von seinem Ordensbruder Papst Eugen III. von 1149 bis 1153 verfasst und sollte dem Papst zur Gewissensforschung dienen.
Die Historia Welforum, um 1170 entstanden, zeigt die Geschichte aus der Perspektive des welfischen Adelgeschlechts, welches sich oft in Konflikt mit den Staufern befand.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation
- Situation in der Levante nach dem Ersten Kreuzzug
- Konrad III. und die Welfen
- Konrad III. und Papst Eugen III.
- Vom Aufruf zur Kreuznahme
- Kreuzzugsbulle
- Bernhard von Clairvaux
- Kreuznahme und diplomatische Vorbereitungen
- Verlauf des Kreuzzuges
- Ergebnis des Kreuzzugs und Reaktionen
- Konrads Verhältnis zu Eugen III. und Welf VI. nach dem Kreuzzug
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Herausforderung, die Konrads III. Teilnahme am Zweiten Kreuzzug für den deutschen König darstellte. Sie untersucht die Motivationen Konrads, den Konflikt mit Welf VI. und die diplomatischen Vorbereitungen, die er vor seiner Abreise ins Heilige Land treffen musste.
- Konrads Motivation zur Kreuznahme
- Der Konflikt mit Welf VI.
- Die Rolle von Papst Eugen III. und Bernhard von Clairvaux
- Diplomatische Vorbereitungen für den Kreuzzug
- Konrads Verantwortung für sein Reich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den Kontext von Konrads Kreuzzug dar. Das zweite Kapitel analysiert die Ausgangssituation im Heiligen Land und die innenpolitischen Herausforderungen, denen Konrad in Deutschland gegenüberstand. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Aufruf zur Kreuznahme, der Kreuzzugsbulle und der Rolle von Bernhard von Clairvaux.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Kreuzzug, Staufer, Welfen, Papst Eugen III., Bernhard von Clairvaux, Konrad III., Deutschland, Italien, Heilige Land, Levante, Innenpolitik, Diplomatie.
- Arbeit zitieren
- Sonja Kaupp (Autor:in), 2009, Konrad III. auf Kreuzzug (Der Zweite Kreuzzug), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180016