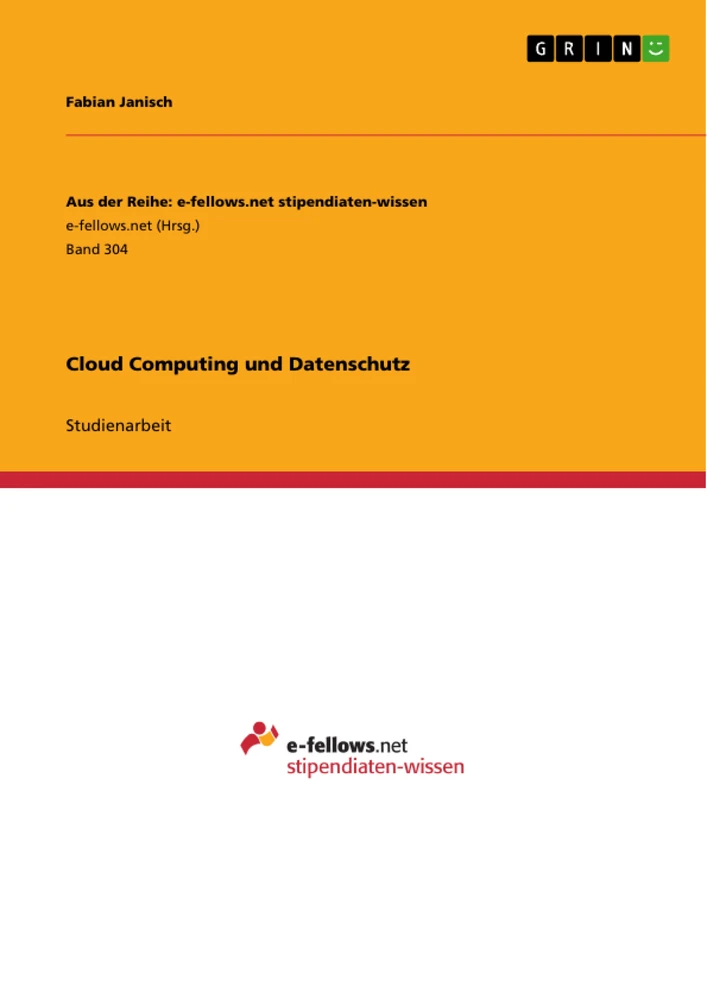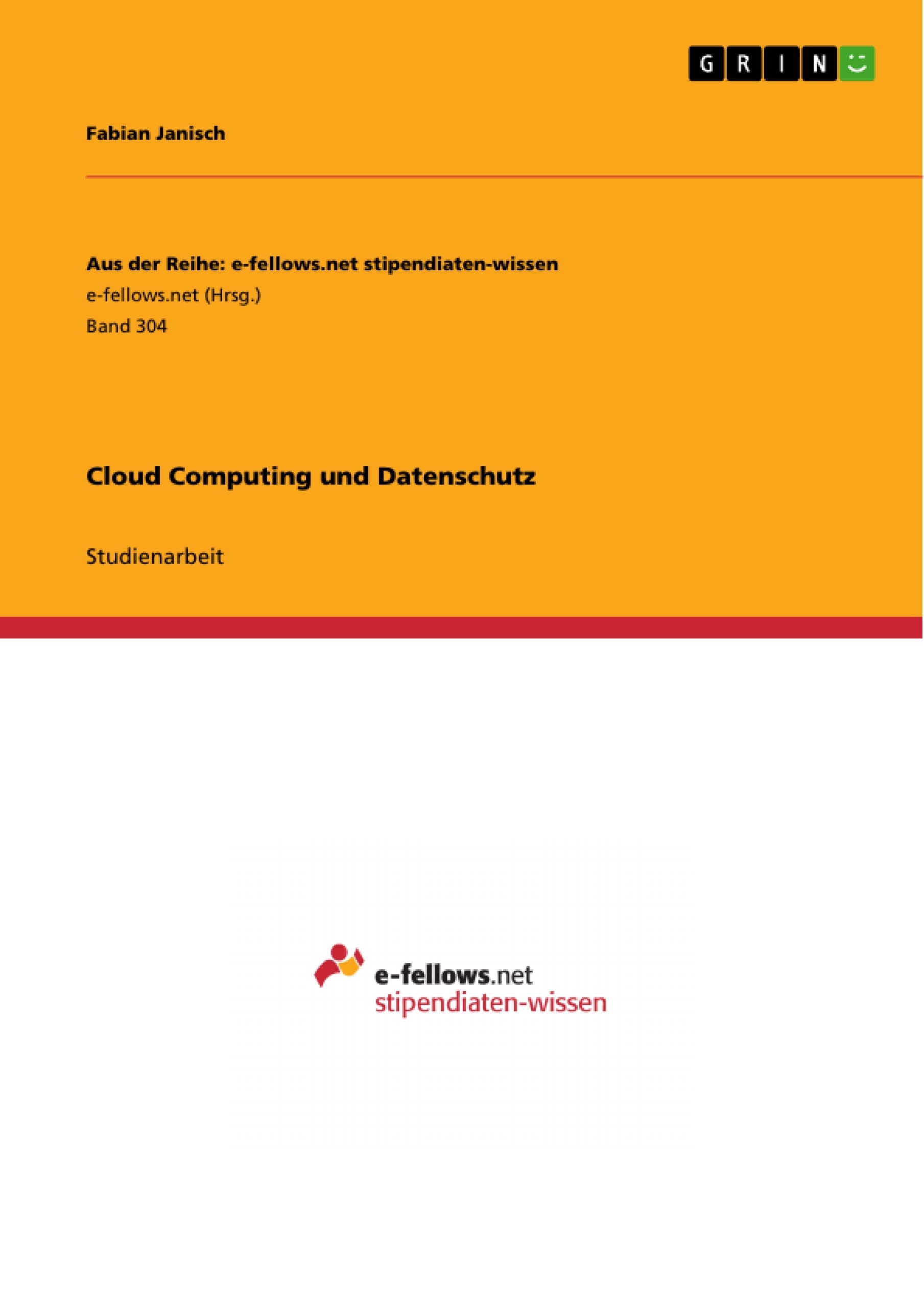Cloud Computing – so heißt der aktuellste Trend der IT-Branche. Steve Ballmer und Rene Obermann bestätigten dies erst wieder auf der „Internationalen Cloud Computing Conference“ in Köln, am 6. Oktober 2010. Die aus den USA kommende Entwicklung setzt sich zunehmend auch in Deutschland durch. Dennoch bestehen derzeit rechtliche Probleme, insbesondere in Bezug zur Sicherheit und zum Datenschutz. Letzteres soll hier Gegenstand der Untersuchung sein. Die folgende Ausarbeitung wird sich primär auf Ausführungen zum Bundesdatenschutzgesetzt (BDSG) beschränken. Dabei wird schwerpunktmäßig die Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Cloud Computing – Was ist das?
- I. Begriffserläuterung
- II. Die verschiedenen Konzepte des Cloud Computing
- 1. Technische Konzepte
- a) Infrastructure as a Service (IaaS)
- b) Platform as a Service (PaaS)
- c) Software as a Service (SaaS)
- d) Abgrenzung
- 2. Organisationsformen
- C. Datenschutz und Cloud Computing
- I. Anwendbarkeit des BDSG
- 1. Anwendbarkeit des Datenschutzrechtes generell
- 2. Anwendbarkeit des nationalen Datenschutzrechts (BDSG)
- 3. Zwischenergebnis
- II. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, § 4 Abs. 1 BDSG
- 1. Privilegierung durch Auftragsverarbeitung, § 11 BDSG
- a) Anwendbarkeit
- aa) Cloud Anbieter als Dienstebanbieter i.S.d. TKG
- bb) Cloud Computing als Telemdien i.S.d. TMG
- cc) Sonstige bereichsspezifische Vorschriften und Zulässigkeitsschranken
- b) Voraussetzungen
- aa) Personenbezogene Daten
- bb) Im Auftrag (Weisungsabhängigkeit, § 11 Abs. 3 BDSG)
- (1) Abgrenzung
- (a) Noch keine Auftragsverarbeitung
- (b) Bereits eine Funktionsübertragung
- (2) Gegenstand und Inhalt des Auftrages
- (a) Nr. 1: Gegenstand und Dauer
- (b) Nr. 2: Umfang, Art und Zweck
- (c) Nr. 3: Datensicherheitsmaßnahmen, § 9 BDSG
- (d) Nr. 4: Berichtigung, Löschung und Sperrung
- (e) Nr. 5: Pflichten des Auftragnehmers
- (f) Nr. 6: Unterauftragsverhältnisse
- (g) Nr. 7: Kontrollrechte des Auftraggebers
- (h) Nr. 8: Mitteilungspflichten
- (i) Nr. 9: Umfang der Weisungsbefugnis
- (j) Nr. 10: Rückgabepflicht in Bezug auf überlassene Datenträger
- (3) Sonstige Pflichten des Auftraggebers
- (4) Zusammenfassung
- cc) Durch andere Stellen
- (1) Öffentliche Stellen (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BDSG)
- (2) Nicht-öffentliche Stellen (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BDSG)
- dd) Erheben, verarbeiten oder nutzen
- ee) Kein Dritter (§ 3 Abs. 8 BDSG)
- c) Zwischenergebnis
- 2. Andere Erlaubnisnormen
- a) Einwilligung
- b) Gesetzliche Erlaubnistatbestände
- III. Lösungsvorschläge
- 1. Problem: Internationalität
- a) Cloud Computing nur im EU/EWR-Bereich
- b) Analoge Anwendung des § 11 BDSG
- aa) Planwidrige Regelungslücke
- bb) Vergleichbare Interessenlage
- cc) Zwischenergebnis
- c) Ergebnis für die Internationalität
- 2. Problem: Vereinbarkeit mit dem BDSG
- D. Fazit
- Definition und Konzepte des Cloud Computing
- Anwendbarkeit des BDSG auf Cloud Computing
- Herausforderungen des Datenschutzes im Kontext der Internationalität von Cloud-Diensten
- Lösungsvorschläge und rechtliche Handlungsempfehlungen
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
- Kapitel A: Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Cloud Computing und Datenschutz im Kontext der digitalen Transformation dar. Sie liefert eine kurze Übersicht über die Forschungsfrage und die Gliederung der Arbeit.
- Kapitel B: Cloud Computing - Was ist das?: Dieses Kapitel erläutert grundlegende Definitionen und Konzepte des Cloud Computing. Es werden verschiedene Arten von Cloud-Diensten und deren Funktionsweisen vorgestellt, einschließlich der Unterscheidung zwischen IaaS, PaaS und SaaS.
- Kapitel C: Datenschutz und Cloud Computing: Dieses Kapitel analysiert die Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) auf Cloud Computing. Es wird untersucht, inwiefern Cloud-Dienste in den Geltungsbereich des BDSG fallen und welche datenschutzrechtlichen Anforderungen an Cloud-Anbieter gestellt werden. Hierbei werden insbesondere die Vorschriften zur Auftragsverarbeitung nach § 11 BDSG und die Problematik der Internationalität von Cloud-Diensten beleuchtet.
- Kapitel D: Fazit: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet eine abschließende Bewertung der Anwendbarkeit des BDSG auf Cloud Computing. Es werden auch mögliche Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Nutzer von Cloud-Diensten formuliert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Cloud Computing und Datenschutz. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung von Cloud Computing im Hinblick auf den Datenschutz, insbesondere unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Ziel ist es, die Anwendbarkeit des BDSG auf Cloud Computing zu untersuchen und mögliche rechtliche Probleme aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Cloud Computing, Datenschutz, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Auftragsverarbeitung, Internationalität, Telekommunikationsgesetz (TKG), Telemediengesetz (TMG), Datenschutzrecht, IT-Sicherheit, Rechtliche Rahmenbedingungen, Datensicherheit, Rechtliche Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche rechtlichen Grundlagen gelten für Cloud Computing und Datenschutz?
Primär ist das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) maßgeblich, insbesondere die Vorschriften zur Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG.
Was ist der Unterschied zwischen IaaS, PaaS und SaaS?
IaaS bietet Infrastruktur, PaaS eine Plattform für Entwickler und SaaS fertige Softwareanwendungen über die Cloud. Jedes Modell hat unterschiedliche datenschutzrechtliche Implikationen.
Welche Probleme verursacht die Internationalität von Cloud-Diensten?
Da Daten oft auf Servern außerhalb der EU/EWR gespeichert werden, entstehen Konflikte bei der Anwendbarkeit nationalen Rechts und der Sicherstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus.
Was muss ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung (§ 11 BDSG) enthalten?
Er muss unter anderem den Gegenstand und die Dauer des Auftrags, den Umfang der Datenverarbeitung, technische Datensicherheitsmaßnahmen (§ 9 BDSG) und Kontrollrechte des Auftraggebers festlegen.
Sind Cloud-Anbieter Diensteanbieter im Sinne des TKG oder TMG?
Die Arbeit prüft die Abgrenzung, ob Cloud-Dienste als Telekommunikationsdienste (TKG) oder Telemedien (TMG) einzustufen sind, was Einfluss auf die anzuwendenden Sicherheitsvorschriften hat.
- Quote paper
- Fabian Janisch (Author), 2011, Cloud Computing und Datenschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180223