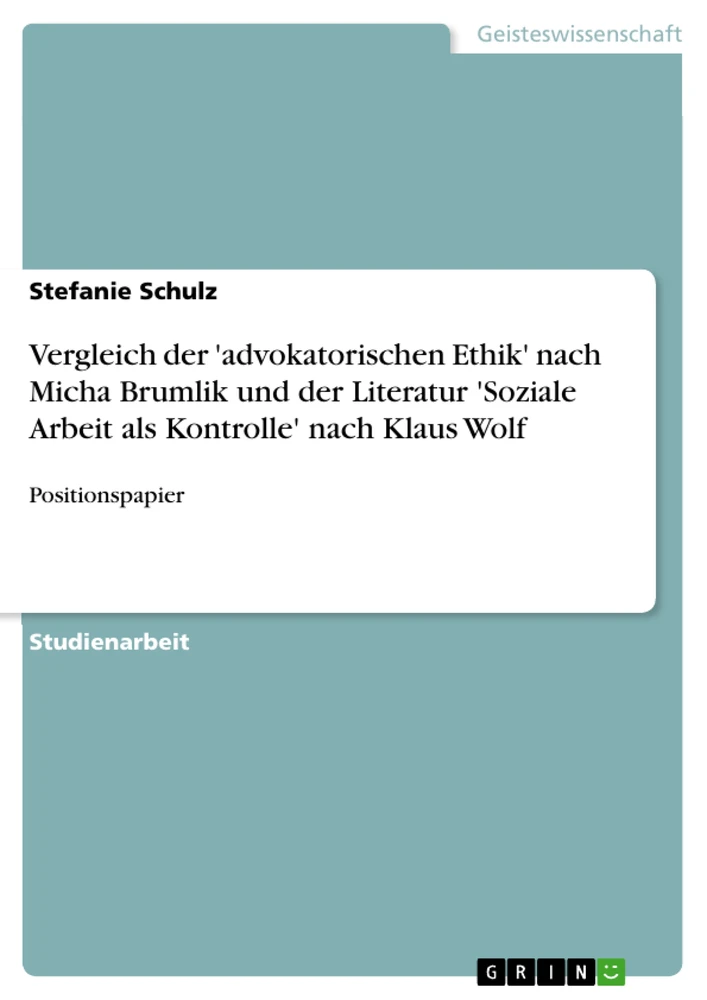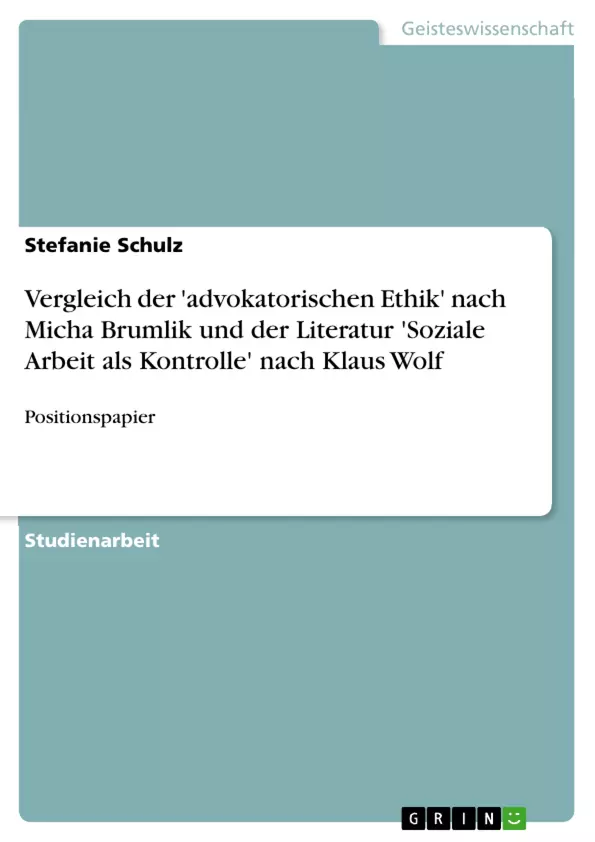Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Soziale Arbeit als Kontrolle? Dirty Work oder Kontrolle als Ressource? Zum Profil einer sozialpädagogischen legitimierten Kontrolle
3. Integrität und Mündigkeit. Ist eine advokatorische Ethik möglich?
4. Vergleich der beiden Quellen
5. Thesen
„Man hilft Menschen nicht, wenn man für sie tut, was sie selbst können“
Abraham Lincoln
1. Einleitung
Dieses Zitat beschreibt die Thematik, die in dem folgenden Posititionspapier bearbeitet werden soll. In dieser Seminararbeit wird die Frage erörtert, in wie weit die soziale Kontrolle ein Entmündigen der betroffenen Personen bewirkt oder ob diese Kontrolle als eine Möglichkeit zur Förderung der Selbstbestimmung der Klienten angesehen werden kann.
Im ersten Teil werden die Texte von Klaus Wolf „Soziale Arbeit als Kontrolle? Dirty Work oder Kontrolle als Ressource? Zum Profil einer sozialpädagogischen legitimierten Kontrolle“ und Micha Brumlik „Integrität und Mündigkeit. Ist eine advokatorische Ethik möglich?“ vorgestellt und die Positionen der Verfasser herausgearbeitet. Im zweiten Teil sollen die beiden Texte miteinander verglichen, Thesen und Kritik meinerseits angemerkt und zugleich ein Bezug zu der Sozialen Arbeit hergestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Arbeit als Kontrolle? Dirty Work oder Kontrolle als Ressource? Zum Profil einer sozialpädagogischen legitimierten Kontrolle
- Integrität und Mündigkeit. Ist eine advokatorische Ethik möglich?
- Vergleich der beiden Quellen
- Thesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern soziale Kontrolle eine Entmündigung der betroffenen Personen bewirkt oder ob diese Kontrolle als eine Möglichkeit zur Förderung der Selbstbestimmung der Klienten angesehen werden kann.
- Die Rolle der sozialen Kontrolle in der Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung von Empowerment und Selbstbestimmung
- Die ethischen Herausforderungen der sozialpädagogischen Kontrolle
- Das Verhältnis zwischen Betreuer und Klient
- Die Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik des Positionspapiers vor und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Sie erläutert die Relevanz der Frage, ob soziale Kontrolle entmündigt oder zur Selbstbestimmung beitragen kann.
- Soziale Arbeit als Kontrolle? Dirty Work oder Kontrolle als Ressource?: Dieser Abschnitt analysiert die Position von Klaus Wolf, der die kontroverse Rolle der Kontrolle in der Sozialen Arbeit beleuchtet. Wolf argumentiert, dass Kontrolle in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit notwendig ist, aber gleichzeitig das Risiko birgt, die Selbstbestimmung des Klienten zu untergraben. Er betont die Bedeutung von Empowerment und Ressourcenaktivierung, aber auch die Herausforderungen, die sich aus dem Experten-Laien-Verhältnis ergeben.
- Integrität und Mündigkeit. Ist eine advokatorische Ethik möglich?: Dieser Abschnitt behandelt die Position von Micha Brumlik, der sich mit der Frage der advokatorischen Ethik in der Sozialen Arbeit auseinandersetzt. Brumlik diskutiert die Bedeutung von Integrität und Mündigkeit für die Klienten und die Rolle des Sozialarbeiters als Verfechter ihrer Interessen.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Kontrolle, Selbstbestimmung, Empowerment, Ressourcenaktivierung, Beziehungsgestaltung, Integrität, Mündigkeit, advokatorische Ethik, Experten-Laien-Verhältnis, erlernte Hilflosigkeit.
- Citation du texte
- Stefanie Schulz (Auteur), 2011, Vergleich der 'advokatorischen Ethik' nach Micha Brumlik und der Literatur 'Soziale Arbeit als Kontrolle' nach Klaus Wolf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180241