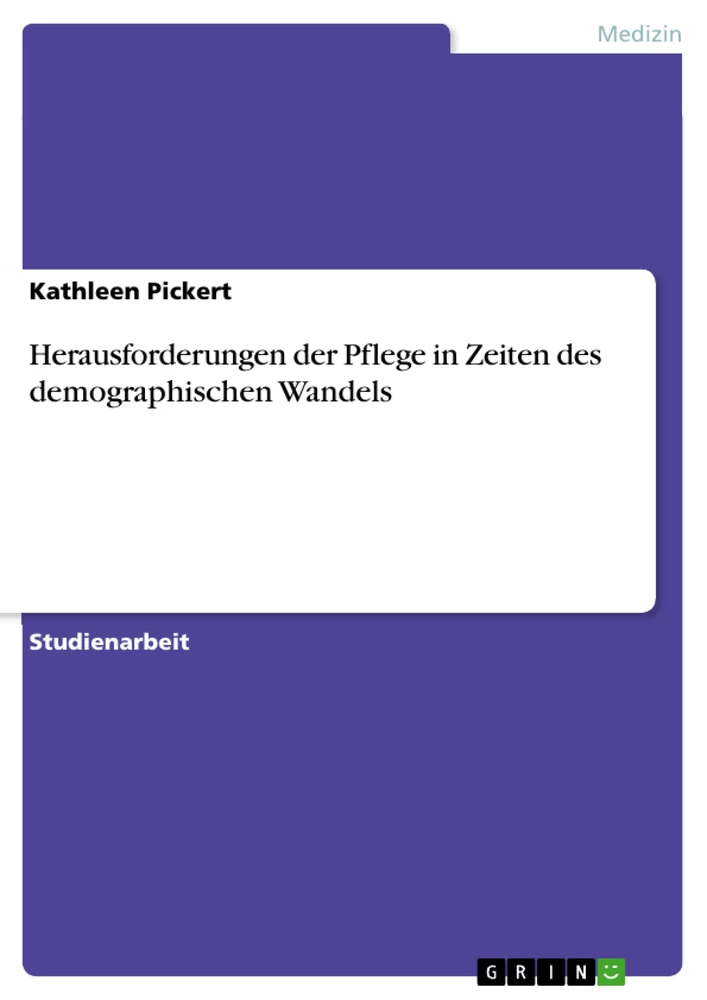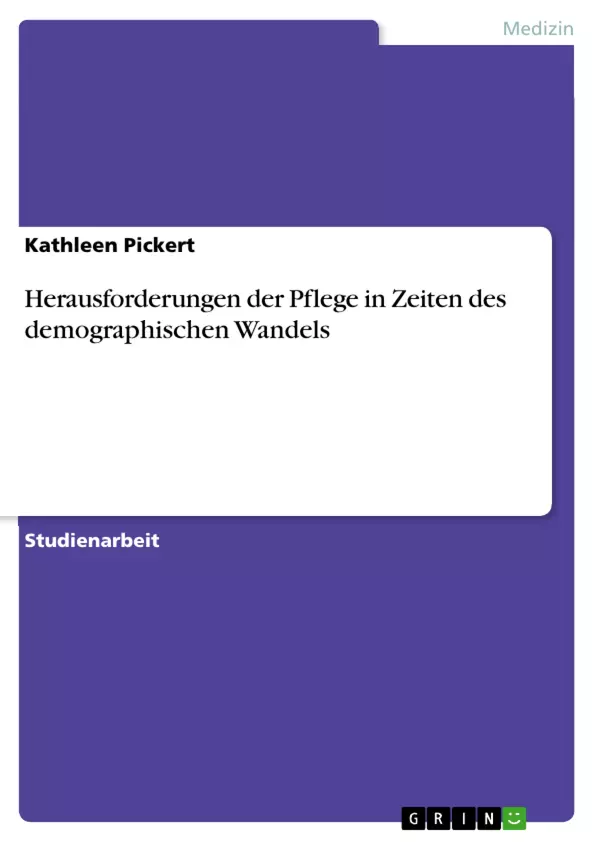Der demographische Wandel und dessen Folgen für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft sind allgegenwärtig. Schlagworte wie „Vergreisung der Gesellschaft“, „ Demographische Bombe“ oder „Pflegeheim Deutschland“ beherrschen die Medien. Mit der Debatte um diese Materie rücken ebenfalls die Pflege, sowie die Herausforderungen der demographischen Bevölkerungsentwicklung an diese, ins öffentliche Bewusstsein. Bereits seit geraumer Zeit werden die Auswirkungen unserer alternden Gesellschaft auf die Finanzierung der Pflegeversicherung, auf den Pflegeberuf, auf die Pflegeeinrichtungen und auf das Pflegepersonal diskutiert und analysiert. Die Aktualität dieser Thematik gaben mir den Anstoß mich mit der Frage nach den Herausforderungen des demographischen Wandels auf die Pflege auseinanderzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- MOTIVATION UND ZIEL DER ARBEIT
- AUFBAU DER ARBEIT
- BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
- DEFINITION DEMOGRAPHIE
- DEFINITION DEMOGRAPHISCHER WANDEL
- DEMOGRAPHISCHER WANDEL IN DEUTSCHLAND
- FERTILITÄT
- MORTALITÄT UND LEBENSERWARTUNG
- MIGRATION
- RÜCKGANG DER BEVÖLKERUNG
- VERÄNDERUNGEN IM ALTERSAUFBAU
- RÜCKGANG UND ALTERUNG DER ERWERBSFÄHIGEN BEVÖLKERUNG
- VERÄNDERUNG IM VERHÄLTNIS DER SENIOREN ZUR ERWERBSFÄHIGEN BEVÖLKERUNG
- GEGENWÄRTIGE PFLEGESITUATION IN DEUTSCHLAND
- KOMPRIMIERTE EINFÜHRUNG IN DIE PFLEGEVERSICHERUNG
- DATEN UND FAKTEN ZUR PFLEGESITUATION HEUTE UND IN ZUKUNFT
- HERAUSFORDERUNGEN DES DEMOGRAPHISCHEN WANDELS AN DIE PFLEGE
- FINANZIERUNG DER GESETZLICHEN PFLEGEVERSICHERUNG
- PFLEGEFACHKRÄFTEMANGEL
- ÄLTERE ARBEITNEHMER IN DER PFLEGE
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Pflege in Deutschland. Sie analysiert die Entwicklung der deutschen Bevölkerung im Zuge des demographischen Wandels und untersucht die damit verbundenen Herausforderungen für die Pflegebranche.
- Entwicklung der deutschen Bevölkerung im Zuge des demographischen Wandels
- Herausforderungen der demographischen Entwicklung für die Pflege
- Finanzierung der Pflegeversicherung
- Pflegenotstand und Fachkräftemangel
- Situation älterer Arbeitnehmer in der Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Motivation und dem Ziel der Arbeit sowie mit dem Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Demographie und demographischem Wandel. Kapitel drei analysiert den demographischen Wandel in Deutschland, wobei die Themenbereiche Fertilität, Mortalität und Lebenserwartung, Migration, Rückgang der Bevölkerung und die Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung beleuchtet werden. Im vierten Kapitel wird die gegenwärtige Pflegesituation in Deutschland beleuchtet und die Finanzierung der Pflegeversicherung erläutert.
Schlüsselwörter
Demographischer Wandel, Pflege, Pflegeversicherung, Pflegenotstand, Fachkräftemangel, Altersstruktur, Lebenserwartung, Migration, Fertilität, Mortalität
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der demographische Wandel die Pflege?
Durch die steigende Lebenserwartung nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen zu, während gleichzeitig weniger junge Menschen für den Pflegeberuf nachrücken.
Was versteht man unter dem Begriff „Vergreisung der Gesellschaft“?
Es beschreibt die Veränderung der Altersstruktur, bei der der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung im Verhältnis zu den Jüngeren stetig wächst.
Welche Probleme ergeben sich für die Pflegeversicherung?
Die Finanzierung gerät unter Druck, da immer mehr Leistungen für Senioren benötigt werden, während die Zahl der beitragszahlenden Erwerbstätigen sinkt.
Warum gibt es einen akuten Fachkräftemangel in der Pflege?
Gründe sind die hohe physische und psychische Belastung, oft unzureichende Bezahlung und die demographisch bedingte Abnahme des Erwerbspersonenpotenzials.
Welche Rolle spielt Migration für die Pflege in Deutschland?
Migration kann helfen, den Fachkräftemangel abzumildern, stellt aber auch Anforderungen an die Integration und interkulturelle Kompetenz in Pflegeeinrichtungen.
- Quote paper
- Kathleen Pickert (Author), 2011, Herausforderungen der Pflege in Zeiten des demographischen Wandels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180250