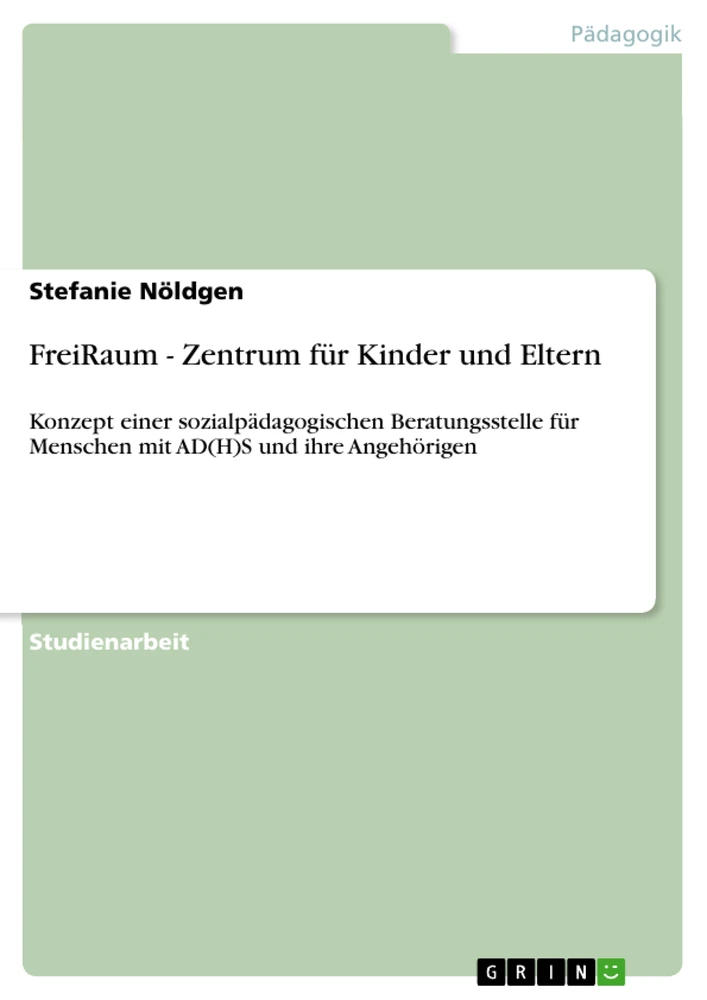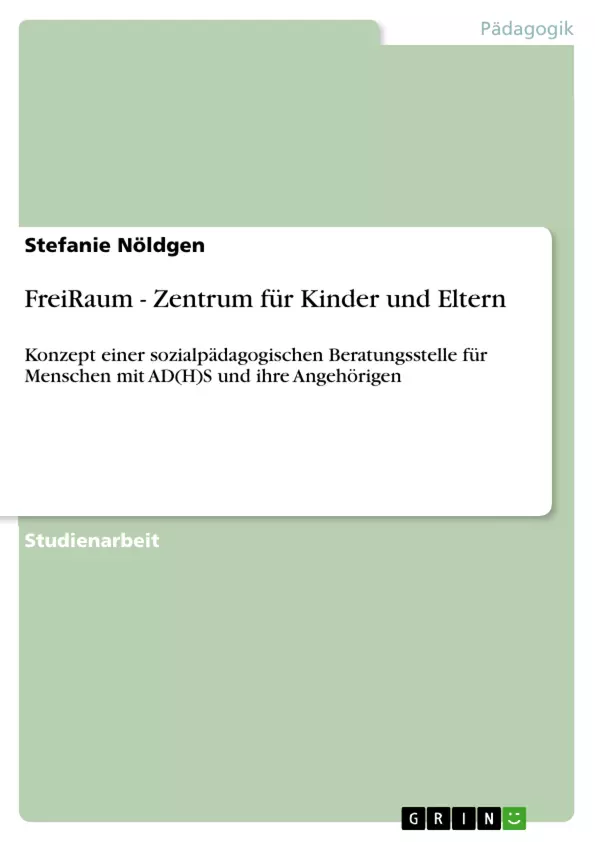In dem Seminar ‚Verhaltensstörung als Herausforderung für die Heilpädagogik’ habe ich mich mit AD(H)S beschäftigt. Die Aufgabe bestand darin, ein Konzept für eine sozialpädagogische Beratungsstelle für Menschen mit AD(H)S und ihre Angehörigen zu entwickeln. Im ersten Teil der Hausarbeit stelle ich theoretische Grundlagen zu Verhaltensstörungen im Allgemeinen und zu AD(H)S im Besonderen dar. Im zweiten Teil stelle ich das Projekt ‚FreiRaum – Zentrum für Kinder und Eltern’ vor und gehe im dritten Teil auf die sozialpädagogische Relevanz des Themas ein.
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
1 Einführung
1.1 Verhaltensstörung
1.1.1 Definition Verhaltensstörung
1.1.2 Verhaltensstörungen existieren nur im sozialen Kontext
1.1.3 Klassifikation von Verhaltensstörungen
1.1.4 Kriterien für Verhaltensstörungen
1.1.5 Verhaltensstörungen verstehen
1.2 AD(H)S als Verhaltensstörung
1.2.1 Begriffsklärung
1.2.2 Erklärungsansätze
1.2.3 Prävalenz
1.2.4 Ausprägungsformen
1.2.5 Symptome
1.2.5.1 Basissymptome
1.2.5.2 Sekundärsymptome
1.2.6 Verlauf
1.2.7 Maßnahmen
1.2.7.1 Pädagogische Angebote
1.2.7.2 Therapeutische Angebote
1.2.7.3 medikamentöse Behandlung
2 Projektbeschreibung
2.1 ‚FreiRaum – Zentrum für Kinder und Eltern’
2.1.1 Träger und Finanzierung
2.1.2 Verortung und Beschreibung der Einrichtung
2.1.3 Einzugsgebiet
2.1.4 Zielgruppe
2.1.5 Ziele
2.1.6 Angebotsstruktur
2.1.6.1 niedrigschwellige Angebote
2.1.6.2 höherschwellige Angebote
2.1.7 Angebotspalette
2.1.7.1 Angebote für Kinder mit AD(H)S
2.1.7.2 Angebote für Kinder mit AD(H)S und deren Geschwister
2.1.7.3 Angebote für Eltern/erwachsene Angehörige der Kinder mit AD(H)S
2.1.7.4 Angebote für Eltern/erw. Angehörige, Kinder mit AD(H)S u. Geschwister
2.1.7.5 allgemeine Angebote
2.1.8 Vernetzung
2.1.9 Mitarbeiter
2.1.9.1 hauptamtliche Mitarbeiter
2.1.9.2 sonstige Mitarbeiter
3 Fazit
Quellenverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Einführung
- 1.1 Verhaltensstörung
- 1.1.1 Definition Verhaltensstörung
- 1.1.2 Verhaltensstörungen existieren nur im sozialen Kontext
- 1.1.3 Klassifikation von Verhaltensstörungen
- 1.1.4 Kriterien für Verhaltensstörungen
- 1.1.5 Verhaltensstörungen verstehen
- 1.2 AD(H)S als Verhaltensstörung
- 1.2.1 Begriffsklärung
- 1.2.2 Erklärungsansätze
- 1.2.3 Prävalenz
- 1.2.4 Ausprägungsformen
- 1.2.5 Symptome
- 1.2.5.1 Basissymptome
- 1.2.5.2 Sekundärsymptome
- 1.2.6 Verlauf
- 1.2.7 Maßnahmen
- 1.2.7.1 Pädagogische Angebote
- 1.2.7.2 Therapeutische Angebote
- 1.2.7.3 Medikamentöse Behandlung
- 2 Projektbeschreibung
- 2.1 'FreiRaum - Zentrum für Kinder und Eltern'
- 2.1.1 Träger und Finanzierung
- 2.1.2 Verortung und Beschreibung der Einrichtung
- 2.1.3 Einzugsgebiet
- 2.1.4 Zielgruppe
- 2.1.5 Ziele
- 2.1.6 Angebotsstruktur
- 2.1.6.1 Niedrigschwellige Angebote
- 2.1.6.2 Höherschwellige Angebote
- 2.1.7 Angebotspalette
- 2.1.7.1 Angebote für Kinder mit AD(H)S
- 2.1.7.2 Angebote für Kinder mit AD(H)S und deren Geschwister
- 2.1.7.3 Angebote für Eltern/erwachsene Angehörige der Kinder mit AD(H)S
- 2.1.7.4 Angebote für Eltern/erw. Angehörige, Kinder mit AD(H)S u. Geschwister
- 2.1.7.5 Allgemeine Angebote
- 2.1.8 Vernetzung
- 2.1.9 Mitarbeiter
- 2.1.9.1 Hauptamtliche Mitarbeiter
- 2.1.9.2 Sonstige Mitarbeiter
- 3 Fazit
- Verhaltensstörung als komplexes Phänomen
- AD(H)S als Verhaltensstörung mit spezifischen Ausprägungen
- Entwicklung eines Konzepts für eine sozialpädagogische Beratungsstelle
- Angebotsstruktur und Zielgruppe der Beratungsstelle
- Relevanz und Bedeutung sozialpädagogischer Unterstützung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Konzepts für eine sozialpädagogische Beratungsstelle, die Menschen mit AD(H)S und ihre Angehörigen unterstützt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Darstellung von AD(H)S als Verhaltensstörung, den entsprechenden Erklärungsansätzen und den verfügbaren Maßnahmen. Des Weiteren wird das Projekt 'FreiRaum - Zentrum für Kinder und Eltern' vorgestellt, das die Angebote und Strukturen einer solchen Beratungsstelle veranschaulicht.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert den Entstehungsprozess und die Ziele des Konzepts für eine sozialpädagogische Beratungsstelle. Kapitel 1 befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund von Verhaltensstörungen im Allgemeinen und AD(H)S im Besonderen. Es werden Definitionen, Erklärungsansätze, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten von AD(H)S beleuchtet. Kapitel 2 stellt das Projekt 'FreiRaum - Zentrum für Kinder und Eltern' vor und beschreibt die Struktur, die Angebote und die Zielgruppe dieser Einrichtung.
Schlüsselwörter
Verhaltensstörung, AD(H)S, sozialpädagogische Beratungsstelle, Konzept, 'FreiRaum - Zentrum für Kinder und Eltern', niedrigschwellige und höherschwellige Angebote, Elternarbeit, Vernetzung, Unterstützung
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Projekt "FreiRaum"?
"FreiRaum" ist ein Konzept für eine sozialpädagogische Beratungsstelle, die sich speziell an Kinder mit AD(H)S sowie deren Eltern und Geschwister richtet.
Welche Symptome sind typisch für AD(H)S?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Basissymptomen (Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität) und Sekundärsymptomen, die sich im sozialen Kontext entwickeln können.
Welche Angebote bietet die Beratungsstelle für Eltern?
Das Angebot umfasst niedrigschwellige Hilfen wie Elterngesprächskreise sowie höherschwellige therapeutische und pädagogische Beratungsangebote zur Unterstützung im Alltag.
Warum ist Vernetzung bei AD(H)S so wichtig?
Eine effektive Hilfe erfordert die Zusammenarbeit zwischen Schule, Therapeuten, Ärzten und der Familie, um ein konsistentes Unterstützungssystem für das Kind zu schaffen.
Welche Behandlungsansätze für AD(H)S werden in der Arbeit genannt?
Es werden pädagogische Angebote, therapeutische Maßnahmen und die medikamentöse Behandlung als mögliche Säulen einer ganzheitlichen Intervention erläutert.
- Citar trabajo
- Stefanie Nöldgen (Autor), 2004, FreiRaum - Zentrum für Kinder und Eltern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180255