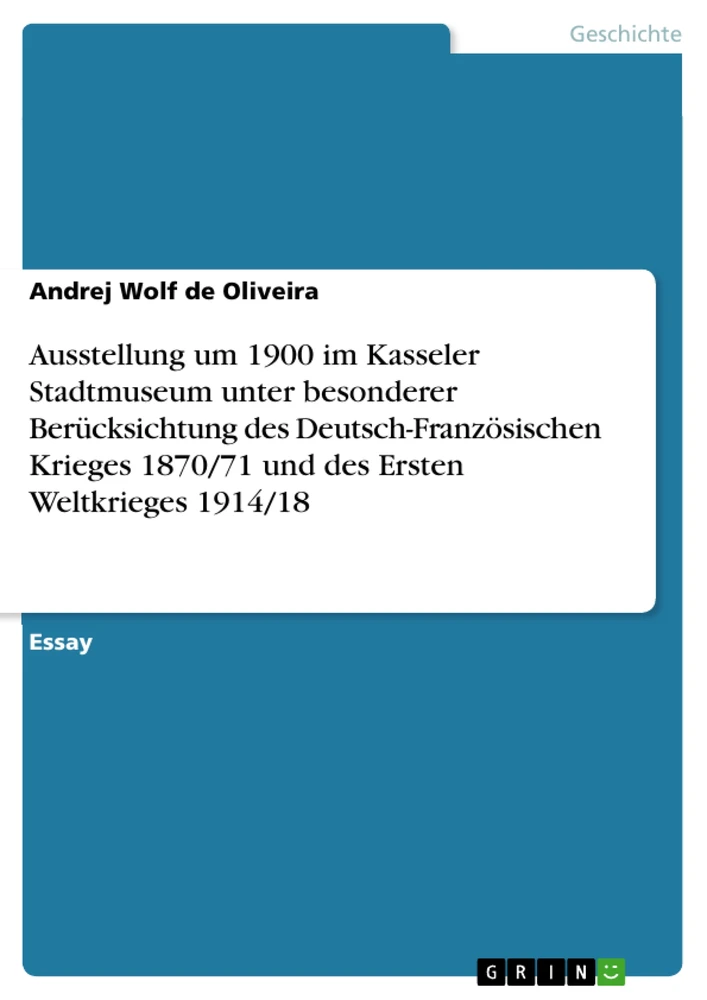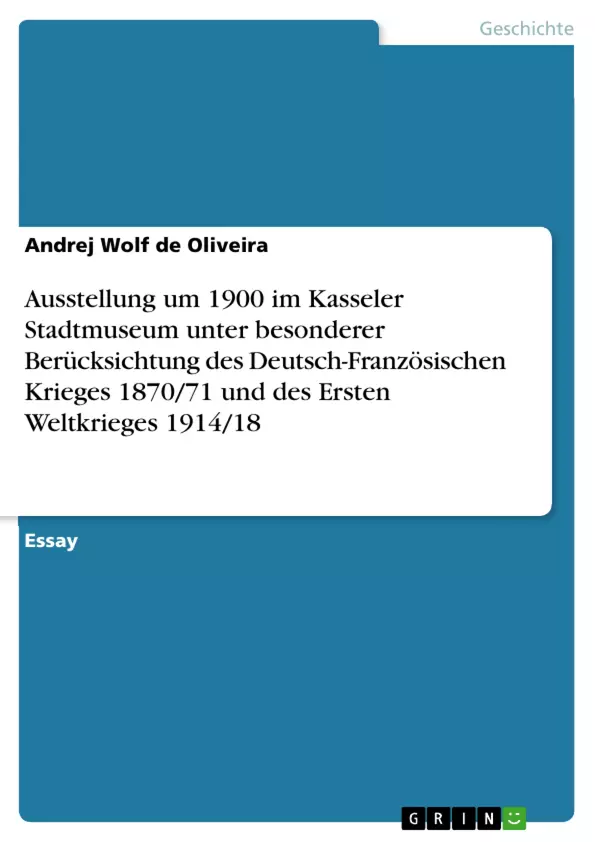Das historische Museum der Stadt Kassel besteht seit 1979 und dokumentiert die Geschichte Kassels seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 913. Der Schwerpunkt der ständigen Ausstellung liegt auf der Entwicklung Kassels vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Weiterhin wird das Schicksal der Stadt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit den beiden Weltkriegen, Inflation und Nationalsozialismus dargestellt. Residenzstadt, Industriestadt, Trümmerstadt, Stadt des Wiederaufbaus und Stadt im Zentrum Deutschlands, ihre Umbrüche und Brüche präsentiert die Dauerausstellung des Stadtmuseums.
Diese Hausarbeit untersucht die Exponate, die die Stadtgeschichte Kassels um 1900 widerspiegeln. Dabei werden besonders die Ausstellungen zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und dem Ersten Weltkrieg bewertet. Untersucht wird die Authentizität der Exponate im historischen Kontext.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausstellungsstücke des Kasseler Stadtmuseums um 1900
- Ausstellung zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71
- Ausbruch und Verlauf des Deutsch-Französischen Krieges
- Deutsche Soldaten an der Front
- Porzellankrüge aus dem Kasseler Stadtmuseum als Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg
- Ausstellung zum Ersten Weltkrieg 1914/18 im Kasseler Stadtmuseum
- Kassel während des Ersten Weltkriegs
- Ausstellung zum Ersten Weltkrieg im Stadtmuseum
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Exponate des Kasseler Stadtmuseums, die die Stadtgeschichte Kassels um 1900 widerspiegeln, mit besonderem Fokus auf die Ausstellungen zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und dem Ersten Weltkrieg. Die Arbeit analysiert die Authentizität der Exponate im historischen Kontext und bewertet die didaktische Gestaltung der Ausstellung.
- Entwicklung Kassels vom 18. bis zum 20. Jahrhundert
- Ausstellungsstücke als Spiegelbild der Stadtgeschichte
- Authentizität und Bedeutung von Exponaten
- Didaktische Konzepte und Strukturen im Museum
- Der Einfluss der beiden Weltkriege auf die Stadt Kassel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Kasseler Stadtmuseum und seine Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt vor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Exponate, die die Stadtgeschichte um 1900 repräsentieren, insbesondere die Ausstellungen zu den beiden Weltkriegen.
Ausstellungsstücke des Kasseler Stadtmuseums um 1900
Dieser Abschnitt beleuchtet die vielfältige Ausstellung des Museums, wobei der Fokus auf ausgewählte Exponate gelegt wird, die für die Stadtgeschichte von Kassel besonders bedeutsam sind. Es werden das Gemälde „Kassel aus dem Ballon 1898", das Modell des Kasseler Rathauses und die Silbergegenstände des ehemaligen Stadtrates beschrieben.
Ausstellung zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71
Dieses Kapitel behandelt die historischen Ursachen und den Verlauf des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71. Die Exponate des Museums, die den Krieg in Bildern widerspiegeln, werden im historischen Kontext untersucht.
Schlüsselwörter
Kasseler Stadtmuseum, Stadtgeschichte, 1900, Deutsch-Französischer Krieg, Erster Weltkrieg, Authentizität, Didaktik, Exponate, Modellpräsentation, Industriestädte, soziale Unterschiede, Kriegsgeschichte, historische Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen
Was zeigt das Kasseler Stadtmuseum zur Geschichte um 1900?
Die Ausstellung dokumentiert die Entwicklung Kassels von der Residenzstadt zur Industriestadt und beleuchtet die sozialen Umbrüche dieser Zeit.
Wie wird der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 thematisiert?
Durch Exponate wie Porzellankrüge und Bilder wird an den Krieg erinnert, wobei die Authentizität dieser Stücke im historischen Kontext analysiert wird.
Welche Bedeutung hat das Rathaus-Modell im Museum?
Das Modell des Kasseler Rathauses dient als zentrales Exponat, um die städtebauliche und politische Bedeutung der Stadt um die Jahrhundertwende zu verdeutlichen.
Wie stellt das Museum den Ersten Weltkrieg dar?
Die Ausstellung zeigt die Auswirkungen des Krieges auf das Alltagsleben in Kassel und die Rolle der Stadt während der Jahre 1914 bis 1918.
Wann wurde das Kasseler Stadtmuseum gegründet?
Das historische Museum besteht seit 1979 und dokumentiert die Stadtgeschichte seit ihrer ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 913.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Andrej Wolf de Oliveira (Author), 2007, Ausstellung um 1900 im Kasseler Stadtmuseum unter besonderer Berücksichtung des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 und des Ersten Weltkrieges 1914/18 , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180267