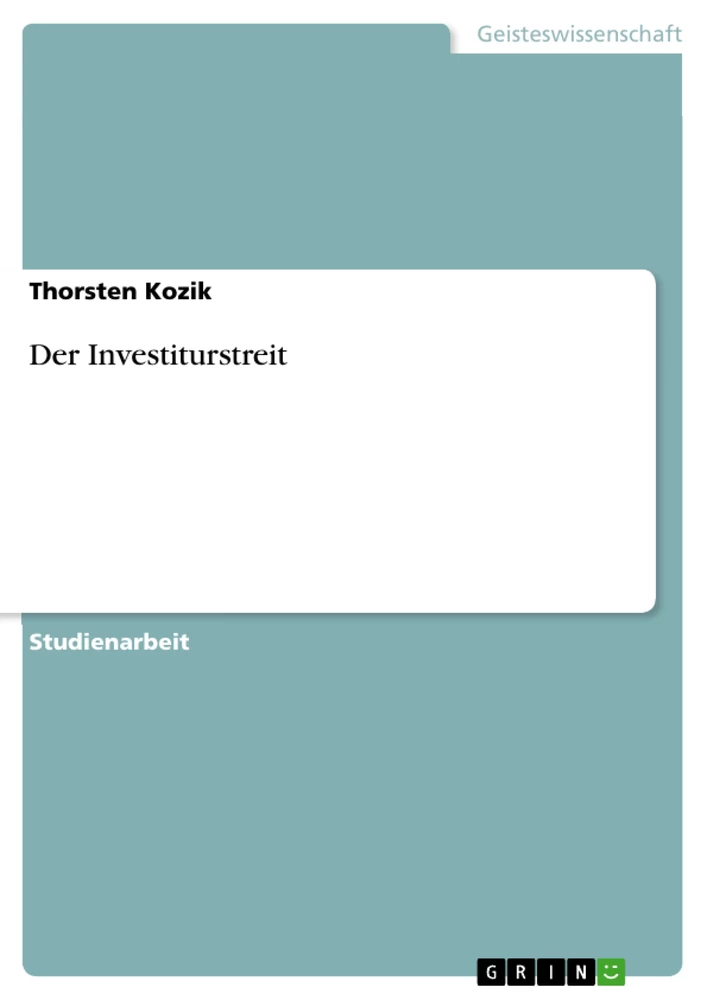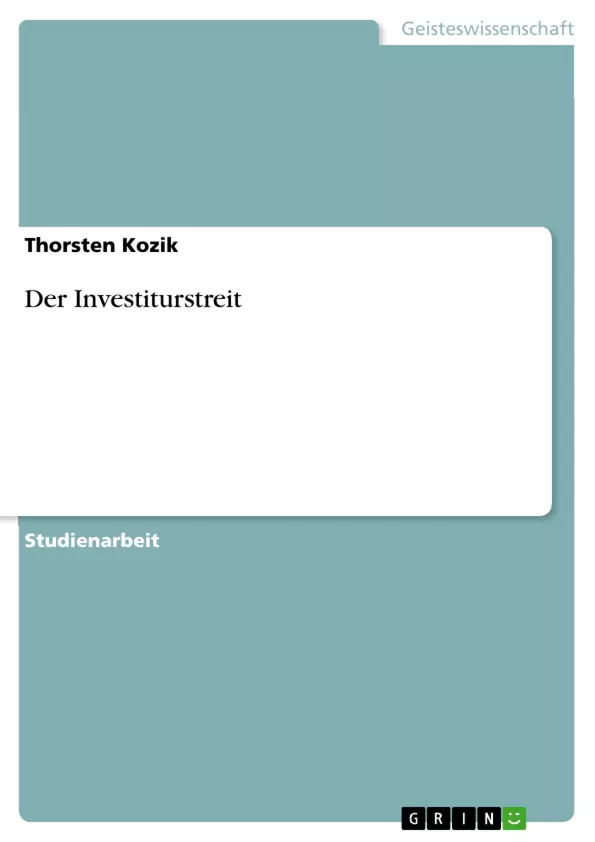Der Begriff Investitur hat nichts mit den Begriffen Inventur oder investieren zutun. Er bezeichnet die Amtseinsetzung eines Bischofs/Erzbischofs in ein Bistum/Erzbistum. Ist nicht geklärt wer einen Bischof einsetzten darf und mehrere Parteien beanspruchen das Investiturrecht für sich, kommt es zu einem Streit, dem Investiturstreit. Heutzutage ist klar, dass die katholische Kirche ihre Bischöfe alleine beruft und einsetzt. Ziel dieser Seminararbeit ist es herauszufinden wie die Investitur im Mittelalter gehandhabt wurde und wie es zu einem Investiturstreit kommen konnte. Der Zeitraum von 1075 – 1122 gilt als die Hochzeit des Investiturstreits. Eine Untersuchung der Jahre vor dem Investiturstreits ist nötig, wo vor allem das Papsttum und theologie-geschichtliche Veränderungen dieser Zeit genauer untersucht werden sollten um die entscheidenden Veränderungen zu verstehen. Zudem ist zu begutachten wie sich die deutschen Könige und Kaiser gegenüber den Päpsten und Bischöfen verhielten.
Zur Untersuchung stehen zahlreiche Quellen und sekundär Literatur zur Verfügung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Das ottonisch-salische Reichskirchensystem
- Anfänge des Reformpapsttums
- Der Investiturstreit
- Das Wormser Konkordat
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, wie die Investitur im Mittelalter gehandhabt wurde und wie es zu einem Investiturstreit kommen konnte. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitraum von 1075 bis 1122, der als die Hochzeit des Investiturstreits gilt. Die Arbeit untersucht die Entwicklungen vor diesem Streit, insbesondere die Rolle des Papsttums und theologische Veränderungen, um die entscheidenden Faktoren zu verstehen. Weiterhin wird beleuchtet, wie sich deutsche Könige und Kaiser gegenüber den Päpsten und Bischöfen verhielten.
- Das ottonisch-salische Reichskirchensystem und die Beziehungen zwischen Königen und Bischöfen
- Die Anfänge des Reformpapsttums und die Herausforderungen für die geistliche und weltliche Ordnung
- Die Entstehung und Eskalation des Investiturstreits zwischen Papsttum und Kaisertum
- Die Rolle der Bischöfe im Konflikt und ihre Bedeutung für die Reichsregierung
- Die Entwicklung der Beziehungen zwischen Papsttum und Kaisertum im 11. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel definiert den Begriff Investitur und erläutert die Bedeutung des Investiturstreits. Es skizziert die Zielsetzung der Arbeit und den untersuchten Zeitraum.
Kapitel 2.1: Das ottonisch-salische Reichskirchensystem
Dieses Kapitel beschreibt die enge Verbindung zwischen den deutschen Königen und dem Papsttum im Mittelalter, die auf die Kaiserkrönung Karls des Großen zurückgeht. Es analysiert die Vorherrschaft des Kaisers über den Papst in der ottonisch-salischen Epoche sowie das besondere Verhältnis des Königs zu den Bischöfen im Reich. Die Bedeutung der Bischöfe für die Reichsregierung und die Verflechtung von weltlicher und geistlicher Macht werden hervorgehoben.
Kapitel 2.2: Anfänge des Reformpapsttums
Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge des Reformpapsttums ab dem Jahr 1046 und die Bemühungen um die Etablierung eines reformierten Papsttums. Es schildert die chaotischen Verhältnisse in Rom und die Versuche des deutschen Königs Heinrich III, eine Reform des Papsttums durchzusetzen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Investitur, Investiturstreit, Reichskirchensystem, Reformpapsttum, Papsttum, Kaisertum, Bischöfe, König, Kaiser, weltliche Macht, geistliche Macht, Immunität, Regalienrechte, Simonie, Reichsgut, Kirchengut, Thronerhebung, Weihe, Salbung, Krönung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Investitur“ im mittelalterlichen Kontext?
Investitur bezeichnet die feierliche Einsetzung eines Bischofs oder Erzbischofs in sein geistliches Amt und die damit verbundene Übergabe von Rechten und Gütern.
Was war der Kern des Investiturstreits?
Es war ein Machtkonflikt zwischen dem Papsttum und dem Kaisertum darüber, wer das Recht hatte, Bischöfe zu ernennen und einzusetzen – die geistliche oder die weltliche Macht.
Was ist das ottonisch-salische Reichskirchensystem?
In diesem System waren Bischöfe eng in die Reichsverwaltung eingebunden und fungierten als wichtige Stützen der königlichen Macht, was zu einer starken Verflechtung von Staat und Kirche führte.
Wann fand der Investiturstreit statt?
Die Hochphase des Streits lag zwischen 1075 und 1122. Er endete vorläufig mit dem Wormser Konkordat.
Welche Rolle spielte das Reformpapsttum in diesem Konflikt?
Das Reformpapsttum (ab ca. 1046) forderte die Unabhängigkeit der Kirche von weltlichem Einfluss (Libertas Ecclesiae) und bekämpfte die Praxis der Laieninvestitur und Simonie.
- Quote paper
- Bachelor Thorsten Kozik (Author), 2006, Der Investiturstreit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180292