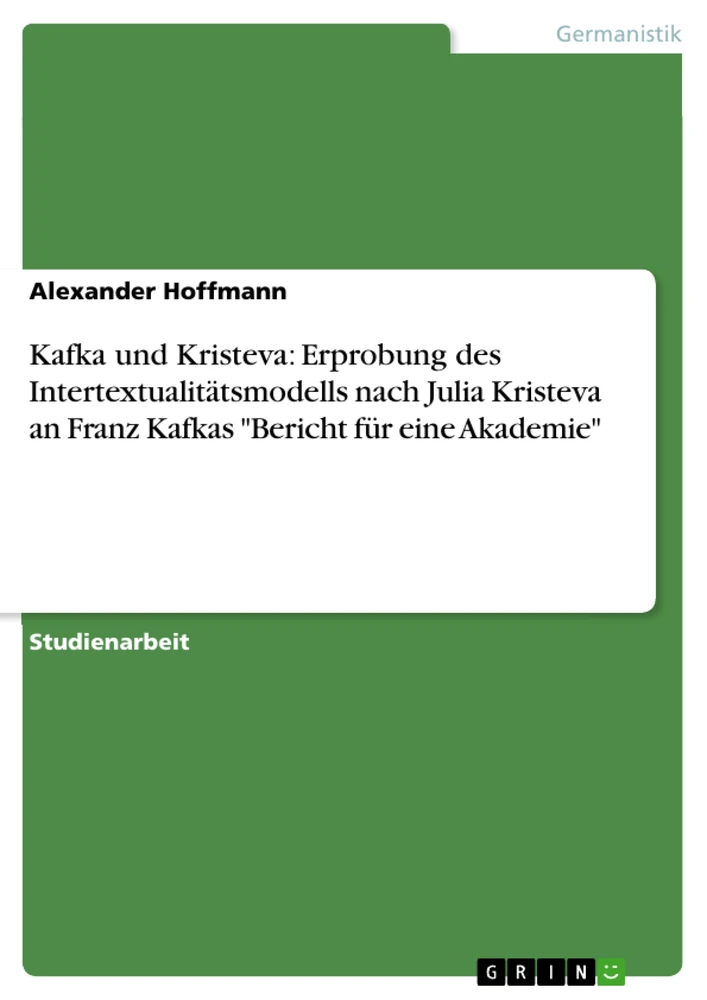„Kafkas weltliterarische Bedeutung manifestiert sich erstens in den Einflüssen, die von den Werken anderer Autoren auf Kafkas Oeuvre ausgegangen sind und zweitens in jenen, die es selbst auf die Werke anderer Autoren nahm.“ Vor allem um die Einflüsse anderer Werke auf die Texte Franz Kafkas soll es in dieser Arbeit gehen. Sie macht es sich zur Aufgabe, die Möglichkeiten und Grenzen einer intertextuellen Interpretation von Kafkas Erzählung Ein Bericht für eine Akademie herauszuarbeiten.
Wenn in diesem Zusammenhang von Intertextualität gesprochen wird, ist der Ansatz von Julia Kristeva gemeint, der dieser Arbeit als maßgebliche theoretische Fundierung dienen soll. Und das gerade weil er mit einem höheren Grad an Unbestimmtheit operiert, als der zweite große, mit ihm konkurrierende Ansatz, zu dessen Vertretern etwa Ulrich Broich und Manfred Pfister zählen. Anders als deren Konzept, dass aufgrund des eng gesteckte Rahmens nur greifen kann, wenn intertextuelle Bezüge markiert und intendiert sind, geht Kristeva von einem Textbegriff aus, für den sie exemplarisch Kafkas Werke heranzieht: Gerade ihn sieht sie als einen Vertreter des polyphonen Romans des 20. Jahrhunderts, „der Sprache innerlich [...] macht“ und deshalb ihrem Konzept eher zu entsprechen vermag.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen: Die Intertextualitätstheorie
- Exkurs: Interpretation und Überinterpretation
- Kafka und Intertextualität: Ein erster Zugang
- Zu Kafkas Lektüren
- Zu Kafkas intertextuellem Verfahren
- Intertextuelle Bezüge in Kafkas Bericht
- Zu Kafka und Homer
- Zu Kafka und E.T.A. Hoffmann
- Zu Tierdressur und Varieté
- Zu Kafka und Wilhelm Busch
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Einflüsse anderer Werke auf Franz Kafkas Erzählung "Ein Bericht für eine Akademie". Sie untersucht die Möglichkeiten und Grenzen einer intertextuellen Interpretation, insbesondere unter Anwendung der Theorie von Julia Kristeva. Die Arbeit zeigt auf, wie Kafkas Werk in den Kontext der Weltliteratur eingebunden ist und wie die Intertextualität in seinen Texten wirkt.
- Die Intertextualitätstheorie von Julia Kristeva
- Die Anwendung des intertextuellen Ansatzes auf Kafkas "Ein Bericht für eine Akademie"
- Die Analyse von intertextuellen Bezügen in Kafkas Erzählung
- Die Bedeutung von Kafkas Lektüren und seinem intertextuellen Verfahren
- Die Herausarbeitung von möglicherweise relevanten Einflüssen auf Kafkas Erzählung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die theoretische Grundlage der Arbeit vor.
- Kapitel 2 führt in die Intertextualitätstheorie ein und vergleicht den Ansatz von Julia Kristeva mit anderen Theorien.
- Kapitel 3 thematisiert das Problemfeld der Überinterpretation.
- Kapitel 4 erforscht Kafkas Lektüren und sein intertextuelles Verfahren, um einen eingehenden Zugang zu seinen Werken zu erlangen.
- Kapitel 5 analysiert ausgewählte Motive aus "Ein Bericht für eine Akademie" und untersucht die Intertextualität zwischen Kafkas Erzählung und Werken von Homer, E.T.A. Hoffmann, Wilhelm Busch und anderen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Intertextualität, Franz Kafka, "Ein Bericht für eine Akademie", Julia Kristeva, literarische Einflüsse, Weltliteratur und Analyse von intertextuellen Bezügen. Sie untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung des intertextuellen Ansatzes auf Kafkas Erzählung und beleuchtet die Bedeutung der Lektüren und des intertextuellen Verfahrens des Autors.
Häufig gestellte Fragen
Wie wendet Kafka Intertextualität in seinem Werk an?
Die Arbeit untersucht, wie Kafka Einflüsse anderer Autoren in seinen Texten verarbeitet, insbesondere in der Erzählung „Ein Bericht für eine Akademie“.
Was besagt die Intertextualitätstheorie von Julia Kristeva?
Kristeva betrachtet jeden Text als ein Mosaik von Zitaten und geht von einem polyphonen Textbegriff aus, der über bloße bewusste Anspielungen hinausgeht.
Welche literarischen Bezüge finden sich im "Bericht für eine Akademie"?
Es werden Bezüge zu Homer, E.T.A. Hoffmann, Wilhelm Busch sowie Themen wie Tierdressur und Varieté analysiert.
Was ist das Problem der "Überinterpretation"?
Die Arbeit enthält einen Exkurs zur Grenze zwischen einer fundierten intertextuellen Analyse und einer willkürlichen Hineininterpretation von Bezügen.
Warum passt Kristevas Modell besonders gut zu Kafka?
Kristeva sieht Kafka als Vertreter des modernen Romans, der Sprache "innerlich" macht und somit ihrem Konzept der Unbestimmtheit entspricht.
- Quote paper
- Alexander Hoffmann (Author), 2008, Kafka und Kristeva: Erprobung des Intertextualitätsmodells nach Julia Kristeva an Franz Kafkas "Bericht für eine Akademie", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180317