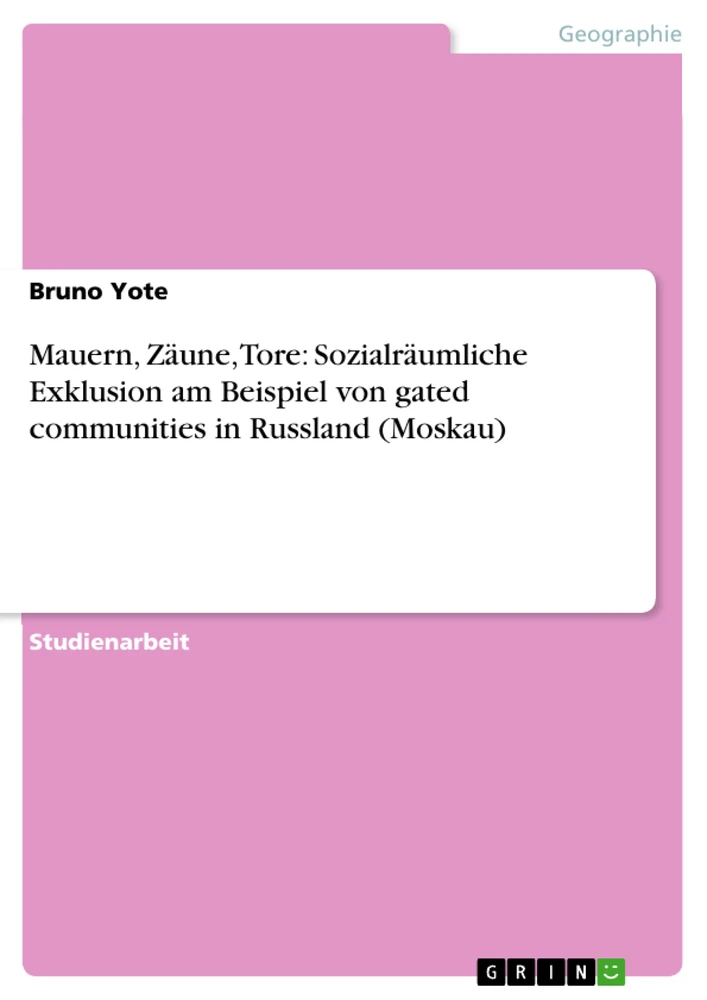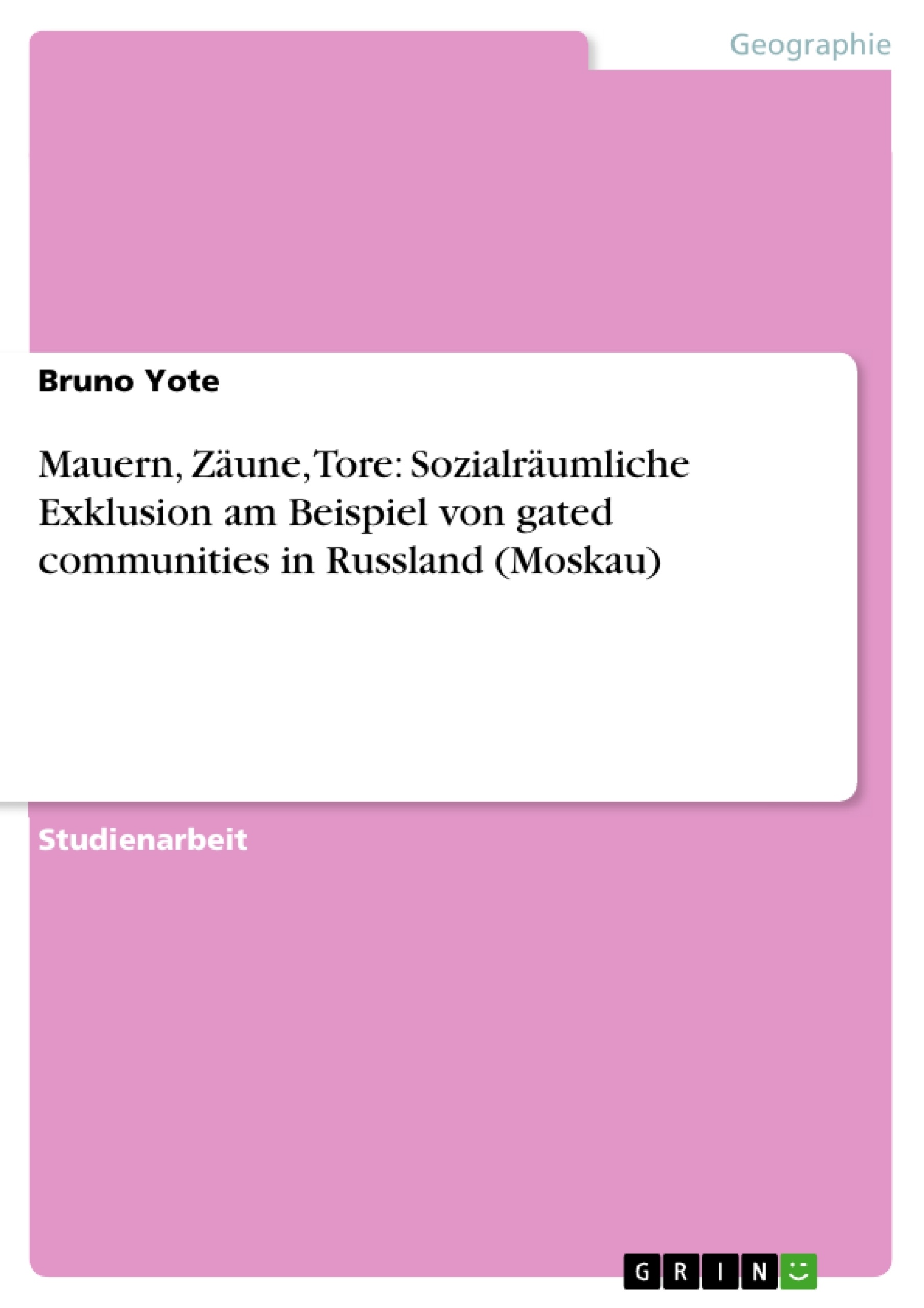Diese Arbeit konzentriert sich auf die Veränderungen während des russischen Transformationsprozesses. Besonderes Augenmerk gilt der Entwicklung des Wohnsektors, wobei der Bereich des sogenannten bewachten Wohnens im Hinblick auf die These untersucht werden soll, dass die Verbreitung bewachter Wohnanlagen in Russland, sogenannter gated communities (GCs), mit der Abnahme gemeinwohlorientierter Steuerungsmöglichkeiten der Stadtentwicklung beim Übergang von der sozialistischen in die kapitalistische Marktwirtschaft zusammenhängt.
Im Ergebnis zeigt sich, dass weitere Faktoren (historische, kulturelle, politische, soziale) einen erheblichen Einfluss auf die Herausbildung von Strukturen des bewachten Wohnens in Russland hatten und immer noch haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Annäherung an den sowjetischen Öffentlichkeitsbegriff
- 2.1 Räumliche Einordnung: Öffentlichkeit und Wohnraum in der Sowjetunion
- 2.2 (Wohn-) Raum und Öffentlichkeit in der Transformationsphase
- 3. Der Wohnungsmarkt in der Transformationsphase
- 4. Gated communities als Sonderfall des "elitären Wohnens"
- 4.1 Zum Phänomen der gated communities in Moskau: Ursachenforschung
- 4.2 Sicherheitskonzepte
- 4.3 Verbreitung und Akzeptanz der GCs in der russischen Gesellschaft
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Wohnsektors in Russland während des Transformationsprozesses und analysiert das Phänomen der "gated communities" als Sonderfall elitären Wohnens. Es wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Verbreitung von gated communities mit der Abnahme gemeinwohlorientierter Steuerungsmöglichkeiten der Stadtentwicklung zusammenhängt. Die Arbeit betrachtet dabei die sozio-ökonomischen Veränderungen sowie die historischen und kulturellen Bedingungen, die die schnelle Verbreitung und Akzeptanz dieser Wohnform begünstigten.
- Entwicklung des sowjetischen Öffentlichkeitsbegriffs und des Wohnraums
- Transformation des Wohnungsmarktes im postsowjetischen Russland
- Ursachen für die Entstehung und Verbreitung von gated communities in Moskau
- Sicherheitskonzepte und soziale Aspekte von gated communities
- Bedeutung von gated communities im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Veränderungen des Öffentlichkeitsbegriffs und des Wohnraums in Russland seit Beginn des Transformationsprozesses. Sie betont den Zusammenhang zwischen sozio-ökonomischen Veränderungen, historischen und kulturellen Bedingungen und der Verbreitung von gated communities. Die Arbeit fokussiert auf die Entwicklung des Wohnsektors und die Untersuchung der These, dass die Verbreitung von gated communities mit dem Rückgang gemeinwohlorientierter Steuerungsmöglichkeiten in der Stadtentwicklung zusammenhängt.
2. Theoretische Annäherung an den sowjetischen Öffentlichkeitsbegriff: Dieses Kapitel analysiert die Konzeptionen von Öffentlichkeit und Privatsphäre im Kontext der sowjetischen Gesellschaft. Es zeigt, dass es im sowjetischen System keine Öffentlichkeit im westlichen Sinne gab, da Privateigentum fehlte und der Staat nicht bürgerlich-pluralistisch strukturiert war. Der öffentliche Raum diente der politischen Manifestation und der Kontrolle der Gesellschaft. Der Unterschied zwischen "offiziell-öffentlicher" und "privat-öffentlicher" Sphäre wird herausgestellt, wobei letztere durch den Eingriff des Staates in den Privatbereich gekennzeichnet war. Die sowjetische Wohnpolitik wird als Beispiel für die Vermischung von öffentlichem und privatem Raum betrachtet.
2.1 Räumliche Einordnung: Öffentlichkeit und Wohnraum in der Sowjetunion: Dieses Unterkapitel vertieft die Betrachtung des Wohnraums in der Sowjetunion. Im Gegensatz zum bürgerlichen Verständnis, das den Wohnbereich als Privatsphäre schützt, drang der Staat tief in die Gestaltung des Wohnraums ein. Die Privatsphäre widersprach der Ideologie des kollektiven Lebens. Drei Phasen der Entwicklung der Wechselwirkungen zwischen Wohnbereich und Öffentlichkeitssphären werden beschrieben: Die erste Phase (1917-Mitte der 1930er Jahre) war geprägt von Wohnungsenteignungen und Umverteilungen. Die zweite Phase unter Stalin kennzeichnete sich durch Repression und Denunziation, die bis in den privaten Wohnraum reichten. Die dritte, nachstalinistische Phase, zeigte eine sukzessive Abnahme der staatlichen Kontrolle und eine Liberalisierung.
3. Der Wohnungsmarkt in der Transformationsphase: [Dieses Kapitel ist im Auszug nicht vollständig enthalten und kann daher nicht zusammengefasst werden.]
4. Gated communities als Sonderfall des "elitären Wohnens": [Dieses Kapitel ist im Auszug nicht vollständig enthalten und kann daher nicht zusammengefasst werden.]
Schlüsselwörter
Gated Communities, Russland, Transformationsprozess, Sowjetunion, Öffentlichkeitsbegriff, Privatsphäre, Wohnungsmarkt, Stadtentwicklung, soziale Exklusion, Sicherheitskonzepte, elitäres Wohnen, sozialistische und kapitalistische Marktwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Entwicklung des Wohnsektors in Russland und das Phänomen der "gated communities"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Wohnsektors in Russland während des Transformationsprozesses und analysiert das Phänomen der "gated communities" als Sonderfall elitären Wohnens. Ein zentrales Thema ist der Zusammenhang zwischen der Verbreitung von gated communities und dem Rückgang gemeinwohlorientierter Steuerungsmöglichkeiten in der Stadtentwicklung.
Welche Aspekte der sowjetischen Gesellschaft werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert den sowjetischen Öffentlichkeitsbegriff und die Konzeptionen von Öffentlichkeit und Privatsphäre im Kontext der sowjetischen Gesellschaft. Es wird gezeigt, dass es im sowjetischen System keine Öffentlichkeit im westlichen Sinne gab, und wie der Staat tief in die Gestaltung des Wohnraums eingriff, was die Privatsphäre stark einschränkte. Drei Phasen der Entwicklung der Wechselwirkungen zwischen Wohnbereich und Öffentlichkeit werden beschrieben (1917-Mitte der 1930er, Stalin-Ära, poststalinistische Phase).
Wie wird der Transformationsprozess in Russland behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Transformation des Wohnungsmarktes im postsowjetischen Russland und untersucht die sozio-ökonomischen Veränderungen sowie die historischen und kulturellen Bedingungen, die die schnelle Verbreitung und Akzeptanz von gated communities begünstigten. Ein wichtiger Aspekt ist die Veränderung des Verhältnisses zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre.
Was sind "gated communities" und warum werden sie in dieser Arbeit untersucht?
Gated communities sind abgeschlossene Wohnanlagen mit kontrolliertem Zugang. Die Arbeit untersucht sie als Sonderfall elitären Wohnens in Moskau und geht der Frage nach, welche Ursachen zu ihrer Entstehung und Verbreitung führten. Sicherheitskonzepte und soziale Aspekte dieser Wohnform werden ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselthemen werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselthemen sind die Entwicklung des sowjetischen Öffentlichkeitsbegriffs, die Transformation des Wohnungsmarktes, die Ursachen für die Entstehung und Verbreitung von gated communities, Sicherheitskonzepte und soziale Aspekte von gated communities sowie deren Bedeutung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen in Russland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur theoretischen Annäherung an den sowjetischen Öffentlichkeitsbegriff (inklusive eines Unterkapitels zur räumlichen Einordnung von Öffentlichkeit und Wohnraum), ein Kapitel zum Wohnungsmarkt in der Transformationsphase und ein Kapitel zu gated communities als Sonderfall elitären Wohnens (mit Unterkapiteln zu Ursachenforschung, Sicherheitskonzepten und Verbreitung/Akzeptanz). Ein Fazit schließt die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Gated Communities, Russland, Transformationsprozess, Sowjetunion, Öffentlichkeitsbegriff, Privatsphäre, Wohnungsmarkt, Stadtentwicklung, soziale Exklusion, Sicherheitskonzepte, elitäres Wohnen, sozialistische und kapitalistische Marktwirtschaft.
- Quote paper
- Bruno Yote (Author), 2008, Mauern, Zäune, Tore: Sozialräumliche Exklusion am Beispiel von gated communities in Russland (Moskau), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180345