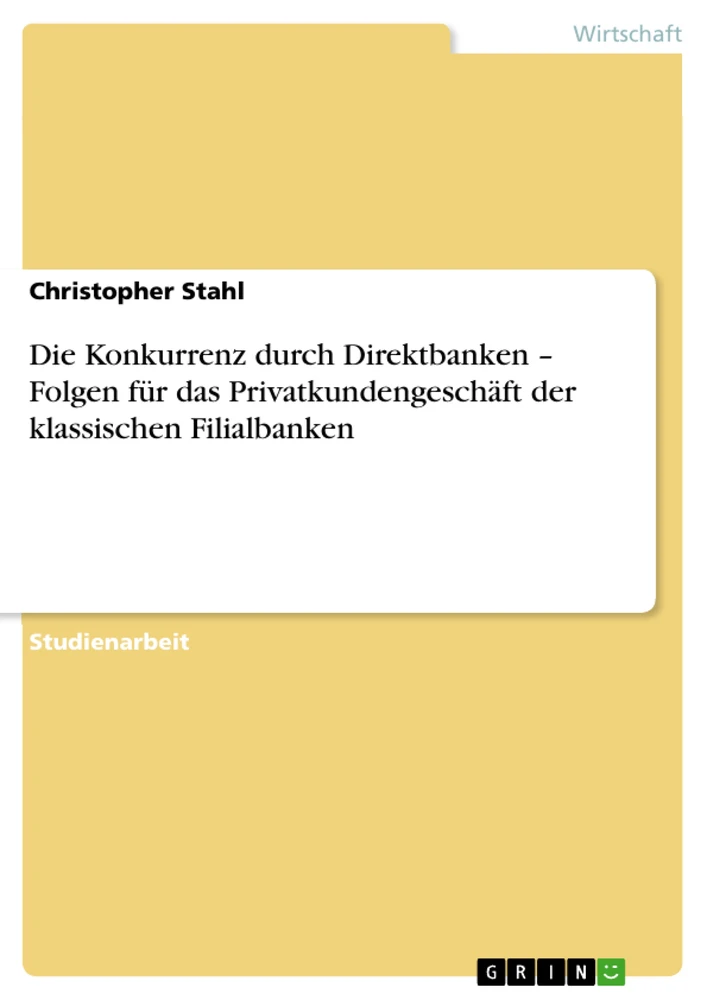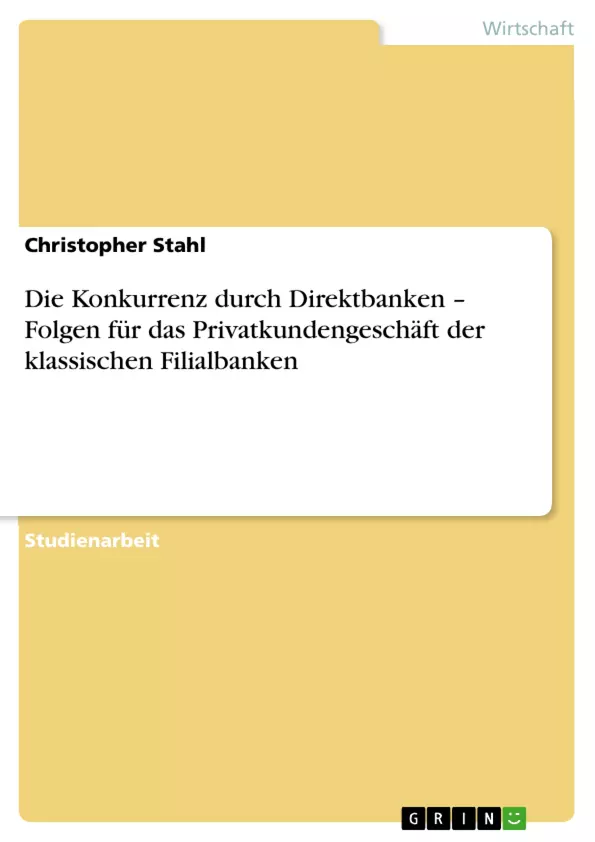urch die Presse gehen ständig neue Meldungen von Filialschließungen in Deutschland. Mitarbeiter werden durch moderne Automaten ersetzt, Banken fusionieren und der Konkurrenzdruck nimmt stetig zu.
Im Zeitalter des Internets und der Direktbanken könnte man glauben, dass Bankfilialen überflüssig geworden sind.
Doch diese sind keineswegs überflüssig.
Inzwischen wurde die Bedeutung der modernen und innovativen Filiale wieder erkannt. Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der Konkurrenz durch Direktbanken und den Auswirkungen auf die klassischen Filialbanken.
Sie ist gegliedert in zwei Hauptteile.
Im ersten Teil geht es um die Begriffsdefinition „Direktbank“ und anschließend um die grundlegenden Wesensmerkmale einer Direktbank.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit den Gründen des Wandels im Privatkundengeschäft, den Megatrends, den langfristigen Folgen und den Auswirkungen auf die klassischen Filialbanken.
Bei den Auswirkungen auf die klassischen Filialbanken wird zwischen der Anbieterebene und der Nachfragerebene unterschieden. Da es sich bei dieser Seminararbeit um ein sehr aktuelles Thema handelt, wurde keine Literatur benutzt, die nach dem Jahr 2000 erschienen ist. Diese Arbeit wurde anhand von verschiedenen wissenschaftlichen Fachbüchern und Internetartikeln zusammengestellt und soll die Aktualität inkl. den Auswirkungen dieses Themas widerspiegeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Direktbank
- Begriffsdefinition Direktbank
- Wesensmerkmale einer Direktbank
- Der Wandel im Privatkundengeschäft und die Folgen für die klassischen Filialbanken
- Die klassische Filialbank
- Gründe des Wandels im Privatkundengeschäft
- Megatrends
- Die langfristigen Folgen für das Privatkundengeschäft und die Auswirkungen auf die klassischen Filialbanken
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Konkurrenz durch Direktbanken und ihre Auswirkungen auf das Privatkundengeschäft klassischer Filialbanken. Sie beleuchtet die Definition und Wesensmerkmale von Direktbanken, die Gründe für den Wandel im Privatkundengeschäft sowie die Megatrends, die diesen Wandel prägen. Darüber hinaus untersucht die Arbeit die langfristigen Folgen für das Privatkundengeschäft und die Auswirkungen auf die klassischen Filialbanken.
- Begriffsdefinition und Wesensmerkmale von Direktbanken
- Gründe für den Wandel im Privatkundengeschäft
- Megatrends im Bankwesen
- Langfristige Folgen für das Privatkundengeschäft
- Auswirkungen auf die klassischen Filialbanken
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in das Thema „Direktbank“ ein und definiert den Begriff. Es werden die wesentlichen Merkmale einer Direktbank erläutert. Das zweite Kapitel untersucht den Wandel im Privatkundengeschäft und beleuchtet die Gründe für diesen Wandel. Es werden die Megatrends im Bankwesen sowie deren Folgen für das Privatkundengeschäft und die klassischen Filialbanken analysiert.
Schlüsselwörter
Direktbanken, Filialbanken, Privatkundengeschäft, Wandel, Megatrends, Folgen, Auswirkungen.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet eine Direktbank von einer klassischen Filialbank?
Direktbanken verzichten auf ein physisches Filialnetz und wickeln Bankgeschäfte primär über das Internet oder Telefon ab, was oft zu Kostenvorteilen führt.
Sind Bankfilialen im Zeitalter des Internets überflüssig geworden?
Nein, die Arbeit stellt fest, dass moderne und innovative Filialen weiterhin an Bedeutung gewinnen, auch wenn viele Standorte aufgrund des Konkurrenzdrucks schließen mussten.
Welche Megatrends beeinflussen das Privatkundengeschäft?
Die Seminararbeit analysiert langfristige Trends wie die Digitalisierung und den Wandel im Kundenverhalten, die den Wettbewerb zwischen Direkt- und Filialbanken verschärfen.
Welche Folgen hat die Konkurrenz für klassische Bankmitarbeiter?
Durch zunehmende Automatisierung und Fusionen werden Mitarbeiter oft durch moderne Automaten ersetzt, was zu einem Abbau klassischer Stellenprofile führt.
Wie reagieren Filialbanken auf den Wandel?
Klassische Banken versuchen, durch Innovationen in den Filialen und eine stärkere Differenzierung auf der Anbieter- und Nachfragerebene wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Arbeit zitieren
- Christopher Stahl (Autor:in), 2011, Die Konkurrenz durch Direktbanken – Folgen für das Privatkundengeschäft der klassischen Filialbanken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180397