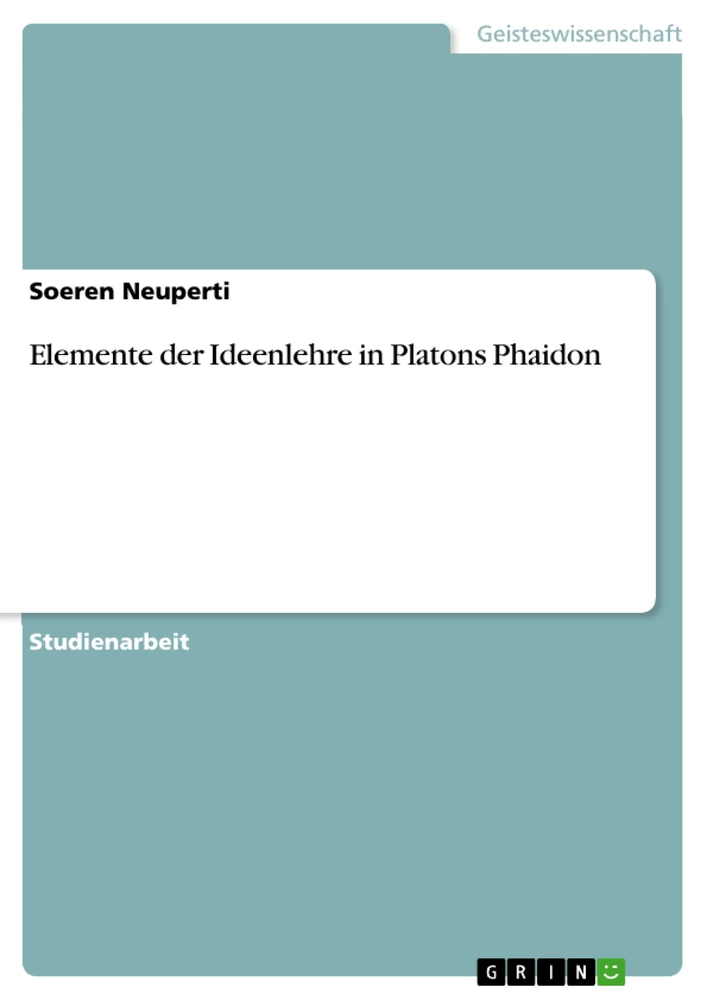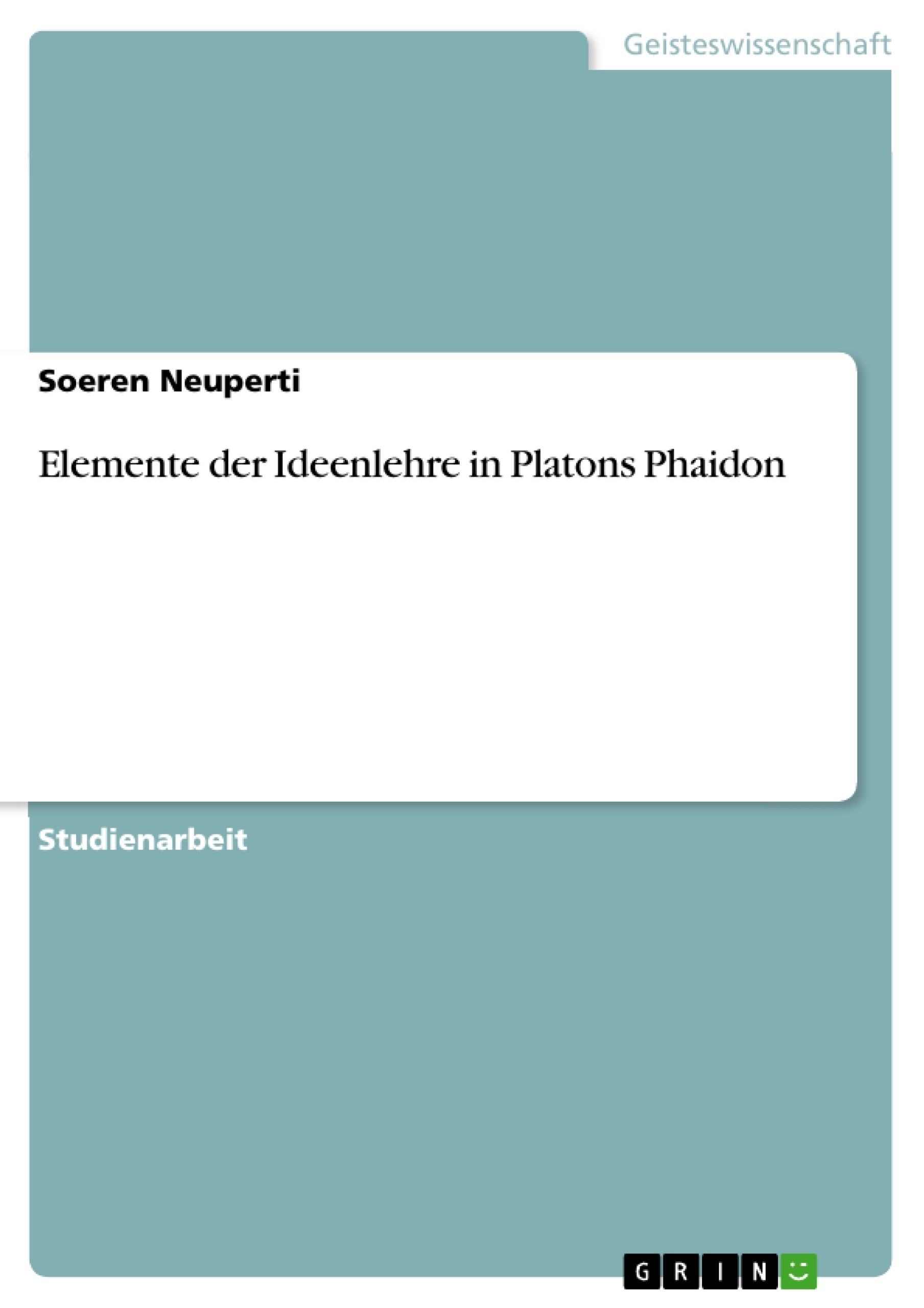Im Rahmen meiner Hausarbeit möchte ich die Elemente der platonischen ,,Ideenlehre" im ,,Phaidon" aufzeigen. Dabei werde ich auch auf andere Dialoge eingehen, wenn diese für die Erläuterung zur Hilfe genommen werden müssen. Ich werde mich dabei teilweise sehr nah am Primärtext bewegen, zum Teil aber auch, wenn es nötig ist, mir Abstand verschaffen und mit einem dem Dialog übergeordneten Blick auch auf die nicht explizit geäußerten, aber durchaus mit zu denkenden Bestimmungen Platons eingehen.
Ich habe den zweiten Teil meiner Hausarbeit in vier Abschnitte eingeteilt, die entweder die für die ,,Ideenlehre" wichtigen Voraussetzungen schaffen, bzw. Elemente der ,,Ideenlehre" beinhalten.
Als eine wichtige Voraussetzung werde ich in Punkt 1 die Ungenauigkeit der sinnlichen Wahrnehmung und den daraus folgenden Schluß, daß Wahrheit in der sinnlichen Wahrnehmung allein nicht zu suchen ist, betrachten. Ferner werde ich beleuchten, auf welche Weise Platon die zwei Gattungen des Seins bestimmt und wie er sich die notwendige Verbindung beider ,,Welten" im Rahmen seiner ,,Ideenlehre" vorstellt.
Unter den ziemlich offen dargelegten Elementen der ,,Ideenlehre" befinden sich unter anderem die Lehre der Wiedererinnerung (Anamnesis), die ich vor allem in Punkt 2b behandeln werde und die Lehre der Teilhabe (Metexis), die hauptsächlich in Punkt 2d ihren Platz findet.
In Punkt 3 werde ich die komplexen Betrachtungen noch einmal vereinfacht darstellen und so versuchen, ein anschauliches Gesamtbild der ,,Ideenlehre" zu skizzieren.
In Punkt vier werde ich die Probleme beleuchten, die sich während meiner Arbeit an der Hausarbeit ergaben und versuchen scheinbare Widersprüche der Ausarbeitung zu begründen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Elemente der „Ideenlehre“ im „Phaidon“
- „Als wir nun hineintraten, fanden wir den Sokrates eben entfesselt“ / Zur Begründung der Themenwahl
- „Dem Nichtreinen aber mag Reines zu berühren nicht vergönnt sein“ / Die Ungenauigkeit sinnlicher Wahrnehmung (65a - 68bc)
- Wiedererinnerung als Beweis für eine Praeexistenz der Seele und für eine Existenz der Ideen (72a - 77a)
- Das Eine und das Viele / Unwandelbarkeit und stetiges Werden
- Metexis (95e-107a)
- Die Verknüpfung beider „Welten“
- Teilhabe
- Die Rechtfertigung der Grundsetzungen des Denkens
- Die allgemeine Möglichkeit der Verbindung kontradiktorischer Prädikate mit dem Subjekt
- Die Unvergänglichkeit und Unveränderlichkeit der Ideen
- Die enge Verknüpfung verschiedener Denkbestimmungen im selben Subjekt
- Vereinfachte Zusammenfassung
- Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Elemente der platonischen „Ideenlehre“ im „Phaidon“ und bezieht dabei auch andere Dialoge ein, wenn diese zur Erläuterung notwendig sind. Der Fokus liegt auf der Analyse der „Ideenlehre“ durch den Vergleich mit dem Primärtext sowie der Betrachtung von impliziten Bestimmungen Platons.
- Die Ungenauigkeit der sinnlichen Wahrnehmung und die daraus resultierende Suche nach Wahrheit jenseits der Sinne
- Die Unterscheidung der „Werde-Welt“ und der „Ideenwelt“
- Die Lehre der Wiedererinnerung (Anamnesis) als Beweis für die Praeexistenz der Seele und die Existenz der Ideen
- Die Teilhabe (Metexis) der sinnlichen Dinge an den Ideen
- Die Unwandelbarkeit der Ideen und das stetige Werden der sinnlichen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert die Zielsetzung der Hausarbeit, die sich auf die Analyse der platonischen „Ideenlehre“ im „Phaidon“ konzentriert. Es wird betont, dass andere Dialoge bei Bedarf herangezogen werden und dass die Analyse sowohl den Primärtext als auch implizite Bestimmungen Platons umfasst.
- Elemente der „Ideenlehre“ im „Phaidon“: Dieser Abschnitt gliedert sich in verschiedene Unterpunkte, die sich mit wichtigen Aspekten der „Ideenlehre“ auseinandersetzen.
- Zur Begründung der Themenwahl: Dieser Abschnitt beleuchtet die Verbindung des „Phaidon“ mit der „Ideenlehre“ und interpretiert das Höhlengleichnis im siebten Buch der „Politeia“ als Bezugspunkt für die im „Phaidon“ dargestellte Philosophie.
- Die Ungenauigkeit sinnlicher Wahrnehmung (65a - 68bc): Dieser Teil untersucht die Unzulänglichkeit der sinnlichen Wahrnehmung für das Erfassen von Wahrheit. Dabei werden die Gedanken Platons mit denen von Demokrit verglichen und die These Platons, dass nur die Seele selbst das Sein erfassen kann, anhand des Dialogs „Theätet“ erläutert.
- Wiedererinnerung als Beweis für eine Praeexistenz der Seele und für eine Existenz der Ideen (72a - 77a): Dieser Abschnitt analysiert die Wiedererinnerung (Anamnesis) als Beweis für die Praeexistenz der Seele und die Existenz der Ideen. Dabei wird auf den Dialog „Menon“ verwiesen, der ebenfalls die Erkenntnis als Wiedererinnerung thematisiert. Der Abschnitt erklärt die Beweisführung Platons, die auf der Unterscheidung zwischen „Gleichheit“ und „Gleichem selbst“ basiert.
- Das Eine und das Viele / Unwandelbarkeit und stetiges Werden: Dieser Teil untersucht die Unwandelbarkeit des reinen Seins und die Unterscheidung zwischen dem „Unzusammengesetzten“ und dem „Zusammengesetzten“. Platon argumentiert, dass das sich ständig Verändernde der zusammengesetzten Welt der Sinne, im Gegensatz zu dem unveränderlichen, unzusammengesetzten Wesen der Ideen, angehört.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: „Ideenlehre“, „Phaidon“, „Platon“, „sinnliche Wahrnehmung“, „Wiedererinnerung“ (Anamnesis), „Teilhabe“ (Metexis), „Unwandelbarkeit“, „Ideenwelt“, „Werde-Welt“, „Wahrheit“
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Elemente der Ideenlehre im Phaidon?
Zu den Kernelementen gehören die Unterscheidung zwischen der sinnlich wahrnehmbaren Welt und der Welt der Ideen, die Unwandelbarkeit der Ideen sowie die Konzepte der Wiedererinnerung (Anamnesis) und der Teilhabe (Metexis).
Was versteht Platon unter Anamnesis?
Anamnesis bezeichnet die Lehre der Wiedererinnerung. Platon argumentiert, dass Erkenntnis eigentlich eine Wiedererinnerung der Seele an die Ideen ist, die sie vor ihrer körperlichen Existenz geschaut hat.
Wie definiert Platon das Konzept der Metexis?
Metexis steht für die Teilhabe. Es beschreibt das Verhältnis, in dem die vergänglichen Dinge der Sinnenwelt zu den ewigen, unveränderlichen Ideen stehen, durch die sie erst ihre Form und Bestimmung erhalten.
Warum ist die sinnliche Wahrnehmung laut Platon ungenau?
Die sinnliche Wahrnehmung bezieht sich auf die Welt des Werdens und Vergehens. Da sich diese Welt ständig verändert, kann sie keine dauerhafte Wahrheit liefern; diese ist nur durch die Vernunft in der Welt der Ideen zu finden.
Welche Rolle spielt die Seele in Platons Erkenntnistheorie?
Die Seele dient als Bindeglied zwischen den Welten. Nur sie ist in der Lage, das wahre Sein (die Ideen) zu erfassen, da sie selbst dem Unvergänglichen nähersteht als der Körper.
- Arbeit zitieren
- Soeren Neuperti (Autor:in), 1998, Elemente der Ideenlehre in Platons Phaidon, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1804