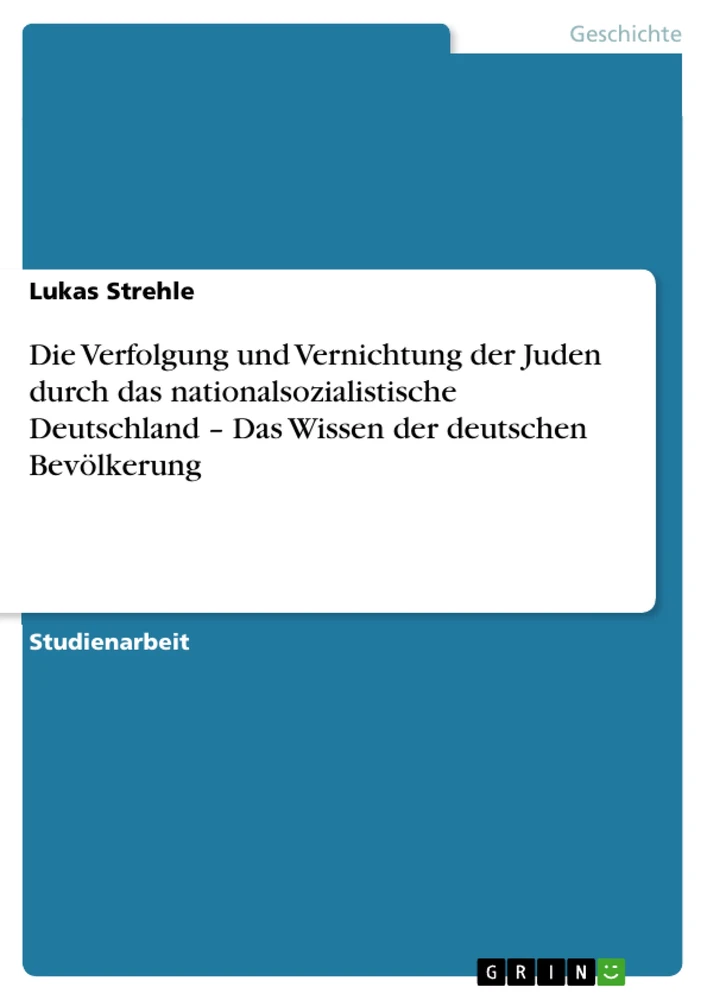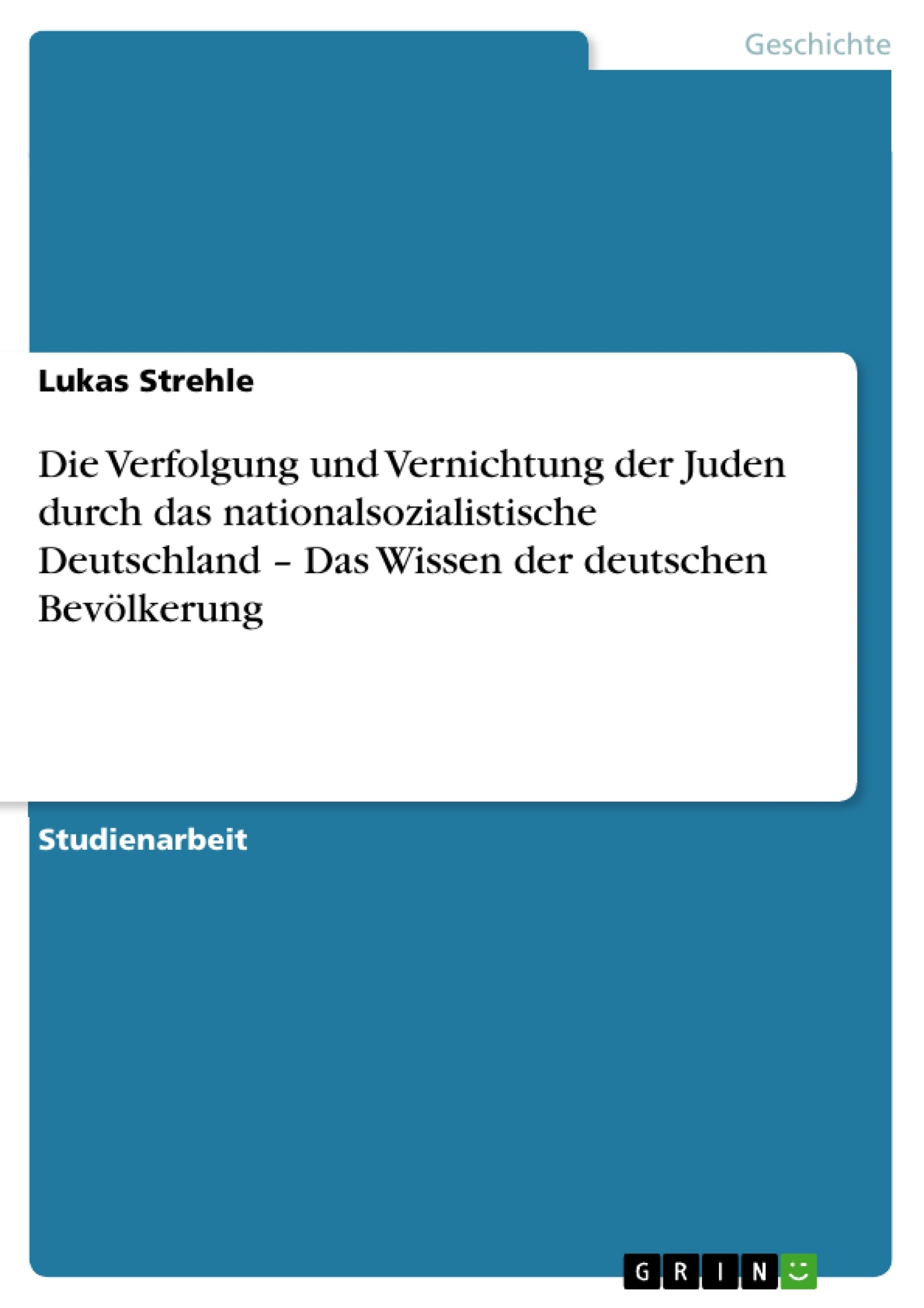Die Zahl der vom NS-Regime zwischen 1933 und 1945 ermordeten Juden beträgt nach vorsichtigen Schätzungen zwischen fünf und sechs Millionen , was im Durchschnitt folglich etwa 500.000 getötete Menschen im Jahr oder über 1300 Opfer am Tag bedeutet. Neben aller Betroffenheit angesichts solcher Zahlen, neben allen technischen, organisatorischen und ereignisgeschichtlichen Details und der prinzipiellen Frage, wie ein solcher Massenmord überhaupt möglich war, verdient bei der Behandlung der Judenverfolgung und –vernichtung auch und nicht zuletzt das Stattfinden des Holocaust unter den Augen der deutschen Bevölkerung Beachtung. Denn im deutlichen Gegensatz zu den unvorstellbaren Opferzahlen steht die Aussage vieler Deutscher nach 1945: „Davon haben wir nichts gewusst.“
Aus der Perspektive der älteren Generation, die mit dieser Aussage wohl vor allem eine eigene Schuld an der Judenverfolgung und –vernichtung zurückweisen und dem vermuteten Vorwurf der Unterstützung des NS-Regimes entgegentreten wollte, erscheint diese im Lauf der Zeit zur kollektiven Abwehr einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema gewordene Aussage verständlich. Aus der Perspektive des nachgeborenen Historikers drängen sich jedoch zahlreiche Fragen auf. Was ist mit „davon“ überhaupt gemeint? Welche Aspekte der Judenverfolgung waren den Deutschen bekannt und welche nicht? Gab es unterhalb der Ebene des Wissens nicht möglicherweise Bereiche des Ahnens, des Vermutens, gab es Gerüchte oder Hinweise? Mussten manche Dinge nicht zwangsläufig bekannt werden?
Es ist schwer, wenn nicht unmöglich, auf diese Fragen rückblickend nach 1945 eine verlässliche Antwort zu erhalten. Ein Schritt zur Lösung dieses Problems liegt in der Wahl der Herangehensweise; das Wissen der Deutschen muss für jede Etappe der Judenverfolgung, für alle Schritte und Maßnahmen von 1933 bis 1945, mithilfe der jeweils zeitgenössischen Quellen erschlossen werden. Denn wo man auf diese Frage an einen Zeitzeugen heute als Antwort das typische „Davon haben wir nichts gewusst!“ erhalten würde, kann einem der Blick in die unverfälschten Quellen verraten, was die Deutschen wissen konnten, mussten, was sie vermuteten oder auch was sie eben nicht wissen konnten.
Im Folgenden soll – nach einem Überblick über die prinzipiell verwendbaren Quellen und die besondere Quellenproblematik des Themas – erläutert werden, was die Deutschen von den jeweiligen Etappen der Judenverfolgung zwischen 1933 und 1945 wissen, ahnen oder vermuten konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenproblematik
- Das Wissen der deutschen Bevölkerung
- Die erste Phase - Soziale Ausgrenzung und Diffamierung (1933-1941)
- Juden-Boykotte und Nürnberger Gesetze
- Novemberpogrom 1938
- Die Judenfrage nach Kriegsbeginn – Auswanderung, Ghettobildung, Zwangsarbeit
- Die zweite Phase - Deportation und Vernichtung (1941-1945)
- Vorstufe der Vernichtung – Die Deportationen
- Systematische Vernichtung – Die „Endlösung“
- Hindernisse und Möglichkeiten der Wahrnehmung
- Hindernisse
- Möglichkeiten
- Die erste Phase - Soziale Ausgrenzung und Diffamierung (1933-1941)
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Wissen der deutschen Bevölkerung über die Verfolgung und Vernichtung der Juden durch das nationalsozialistische Deutschland zwischen 1933 und 1945. Sie analysiert die zeitgenössischen Quellen und die damit verbundene Quellenproblematik, um zu erforschen, was den Deutschen in den verschiedenen Phasen der Judenverfolgung bekannt war, vermutet wurde oder nicht wissen konnte.
- Die verschiedenen Phasen der Judenverfolgung und ihre Auswirkungen auf das Leben der Deutschen
- Die Quellenproblematik und die Herausforderungen der Rekonstruktion des Wissens
- Die Rolle von Propaganda und Medien in der Verbreitung von Informationen
- Die Wahrnehmung und die Reaktionen der deutschen Bevölkerung auf die Verbrechen des NS-Regimes
- Die Frage nach dem individuellen Wissen und der kollektiven Verantwortung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Frage nach dem Wissen der deutschen Bevölkerung über den Holocaust. Die Quellenproblematik wird im zweiten Kapitel behandelt, wobei die Schwierigkeit, verlässliche Informationen aus nachkriegszeitlichen Quellen zu gewinnen, herausgestellt wird. Das dritte Kapitel untersucht das Wissen der Deutschen in den verschiedenen Phasen der Judenverfolgung, beginnend mit der sozialen Ausgrenzung und Diffamierung, über die Deportation bis hin zur systematischen Vernichtung.
Schlüsselwörter
Judenverfolgung, Holocaust, NS-Regime, deutsche Bevölkerung, Wissen, Quellenproblematik, Propaganda, Wahrnehmung, Verantwortung, Deportation, Vernichtung.
Häufig gestellte Fragen
Wussten die Deutschen wirklich nichts vom Holocaust?
Die Arbeit untersucht die Aussage "Davon haben wir nichts gewusst" kritisch. Zeitgenössische Quellen zeigen, dass viele Etappen der Verfolgung unter den Augen der Bevölkerung stattfanden.
Was war der deutschen Bevölkerung über die Juden-Boykotte bekannt?
Die soziale Ausgrenzung, die Boykotte von 1933 und die Nürnberger Gesetze waren öffentliche Ereignisse, die durch Propaganda und Medien aktiv verbreitet wurden und somit allgemein bekannt waren.
Welche Informationen gab es über die Deportationen?
Deportationen fanden oft am helllichten Tag in Städten statt. Gerüchte über das Schicksal der Deportierten verbreiteten sich trotz Geheimhaltung der "Endlösung" durch Augenzeugenberichte und Soldaten auf Heimaturlaub.
Wie erschweren NS-Quellen die historische Rekonstruktion?
Die Quellenproblematik liegt in der staatlich gesteuerten Propaganda einerseits und der bewussten Verschleierung von Massenmorden (Tarnsprache) andererseits.
Welche Rolle spielten Gerüchte während des Krieges?
Neben gesichertem Wissen gab es weitreichende Bereiche des Ahnens und Vermutens. Gerüchte über Massenerschießungen im Osten waren in vielen Teilen der Bevölkerung präsent.
- Quote paper
- Lukas Strehle (Author), 2008, Die Verfolgung und Vernichtung der Juden durch das nationalsozialistische Deutschland – Das Wissen der deutschen Bevölkerung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180485