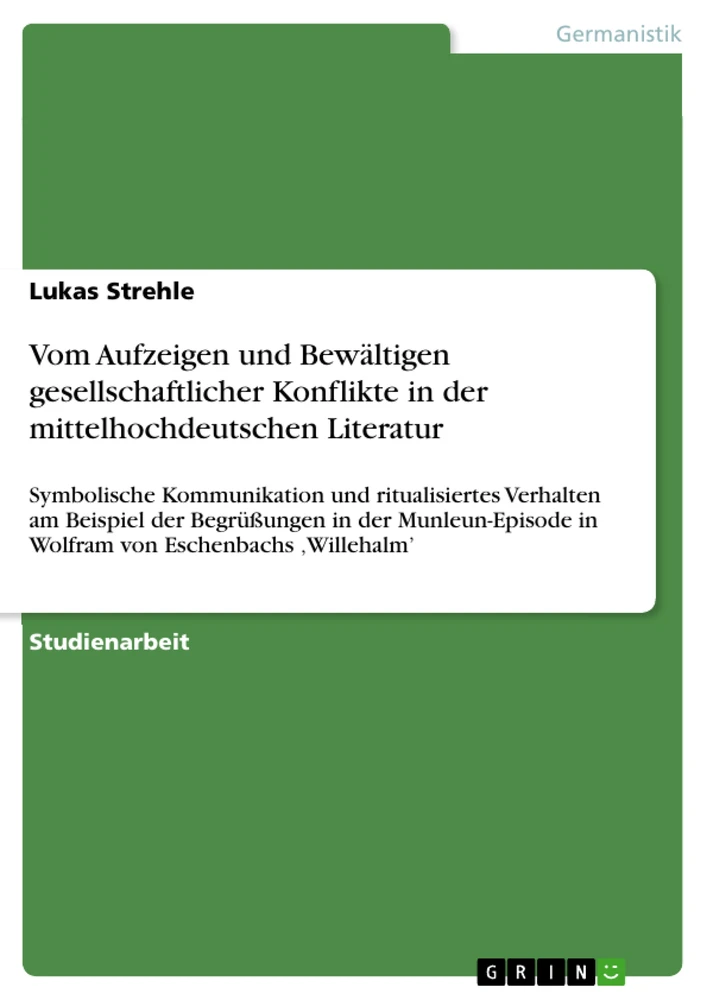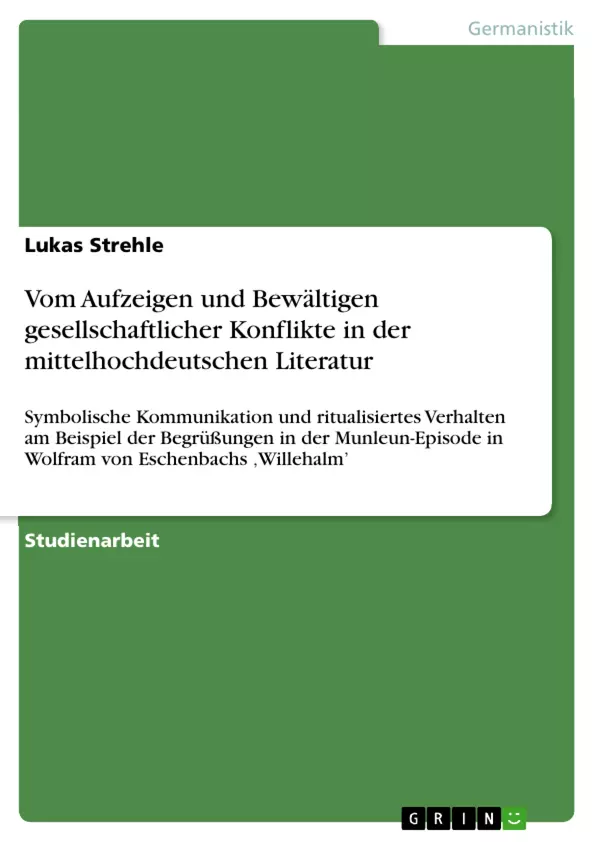Um ein Verständnis für mittelalterliche Verhaltensweisen zu entwickeln, hilft ein unvoreingenommener Blick auf die Wege und Formen der Kommunikation im Mittelalter; insbesondere das ritualisierte Verhalten der Führungsschichten in der Öffentlichkeit ist hierbei von großer Bedeutung. Während diese sogenannte „symbolische Kommunikation“ in der historischen Abteilung der Mediävistik inzwischen ein zunehmend häufiger beschrittener Weg zur Interpretation mittelalterlicher Verhaltens- und Denkweisen ist – vor allem Gerd Althoff ist hier bahnbrechend zu nennen – fand sie in der literarischen Mittelalterforschung bislang kaum Beachtung. Eine Ausnahme und daher wichtige Grundlage dieser Arbeit stellt die detaillierte Untersuchung der „Poetik des Rituals“ von Corinna Dörrich dar.
Die Erkenntnis, dass mittelalterliche Ehrvorstellungen, Verhaltensweisen und Kommu-nikationsformen kaum mit modernen Maßstäben zu erfassen sind, ist an und für sich nicht überraschend. Ebenso wenig die Tatsache, dass Politik im Mittelalter in aller Regel öffentlich stattfand, oftmals demonstrativen Charakter hatte und, um mit Gerd Althoff zu sprechen, genauen Spielregeln unterworfen war, Regeln also, die „in bestimmten Situationen von bestimmten Personen zwingend erwartet wurden [und deren Einhaltung] eine reibungslose, konfliktfreie Kommunikation erst“ ermöglichten. Umso erstaunlicher ist es jedoch, dass gerade diesen Aspekten bei der Analyse und Interpretation mittelhochdeutscher Literatur bislang so wenig Beachtung geschenkt wurde und ihr Vorkommen in höfischer wie Heldenepik in der Regel eher als schmückendes Detail denn als realistische Darstellung von Politik und Gesellschaftskonstellationen gedeutet wurde.
Diese Arbeit soll daher einen Beitrag zum besseren Verständnis mittelalterlichen Verhaltens aus literaturwissenschaftlicher Sicht leisten. Nach einem Überblick über die Funktionen relevanter Rituale werden am Beispiel der Munleun-Episode aus Wolfram von Eschenbachs ‚Willehalm’ Funktionieren und Störung gesellschaftlicher Ordnung, Entstehung und Bewältigung politischer Konflikte und die dazu notwendigen Spielregeln symbolischer Kommunikation untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Funktionen ritualisierten Verhaltens
- Scheitern und Wiederaufnahme symbolischer Kommunikation – Die Munleun-Episode
- Gestörte Kommunikation I - Willehalms Eintreffen am Hof
- Gestörte Kommunikation II – Verhalten der Königin und Schwester Willehalms
- Funktionierende Kommunikation I – Der Kaufmann Wimar
- Funktionierende Kommunikation II / Gestörte Kommunikation III – Der Empfang der Narbonner Sippe am Hof
- Gestörte Kommunikation IV – Willehalms Auftritt vor dem Königspaar
- Wiederhergestellte Kommunikation I – Willehalms Begrüßung durch seine Familie
- Wiederhergestellte Kommunikation II – Vermittlung durch Alyze
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, ein besseres Verständnis mittelalterlichen Verhaltens aus literaturwissenschaftlicher Sicht zu fördern. Anhand der Munleun-Episode aus Wolfram von Eschenbachs Willehalm werden die Funktionsweise und Störung gesellschaftlicher Ordnung, die Entstehung und Bewältigung politischer Konflikte sowie die dazu notwendigen Spielregeln symbolischer Kommunikation untersucht.
- Die Bedeutung ritualisierten Verhaltens in der mittelalterlichen Gesellschaft
- Die Funktion symbolischer Kommunikation im Kontext von höfischen Interaktionen
- Die Darstellung von Konflikten und deren Bewältigung durch ritualisiertes Verhalten
- Die Rolle von Status und Rang im mittelalterlichen Kommunikationssystem
- Die Analyse der Munleun-Episode als Fallbeispiel für die Anwendung von ritualisierter Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Werk Willehalm und seine zentrale Thematik - die detaillierte Darstellung eines mittelalterlichen Weltkrieges - vor. Es wird hervorgehoben, dass das Epos neben der Kriegshandlung weitere Themenkomplexe behandelt, wie Krieg und Religion, Fremdheit und Verwandtschaft, Gewalt und Toleranz. Außerdem wird der Fokus auf die Bedeutung ritualisierten Verhaltens in der mittelalterlichen Gesellschaft gelegt und dessen bisherige geringe Beachtung in der literaturwissenschaftlichen Forschung kritisiert.
- Funktionen ritualisierten Verhaltens: In diesem Abschnitt wird der Bedeutung von ritualisiertem Verhalten in der mittelalterlichen Gesellschaft nachgegangen. Es werden die verschiedenen Funktionen solcher Verhaltensmuster erläutert, wie sie die Ordnung stifteten und bewahrten und die mit öffentlicher Kommunikation verbundenen Risiken kalkulierbarer machten.
- Scheitern und Wiederaufnahme symbolischer Kommunikation – Die Munleun-Episode: Der Hauptteil der Arbeit widmet sich der Analyse der Munleun-Episode aus Willehalm. In diesem Abschnitt werden verschiedene Situationen und die darin zum Ausdruck kommenden Störungen und Wiederherstellungen symbolischer Kommunikation untersucht.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter für diese Arbeit sind: mittelalterliche Gesellschaft, ritualisiertes Verhalten, symbolische Kommunikation, Willehalm, Wolfram von Eschenbach, Munleun-Episode, höfische Rituale, Konfliktbewältigung, politische Ordnung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „symbolischer Kommunikation“ im Mittelalter?
Symbolische Kommunikation bezeichnet ritualisiertes Verhalten und öffentliche Gesten, die politische Absichten, Machtverhältnisse und soziale Ordnung ausdrücken.
Welche Rolle spielt die Munleun-Episode in Wolframs „Willehalm“?
Die Episode dient als Fallbeispiel für das Scheitern und die Wiederherstellung gesellschaftlicher Ordnung durch ritualisierte Kommunikation am königlichen Hof.
Warum sind Rituale für die mittelalterliche Führungsschicht so wichtig?
Rituale schufen „Spielregeln“, die Kommunikation kalkulierbar machten, Konflikte entschärften und den sozialen Rang der Beteiligten öffentlich bestätigten.
Wie entstehen politische Konflikte laut dieser literarischen Analyse?
Konflikte entstehen oft durch die Störung oder Missachtung von Kommunikationsregeln, wie z. B. eine verweigerte Begrüßung oder ein unangemessenes Auftreten vor dem Herrscher.
Wer war Gerd Althoff und warum ist er für dieses Thema relevant?
Gerd Althoff ist ein Historiker, der bahnbrechende Forschung zu den Spielregeln der Politik und der symbolischen Kommunikation im Mittelalter geleistet hat.
- Quote paper
- Lukas Strehle (Author), 2009, Vom Aufzeigen und Bewältigen gesellschaftlicher Konflikte in der mittelhochdeutschen Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180491