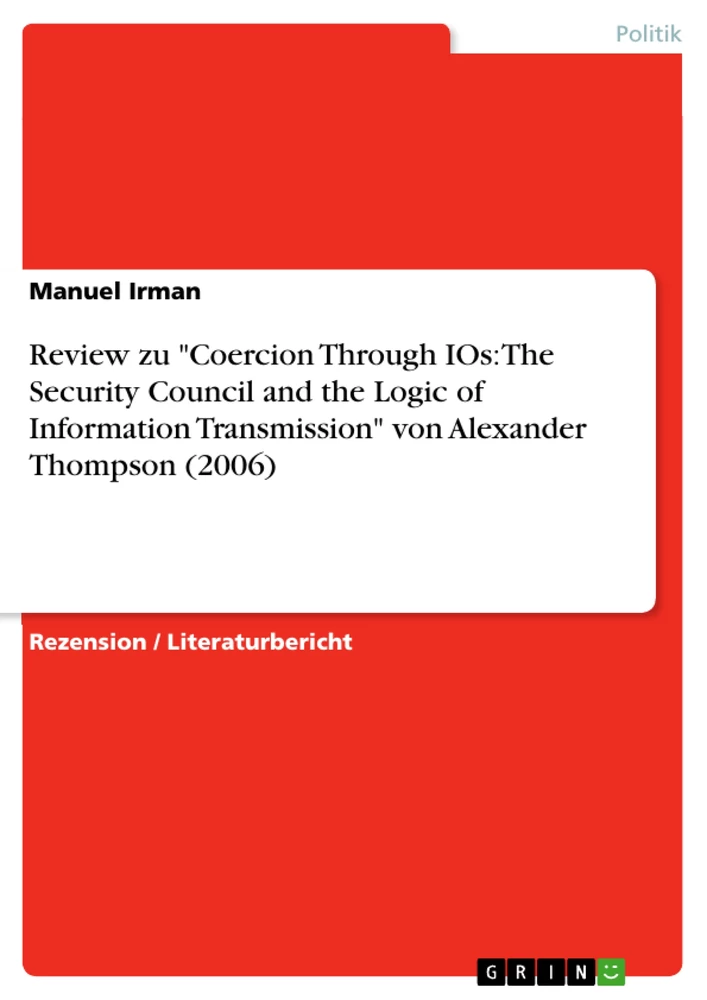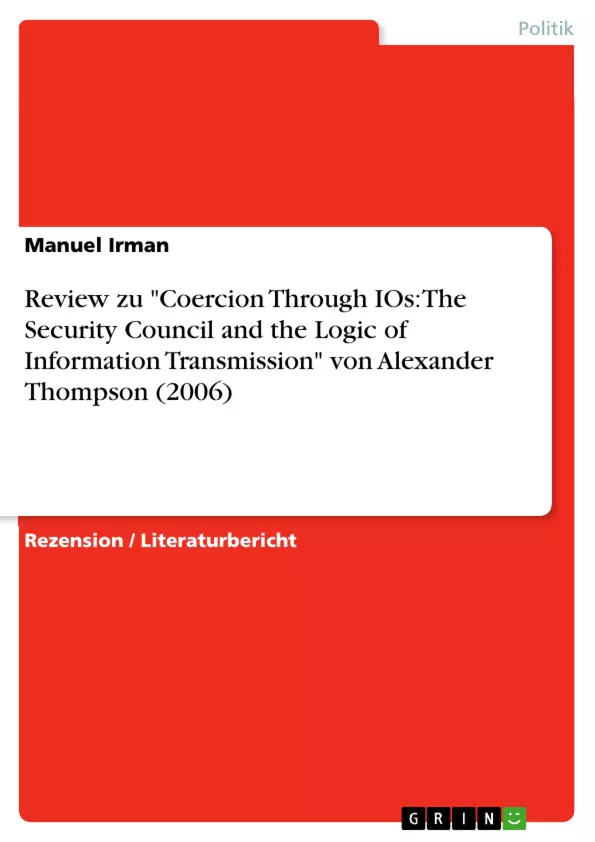In seinem Artikel “Coercion Through IOs” erläutert Alexander Thompson, weshalb sich selbst mächtige Staaten immer häufiger an internationale Gremien wenden, um ihre Sicherheitsanliegen unter Anwendung von Zwang durchzusetzen. Die wichtigsten Argumente Thompsons sind in diesem Review zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Kontextualisierung
- Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text von Thompson analysiert die Nutzung von internationalen Organisationen (IOs) durch mächtige Staaten zur Abstimmung des Einsatzes von Gewalt. Aus rationalistischer Perspektive werden IOs als Agenten der internationalen Gemeinschaft betrachtet, wobei die Rolle des UN-Sicherheitsrates (UNSR) als zentrale Plattform für die Koordinierung von militärischen Interventionen hervorgehoben wird. Der Artikel untersucht die strategische Informationsübermittlung, die der coercing state durch die Einbindung einer IO nutzt, um seine Interessen gegenüber Drittstaaten zu legitimieren und die politischen Kosten zu minimieren.
- Die strategische Nutzung von IOs zur Minimierung von Kosten bei der Anwendung von Gewalt
- Die Rolle der Informationsübermittlung und der Glaubwürdigkeit von IOs
- Der Vergleich zwischen unilateralen und multilateralen Interventionen
- Die Bedeutung von Legitimität und nationalem Interesse bei der Anwendung von Zwang
- Die Kritik an der traditionellen Legitimitätsdebatte im Kontext von Global Governance
Zusammenfassung der Kapitel
Zusammenfassung
Der Text argumentiert, dass mächtige Staaten zunehmend IOs zur Abstimmung ihres Einsatzes von Gewalt nutzen, insbesondere den UNSR. Thompson betrachtet IOs als Agenten der internationalen Gemeinschaft, die durch ihre Heterogenität Glaubwürdigkeit erlangen. Der Golfkrieg von 1990/91 dient als Fallstudie, um zu zeigen, wie die USA die Einbindung des UNSR zur Minimierung politischer Kosten und zur Legitimierung des militärischen Eingriffs nutzten.
Kontextualisierung
Die Debatte über die Legitimität von Institutionen im Zusammenhang mit Global Governance hat eine lange Tradition. Nach dem Ende des Kalten Krieges gewann das Konzept der coercion an Bedeutung. Der UNSR war gezwungen, neue Mittel und Methoden zur Konfliktlösung zu entwickeln, was zu einer verstärkten Anwendung von Zwangsmassnahmen nach Kapitel VII der UN-Charta führte. Die NATO-Intervention in Kosovo 1999 ohne UNSR-Mandat zeigt die Grenzen des multilateralen Vorgehens und die zunehmende Nutzung von Ad-hoc-Koalitionen auf.
Kritik
Thompson argumentiert, dass die Heterogenität von IOs zu einer höheren Glaubwürdigkeit führt, da sie weniger radikale Positionen einnehmen können als temporäre Koalitionen. Der Text wirft jedoch die Frage auf, ob die strategische Informationsübermittlung durch IOs tatsächlich zu einer Überzeugung von Drittstaaten führt. Darüber hinaus wird die Rolle von Legitimität im Vergleich zur Rationalität hinterfragt. Thompson fokussiert sich auf den Golfkrieg von 1990/91 als Fallstudie, die jedoch nicht alle relevanten Fälle abdeckt, wie den Irakkrieg oder die Kosovointervention.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit den Themen Global Governance, internationale Organisationen, Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, strategische Informationsübermittlung, Zwangsanwendung, Legitimität, unilaterale und multilaterale Interventionen, Rationalität, Kostenminimierung, politische Kosten, Fallstudie, Golfkrieg 1990/91.
Häufig gestellte Fragen
Warum nutzen mächtige Staaten laut Thompson internationale Organisationen (IOs)?
Um ihre Sicherheitsanliegen durch strategische Informationsübermittlung zu legitimieren und die politischen Kosten militärischer Interventionen zu minimieren.
Welche Rolle spielt der UN-Sicherheitsrat in Thompsons Argumentation?
Er fungiert als zentrale Plattform, die durch ihre Heterogenität Glaubwürdigkeit vermittelt und so Interventionen gegenüber Drittstaaten legitimiert.
Welches historische Beispiel dient als Fallstudie?
Der Golfkrieg von 1990/91 wird herangezogen, um die erfolgreiche Einbindung des UN-Sicherheitsrates durch die USA zu zeigen.
Was ist der Unterschied zwischen unilateralen und multilateralen Interventionen?
Multilaterale Interventionen über IOs sind glaubwürdiger und kosteneffizienter, während unilaterale Schritte oft höhere politische Widerstände provozieren.
Welche Kritik wird an Thompsons Modell geäußert?
Kritiker hinterfragen, ob strategische Information tatsächlich Drittstaaten überzeugt und ob das Modell auf Fälle wie den Irakkrieg 2003 anwendbar ist.
- Arbeit zitieren
- M.A. Manuel Irman (Autor:in), 2008, Review zu "Coercion Through IOs: The Security Council and the Logic of Information Transmission" von Alexander Thompson (2006), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180511