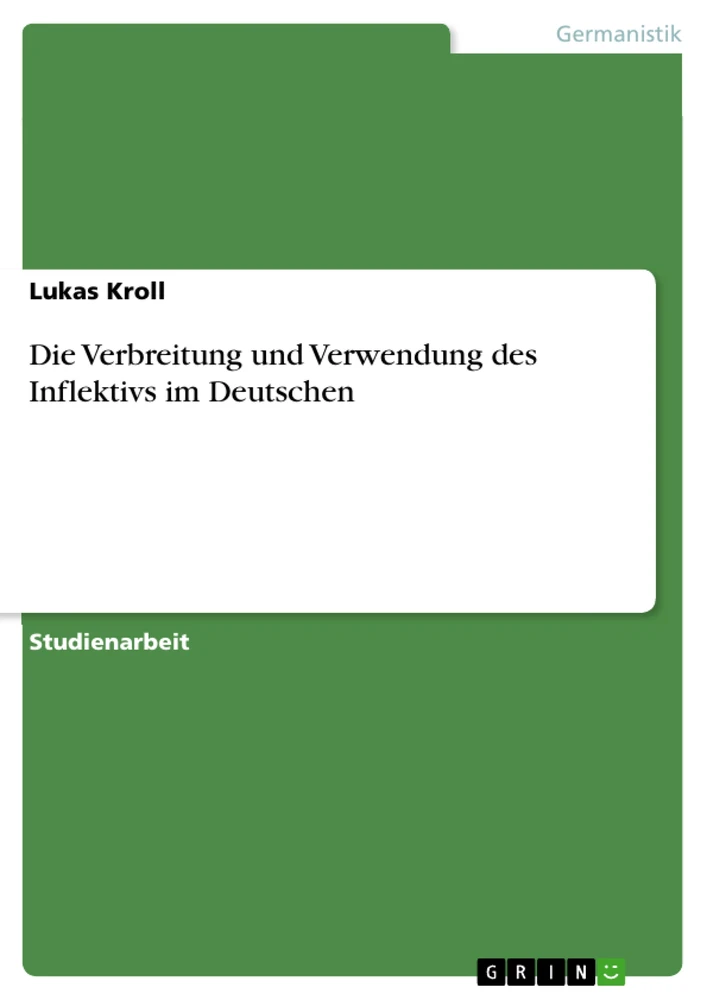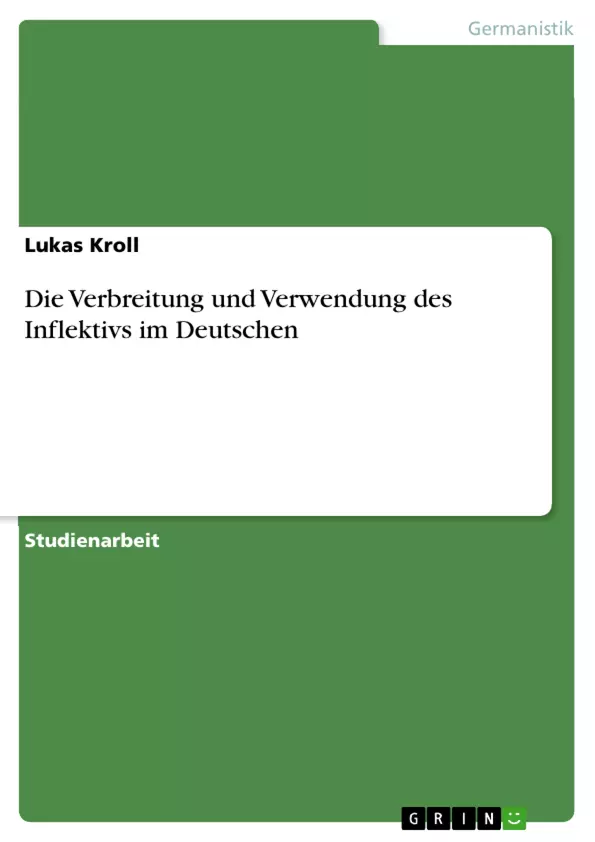Die Weltbevölkerung und ihre Um- und Mitwelt befinden sich im Zustand stetiger Entwicklungen und Neuerungen. Abgesehen von technischen Innovationen, die ihren Ausgangspunkt größtenteils in der Industrialisierung haben, bestimmen soziale oder ökologische Entwicklungen die gesellschaftliche Organisation und deren Handeln auf diesem Planeten. Auch wenn es teilweise schwer fallen mag in diesen Tendenzen eine wahre Progression auszumachen, stellen sie neue Anforderungen an die Menschheit. Auch die Geisteswissenschaften sind von diesem Prozess betroffen. Bezüglich des Forschungsfeldes der Linguistik stellen die Neuerungen des 20. und 21. Jahrhunderts besondere Herausforderungen an Forscher und Forschung. Die globale Verfügbarkeit einer immensen Anzahl an Print-Medien, die Mediatisierung der Gesellschaft sowie die Schaffung eines virtuellen Raumes, in Form des Internets, sind Phänomene, die das Forschungsgebiet abermals erweitert haben und auch in Zukunft noch erweitern werden. Hinzu tritt die Tatsache, dass Sprache sich ebenfalls durch ständige Entwicklung kennzeichnet. Hadumod Bußmann definiert Sprache als:
„Auf kognitiven Prozessen basierendes, gesellschaftlich bedingtes, historischer Entwicklung unterworfenes Mittel zum Ausdruck bzw. Austausch von Gedanken, Vorstellungen, Erkenntnissen und Informationen sowie zur Fixierung und Tradierung von Erfahrung und Wissen.“1.
Diese kurze Definition deutet die Komplexität und Vielschichtigkeit von Sprache und Sprachwissenschaft bereits an und impliziert auch ihren stetigen Wandel. In meinen Ausführungen werde ich mich zwar primär mit geschriebener Sprache befassen, dies soll allerdings kein Indiz dafür sein, dass die beschriebenen Konstruktionen sich nicht auch im Sprachgebrauch etablieren oder es vielleicht schon sind2. Als Ausgangsbasis für meine Untersuchungen dient mir Peter Schlobinskis Aufsatz „*knuddel-zurueckknuddel- dichganzdollknuddel* - Inflektive und Inflektivkonstruktionen im Deutschen“3. Wie der Titel bereits vermuten lässt, orientiert sich Schlobinski eher an den modernen Forschungsfeldern der Linguistik. Inhaltlich befasst er sich in diesem Fall spezifisch mit SMS- und Chat-Kommunikation sowie verschiedenen Comics. Das von ihm untersuchte linguistische Phänomen der Inflektive ist somit vornehmlich in diesen genannten Gattungen anzutreffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Einordnung in die Sprachlandschaft
- 1.2 Definition
- 2. Hauptteil
- 2.1 Inflektive als Erfindung der Comicschreiber?
- 2.2 Der Inflektiv und seine semantischen Variationen
- 2.3 Der Inflektiv als Element der Internet-Kommunikation
- 3. Resümee
- 3.1 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Verbreitung und Verwendung des Inflektivs im Deutschen. Der Fokus liegt dabei auf der sprachhistorischen Entwicklung, der semantischen Variation und der Rolle des Inflektivs in der Internet-Kommunikation.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Inflektiv“
- Der Inflektiv als sprachhistorisches Phänomen
- Die semantische Variation des Inflektivs
- Der Inflektiv in der Internet-Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung
Die Einleitung führt in die Thematik der Sprachentwicklung und Neuerungen ein. Sie stellt die Bedeutung von Sprache in der heutigen Gesellschaft heraus und betont die Herausforderungen, die sich aus den Medienentwicklungen des 20. und 21. Jahrhunderts ergeben. Als Grundlage dient die Definition von Sprache nach Hadumod Bußmann. Im weiteren Verlauf werden die Forschungsarbeiten von Peter Schlobinski vorgestellt, der sich insbesondere mit der Verwendung des Inflektivs in SMS-, Chat- und Comic-Kommunikation beschäftigt.
1.1 Einordnung in die Sprachlandschaft
Dieser Abschnitt beleuchtet die Einflüsse der Globalisierung und Medialisierung auf die Sprachentwicklung. Es wird argumentiert, dass die Verbreitung von Print-Medien, die Mediatisierung der Gesellschaft und das Internet neue Herausforderungen für die Linguistik schaffen.
1.2 Definition
Der Abschnitt behandelt die Problematik der Definition des Begriffs „Inflektiv“ und beleuchtet die verschiedenen Ansätze von Forschern wie Peter Schlobinski, Elke Hentschel, Harald Weydt und Oliver Teuber. Schlobinski stellt den Inflektiv als eine eigenständige Verbform dar und widerlegt die Interpretation des Inflektivs als Interjektion. Die verschiedenen Forschungsmeinungen werden zusammengefasst und schließlich in Schlobinskis These mündend, die den Inflektiv als prädikativ gebrauchte Verbstämme begreift.
2. Hauptteil
Der Hauptteil widmet sich der Untersuchung des Inflektivs in verschiedenen Kontexten und beleuchtet die Verwendung in Comics, Chat-Kommunikation und der semantischen Variation des Inflektivs.
2.1 Inflektive als Erfindung der Comicschreiber?
Dieser Abschnitt untersucht die Geschichte der Comics in Deutschland und hinterfragt, ob Inflektivkonstruktionen bereits in der Frühphase der Comics verwendet wurden. Es wird die Frage nach dem Ursprung des Inflektivs aufgeworfen und der Streit um das Urheberrecht beleuchtet. Die Argumentation von Oliver Teuber, der den Inflektiv als Erfindung der Comicsprache sieht, wird kritisch betrachtet und Schlobinskis These unterstützt, die den Inflektiv als ein sich entwickelndes Element der deutschen Sprache begreift.
2.2 Der Inflektiv und seine semantischen Variationen
Dieser Abschnitt befasst sich mit der semantischen Variation des Inflektivs und zeigt die verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung des Inflektivs in verschiedenen Kontexten auf. Es wird die Frage behandelt, welche Bedeutung und Funktion der Inflektiv in der Kommunikation erfüllt und wie er sich semantisch von anderen Sprachformen abgrenzt.
2.3 Der Inflektiv als Element der Internet-Kommunikation
Der Abschnitt konzentriert sich auf die Verwendung des Inflektivs in der Internet-Kommunikation, insbesondere im Kontext von Chat-Kommunikation. Es werden verschiedene Forschungsansätze vorgestellt, die sich mit den Besonderheiten der Kommunikation im Internet befassen. Die Verwendung des Inflektivs wird in Bezug auf Stilelemente und Funktionen im Internet diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Hausarbeit sind Inflektiv, Sprachentwicklung, Internetkommunikation, Chat-Kommunikation, Comics, semantische Variation, Verbform, Prädikation, Sprachgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition eines Inflektivs nach Peter Schlobinski?
Schlobinski definiert den Inflektiv als prädikativ gebrauchten Verbstamm (z. B. *knuddel*), der eine eigenständige Verbform darstellt und keine bloße Interjektion ist.
Sind Inflektive eine Erfindung der Comicschreiber?
Obwohl sie oft mit Comics assoziiert werden (z. B. Erika Fuchs), betrachtet die Forschung sie heute eher als ein sich natürlich entwickelndes Element der deutschen Sprache, das in Comics lediglich popularisiert wurde.
In welchen modernen Kommunikationsmitteln kommen Inflektive vor?
Inflektive finden sich vornehmlich in der SMS- und Chat-Kommunikation, wo sie Begleithandlungen und Emotionen in Textform ausdrücken.
Welche semantischen Variationen bietet der Inflektiv?
Er kann einfache Handlungen (*seufz*), komplexe Interaktionen (*dichganzdollknuddel*) oder Lautmalereien darstellen und grenzt sich so semantisch von anderen Wortarten ab.
Warum ist der Wandel der Sprache für die Linguistik eine Herausforderung?
Die Mediatisierung und das Internet schaffen ständig neue virtuelle Räume, in denen sich Sprache schneller entwickelt, als traditionelle Forschungsmethoden sie oft erfassen können.
- Citar trabajo
- Lukas Kroll (Autor), 2009, Die Verbreitung und Verwendung des Inflektivs im Deutschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180531