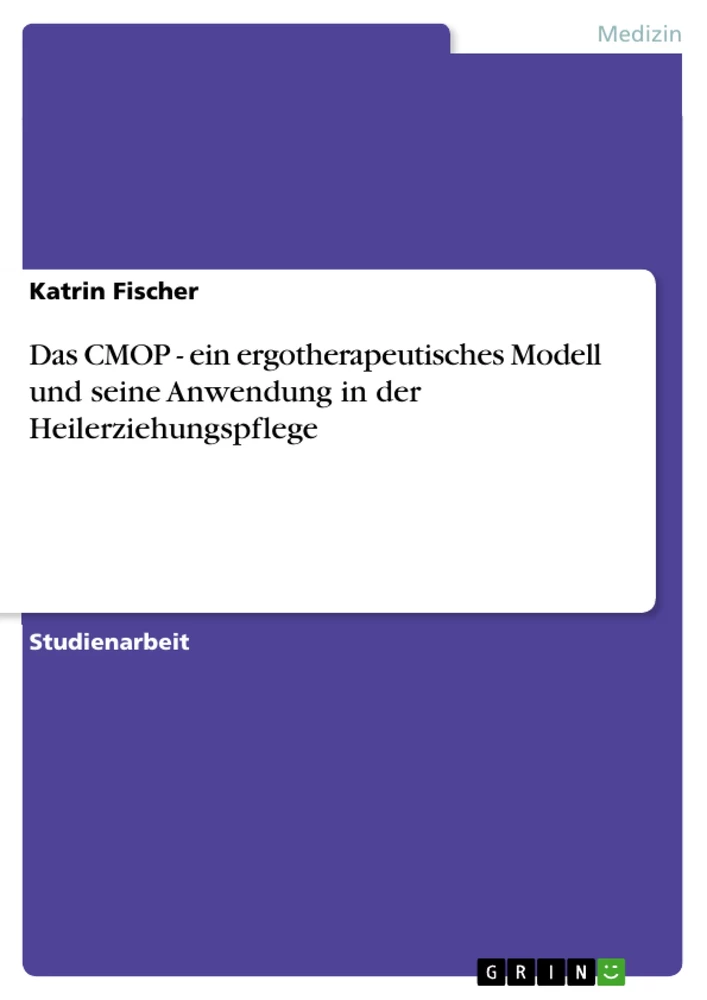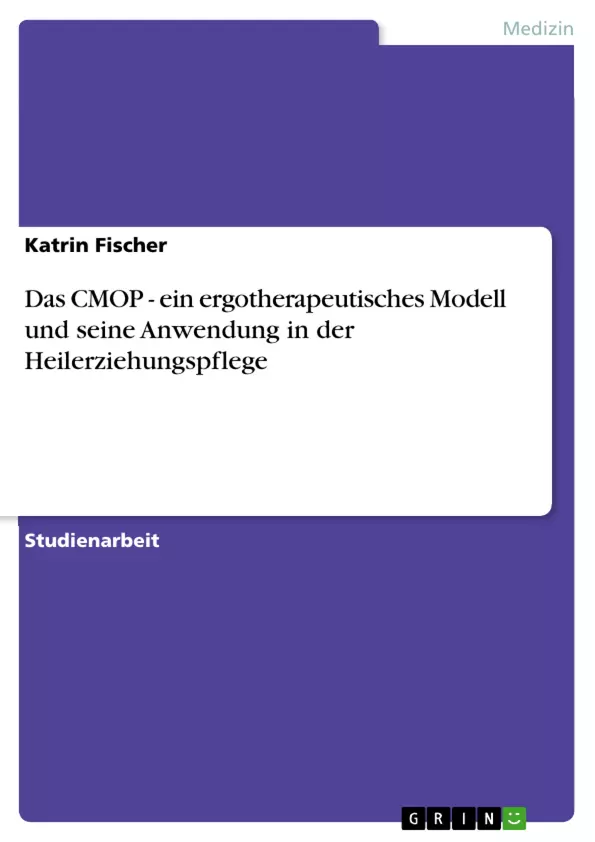In dieser Arbeit soll das Canadian Model of Occupational Performance vorgestellt werden. Das in der Ergotherapie bekannte und angewandte Modell, soll in einem Bereich der heilerziehungspflegerischen Praxis, dem Betreuten Einzelwohnen, Anwendung finden.
Mit dem Einsatz des COPM in der Heilerziehungspflege, kann das Spektrum an Inhalten und Betreuungszielen breiter werden. Die Einbeziehung des Klienten in den Zielfindungsprozess ermöglicht eine bedarfsorientierte und sehr persönliche Betreuung. Das COPM ermöglicht dem Betreuer eine klientenzentrierte Grundhaltung in seiner Tätigkeit mit Menschen. Durch das CMOP werden Betätigungen, für die Person wichtige Komponenten bezüglich ihrer Umwelt, Arbeitsinhalten und Zielen, in Form einer Analyse erfasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Canadian Model of Occupational Performance (CMOP)
- Die Entstehungsgeschichte des Modells CMOP
- Die beiden Kernelemente des Praxismodells CMOP
- Die Betätigungsperformanz (OP)
- Das Messinstrument COPM
- Der Aufbau des COPM
- Die Durchführung des COPM-Interviews
- Der Prozess der Betätigungsperformanz
- Der Praktische Teil: Frau K.s Einschätzung auf der Grundlage des CMOP
- Die anamnestischen und biografischen Daten von Frau K.
- Die Situation von Frau K. aus der Sicht des CMOP
- Fallstudie Frau K. – Durchführung und Auswertung des COPM
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) im Bereich des betreuten Einzelwohnens für Menschen mit Behinderungen. Die Zielsetzung besteht darin, anhand eines Fallbeispiels die Ergebnisse der Anwendung des CMOP zu analysieren und dessen Nutzen in diesem spezifischen Kontext zu evaluieren.
- Das Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) und seine Kernelemente.
- Die Anwendung des CMOP im Kontext des betreuten Einzelwohnens.
- Analyse der Betätigungsperformanz anhand des COPM.
- Fallstudie einer Klientin im betreuten Einzelwohnen.
- Bewertung der Effektivität des CMOP in der Praxis.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Kontext der Arbeit: die Anwendung des Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) im betreuten Einzelwohnen für Menschen mit Behinderungen. Sie erläutert die rechtlichen Grundlagen und das Ziel der Arbeit – die Untersuchung der Anwendbarkeit des CMOP anhand eines Fallbeispiels.
Das Canadian Model of Occupational Performance (CMOP): Dieses Kapitel präsentiert das CMOP, ein in der Ergotherapie etabliertes Modell. Es beschreibt detailliert die Entstehungsgeschichte des Modells vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und struktureller Veränderungen im Gesundheitswesen. Besonderes Augenmerk liegt auf den beiden Kernelementen: der Klientenzentriertheit und der Betätigung. Die drei Bereiche der Betätigung – Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit – werden ausführlich erklärt und mit Beispielen illustriert. Das Kapitel betont die Bedeutung der Berücksichtigung physischer, kognitiver und affektiver Performanzkomponenten sowie der Spiritualität im CMOP.
Das Messinstrument COPM: Dieses Kapitel befasst sich mit dem COPM (Canadian Occupational Performance Measure), einem Instrument zur Messung der Betätigungsperformanz. Es erläutert den Aufbau des COPM, die Durchführung des Interviews und den Prozess der Betätigungsperformanz-Erfassung. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung des COPM als Messinstrument im Rahmen des CMOP.
Der Praktische Teil: Frau K.s Einschätzung auf der Grundlage des CMOP: Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie über Frau K., eine Klientin im betreuten Einzelwohnen. Es beinhaltet die anamnestischen und biografischen Daten von Frau K. und beschreibt ihre Situation im Kontext des CMOP. Die Durchführung und Auswertung des COPM mit Frau K. werden detailliert dargestellt und analysiert, um die Anwendbarkeit des CMOP in der Praxis zu demonstrieren.
Schlüsselwörter
Canadian Model of Occupational Performance (CMOP), COPM, Betreutes Einzelwohnen, Betätigungsperformanz, Ergotherapie, Klientenzentriertheit, Behinderung, Fallstudie, Rehabilitation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Anwendung des Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) im betreuten Einzelwohnen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) im betreuten Einzelwohnen für Menschen mit Behinderungen. Sie analysiert anhand eines Fallbeispiels die Ergebnisse der CMOP-Anwendung und evaluiert dessen Nutzen in diesem Kontext.
Was ist das Canadian Model of Occupational Performance (CMOP)?
Das CMOP ist ein in der Ergotherapie etabliertes Modell. Es ist klientenzentriert und fokussiert auf Betätigung. Die drei Bereiche der Betätigung sind Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit. Das Modell berücksichtigt physische, kognitive und affektive Performanzkomponenten sowie Spiritualität.
Welche Kernelemente hat das CMOP?
Die Kernelemente des CMOP sind die Klientenzentriertheit und die Betätigung. Die Arbeit beschreibt detailliert die Entstehungsgeschichte des Modells und seine Bedeutung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und struktureller Veränderungen im Gesundheitswesen.
Was ist das COPM und wie wird es angewendet?
Das COPM (Canadian Occupational Performance Measure) ist ein Instrument zur Messung der Betätigungsperformanz. Die Arbeit erläutert den Aufbau, die Durchführung des Interviews und den Prozess der Betätigungsperformanz-Erfassung mit dem COPM im Rahmen des CMOP.
Wie wird das CMOP in der Fallstudie angewendet?
Die Arbeit präsentiert eine Fallstudie über Frau K., eine Klientin im betreuten Einzelwohnen. Es werden ihre anamnestischen und biografischen Daten beschrieben, ihre Situation im Kontext des CMOP analysiert und die Durchführung sowie Auswertung des COPM mit Frau K. detailliert dargestellt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das CMOP und seine Kernelemente, dessen Anwendung im betreuten Einzelwohnen, die Analyse der Betätigungsperformanz mittels COPM, eine Fallstudie und die Bewertung der Effektivität des CMOP in der Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Canadian Model of Occupational Performance (CMOP), COPM, Betreutes Einzelwohnen, Betätigungsperformanz, Ergotherapie, Klientenzentriertheit, Behinderung, Fallstudie, Rehabilitation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, zum CMOP (inklusive Entstehungsgeschichte und Kernelementen), zum COPM (Aufbau und Anwendung), zur Fallstudie von Frau K. und eine Zusammenfassung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, anhand eines Fallbeispiels die Ergebnisse der Anwendung des CMOP zu analysieren und dessen Nutzen im betreuten Einzelwohnen für Menschen mit Behinderungen zu evaluieren.
- Quote paper
- Katrin Fischer (Author), 2009, Das CMOP - ein ergotherapeutisches Modell und seine Anwendung in der Heilerziehungspflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180616