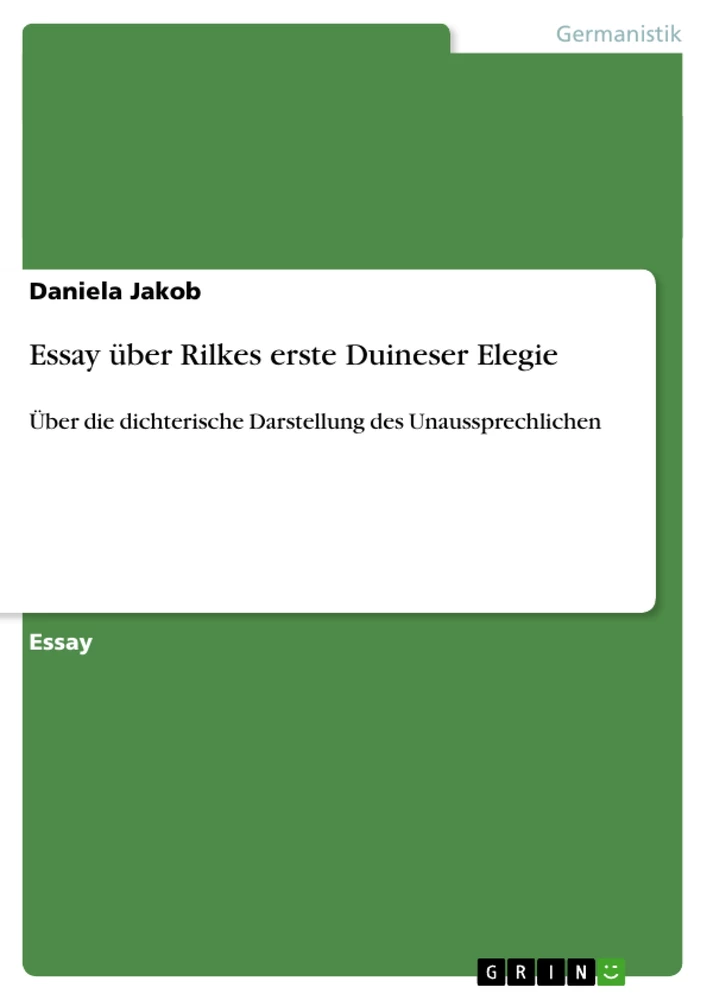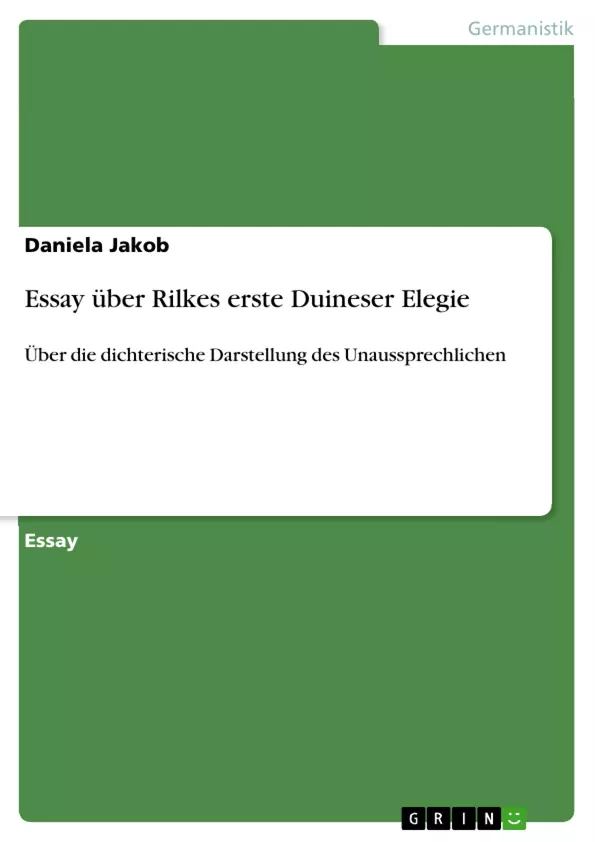Rilkes erste Duineser Elegie entwirft die Grundthematik für den gesamten Zyklus, der aus zehn Gedichten besteht. Der vorliegende Essay behandelt die Darstellung des Unsagbaren in Rilkes Lyrik.
Inhaltsverzeichnis
- Rilkes erste Duineser Elegie entwirft die Grundthematik für den gesamten Zyklus, der aus zehn Gedichten besteht.
- Sie erfüllt die Erwartungen, die der Begriff „elegisch“ erweckt: Vom ersten aussichtslosen und deshalb nur theoretisch bemühten Aufschrei („Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel / Ordnungen...“) an entwickelt sich eine Klage über das Menschsein auf Erden.
- Rilkes Lyrisches Ich erfährt sich in der ersten Duineser Elegie als fremd, allein, einzeln und begrenzt.
- Getrennt von einer heiligen Welt ersehnt es Einheit mit dem Numinosen, das so groß, erhaben und unfassbar ist, dass es nur in Abgrenzung zum bekannten Menschlichen formuliert werden kann: „[...] und gesetzt selbst, es nähme mich einer ans Herz: ich verginge von seinem stärkeren Dasein.
- Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.“
- Eine direkte Erfahrung der den Menschen transzendierenden Welt ist naturgemäß nicht möglich; ein Abglanz dieser Erfahrungen scheint das Höchste zu sein, was die Menschen erhoffen können.
- Die Ausdehnung vom „ich“ auf das „wir“ schließt alle anderen Menschen mit in die Klage ein.
- Das Leiden am Dasein ist nun nicht mehr individuell, sondern wird zum allgemein menschlichen Prinzip erhoben.
- Die Verbindung zwischen den Individuen beruht auf dem Dasein in der „gedeuteten Welt“, das anderen Wesenheiten (wie z.B. die „Engel“ und „Tiere“) nicht zugänglich ist.
- Die scheinbare Notwendigkeit des Menschen, sich seine Welt durch Interpretation zu eigen zu machen, verdeutlicht die Spaltung, die zwischen Mensch und Welt besteht: „Ist sie [die Nacht] den Liebenden leichter? Ach, sie verdecken sich nur miteinander ihr Los.“
- Erst an späterer Stelle zeigt sich, dass das Deuten für den Menschen tatsächlich der falsche Weg sei: „Aber Lebendige machen / alle den Fehler, dass sie zu stark / unterscheiden.“
- Doch auch mit dieser Erkenntnis bleibt die Frage nach der „rechten“, d.h. dem Menschen innewohnenden Existenz bestehen.
- Eine Heimat klingt noch nicht an, denn alles ist im Fließen begriffen: Rilke umreißt eine Vielzahl von Möglichkeiten, nur um auch gleichzeitig deren Grenzen aufzuzeigen.
- Keine Haltung, kein Entschluss, keine Tat können dem Menschen Sicherheit, Beständigkeit und Klarheit im Dasein bringen.
- Folgerichtig erscheint daraufhin die Konklusion, dass das Schweben selbst der Ort sei, der dem Menschen zur Heimat werden kann: „Sollen nicht endlich uns diese ältesten Schmerzen / fruchtbarer werden? Ist es nicht Zeit, daß wir liebend / uns vom Geliebten befrein und es bebend bestehn: / wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesammelt im Absprung / mehr zu sein als er selbst.
- Denn Bleiben ist nirgends.“
- Im Anschluss an diese grundlegende Erkenntnis, die Rilke aber ganz still und einfach in vier schlichten Worten fest stellt’, folgt die eindringliche Aufforderung, den fremden Gesetzen der transzendenten Welt zu folgen: „Stimmen, Stimmen. Höre, mein Herz, wie sonst nur / Heilige hörten: daß sie der riesige Ruf / aufhob vom Boden; sie aber knieten, Unmögliche, weiter und achtetens nicht: / So waren sie hörend.
- Nicht, daß du Gottes ertrügest / die Stimme, bei weitem. Aber das Wehende höre, / die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet.“
- Nur indem sich der Mensch innig dem Unaussprechlichen anheim gibt, kann er bei Rilke eine Ahnung des Immer Seienden erfahren.
- Der unmittelbare menschliche Zugang zur jenseitigen Welt ist der Tod.
- Unumgänglich steht er jedem Menschen bevor.
- Obgleich sich Diesseits und Jenseits bei Rilke zu durchdringen scheinen, bedarf der Zugang zur metayphysischen Welt eines Tores, das in diesem Falle durch den Tod gegeben ist: Die Nachricht, die das innig lauschende Lyrische Ich in Rilkes Gedicht nun empfängt, stammt von den Toten.
- In einem Perspektivenwechsel erfährt der Leser vom Verlust der menschlichen Dimension im Tod (und damit der Identität) und von dem Mangel jeglicher Integrität: „,das, was man war, in unendlich ängstlichen Händen, / nicht mehr zu sein und selbst den eigenen Namen / wegzulassen wie ein zerbrochenes Spielzeug.
- Seltsam, die Wünsche nicht weiterzuwünschen. Seltsam, / alles, was sich bezog, so lose im Raume / flattern zu sehen. Und das Totsein ist mühsam / und voller Nachholn, daß man allmählich ein wenig / Ewigkeit spürt. […]“
- Die Botschaft der Toten wirkt prophetisch – legt sie doch Bereiche offenbar, die dem Lyrischen Ich auf Erden verborgen bleiben müssen.
- Umgekehrt können die Lebenden für die Toten bei Rilke nichts mehr leisten: „Schließlich brauchen sie uns nicht mehr, die Frühentrückten / man entwöhnt sich des Irdischen sanft, wie man den Brüsten / milde der Mutter entwächst. Aber wir, die so große / Geheimnisse brauchen, denen aus Trauer so oft / seliger Fortschritt entspringt – könnten wir denn sein ohne sie?“
- Wem die Welt zu eng wird, der sucht sie auszudehnen - und sei es in das Jenseits, das am nächsten liegt bei den Toten.
- Hier findet die erste der zehn Elegien ihren Abschluss, der das Schwebende, Ungewisse des Anfangs transformiert in eine in einer gewissen Art geformte „Schwingung [...], die uns jetzt hinreißt und tröstet und hilft.“
- Auch wenn Rilke hier einen ansatzweise hoffnungsfrohen Ausblick findet, bleibt doch der klagende Grundton das bestimmende Moment des Gedichtes.
- Vom Klagen zum negativ konnotierten Jammern ist es bisweilen nicht weit, vor allem, weil das Jammern von den Jammernden selbst nie als solches empfunden wird.
- Jede Klage entspringt einem subjektiven Empfinden, und als solches bedarf es keiner Rechtfertigung.
- Folglich könnte man sogar behaupten, der Begriff „Jammer“ finde gerechte Verwendung nur in der Beurteilung einer Klage von außen durch einen Unverständigen.
- Und so könnte man Rilke durchaus vorwerfen, er jammere sich pathetisch durchs Menschsein hindurch („[...] Ach, wen vermögen / wir denn zu brauchen? Engel nicht, / Menschen nicht, / und die findigen Tiere merken es schon, / daß wir nicht sehr / verlässlich zu Haus sind / in der gedeuteten Welt. [...]“ – jedoch nur, um Zeugnis davon abzulegen, dass von eigener oder mitfühlender Erfahrung des Geschilderten keine Spur ist.
- Bei diesem Verständnis bleibt jedoch ungeachtet, dass der Jammer auch die neutrale Konnotation von wehklagen und aufseufzen haben kann.
- Tatsächlich stellt sich wohl jedem Leser der Duineser Elegien zu Beginn die Frage: Handelt es sich bei hier um große Lyrik oder nicht vielmehr nur um Gefühlsduselei überdeckendes Dichterhandwerk?
- Durchaus könnte man mit so mancher emphatischer Sentenz („Ein jeder Engel ist schrecklich.“, „Denn Bleiben ist nirgends.“) eine pathologische Übersensibilität des Dichters assoziieren.
- Doch ob die Grenze zum Kitsch bereits überschritten ist, möchte man angesichts der hohen Kunstfertigkeit der Verse dann doch nicht entscheiden.
- So wohl durchdacht wirken die Verse, dass man kaum mehr annehmen mag, der Inhalt sei in letzter Instanz bedeutungslos.
- Vor ambivalenten Reaktionen war nicht einmal Rilke selbst sicher.
- In einem Brief schreibt er: „Es läßt sich ja kaum sagen, bis zu welchem Grade ein Mensch in eine künstlerische Verdichtung von der Konzentration jener Elegien und einzelner Sonette sich überzuführen vermag; oft ist es seltsam für die Lage des Hervorbringenden, an den dünneren Tagen des Lebens (den vielen!) solche Essenz des eigenen Daseins, in ihrem unbeschreiblichen Überwiegen, neben sich zu fühlen.“
- Freilich deutet Rilke seinen Zweifel hier als mangelndes Verständnis für das eigene Kunstwerk.
- Ambivalent bleibt Rilkes Versuch, das Unsägliche dann doch zu sagen.
- Mit Wittgenstein scheint ein solches Unterfangen schon vor Beginn aussichtslos und es läge nahe, das Unaussprechliche unausgesprochen zu belassen und die Grenzen des menschlichen Sprachvermögens anzuerkennen.
- Einen Ausweg aus diesem Dilemma findet Rilke durch die Form der Duineser Elegien.
- Die zahlreichen Symbole in Rilkes Gedicht mögen dem Leser ebenso kryptisch erscheinen wie Rilkes Lyrischem Ich die „gedeutete Welt“, jedoch nur solange man versucht, die Symbole einer Deutung zu unterziehen.
- Die Frage nach ihrer Referenz richtet den Blick auf die Ebene, auf der sich alle Sprechenden einig sind.
- Während der Lektüre der Duineser Elegien kommt man damit gewiss nur zu unbefriedigenden Ergebnissen.
- Sieht man jedoch davon ab, die Motive endgültig und vollständig deuten zu wollen, öffnet sich der Geist allen Assoziationen, die der individuellen Lektüre zuträglich sind.
- Auch die Freien Verse unterstützen diese Form der Rezeption: Ohne Endreim sind sie frei für jede Richtung, in die sie sich neigen wollen.
- Zahlreiche Enjambements reißen die Sprache in Stücke, und Einschübe (mitunter gar eingeklammert) unterbrechen jeden sich anbahnenden Rhythmus.
- Hervorragend geeignet ist diese zerrissene Sprache, die wie aus Bruchstücken künstlich zusammengefügt wirkt, um die leeren Stellen aufzuzeigen: Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man zwar schweigen.
- Tritt nun die Poesie auf den Plan, so ist sie dazu aufgerufen, das Schweigen in eine Sprache einzubinden, die es präsentiert und lautlos sprechend macht.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert Rilkes erste Duineser Elegie und untersucht, wie sie das Unaussprechliche in dichterischer Form darstellt. Der Fokus liegt auf der Darstellung der menschlichen Existenz im Spannungsfeld zwischen Diesseits und Jenseits, sowie auf der Rolle der Sprache und des Schweigens in der Auseinandersetzung mit dem Transzendenten.
- Das Menschsein in der „gedeuteten Welt“
- Die Sehnsucht nach Einheit mit dem Numinosen
- Die Grenzen des menschlichen Sprachvermögens
- Die Rolle des Todes als Tor zur transzendenten Welt
- Die Bedeutung der Sprache und des Schweigens in der Darstellung des Unaussprechlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Analyse der ersten Duineser Elegie, die die Grundthematik des gesamten Zyklus aufwirft: die Klage des Menschen über sein Dasein auf Erden. Rilkes Lyrisches Ich erfährt sich als fremd und allein, getrennt von einer heiligen Welt. Es sehnt sich nach Einheit mit dem Numinosen, doch diese Erfahrung bleibt ihm verwehrt. Die Ausdehnung vom „ich“ auf das „wir“ schließt alle Menschen in die Klage ein, wodurch das Leiden zum allgemein menschlichen Prinzip erhoben wird. Die scheinbare Notwendigkeit des Menschen, sich seine Welt durch Interpretation zu eigen zu machen, verdeutlicht die Spaltung zwischen Mensch und Welt.
Der Essay beleuchtet die Rolle der Sprache und des Schweigens in der Darstellung des Unaussprechlichen. Er zeigt, wie Rilke die Grenzen des menschlichen Sprachvermögens aufzeigt und zugleich die Notwendigkeit des Schweigens in der Auseinandersetzung mit dem Transzendenten betont. Der Tod wird als das Tor zur jenseitigen Welt dargestellt, wobei die Botschaft der Toten dem Lyrischen Ich Einblicke in Bereiche gewährt, die ihm auf Erden verborgen bleiben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselfragen des Essays sind: Die Darstellung des Unaussprechlichen, die Grenzen des menschlichen Sprachvermögens, die Rolle des Todes als Tor zur transzendenten Welt, die menschliche Existenz im Spannungsfeld zwischen Diesseits und Jenseits, die Sprache und das Schweigen als Mittel der Dichterischen Gestaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Rilkes erster Duineser Elegie?
Das Thema ist die Darstellung des Unsagbaren und die existenzielle Klage über die Begrenztheit und Einsamkeit des Menschen.
Was bedeutet der Satz „Denn Bleiben ist nirgends“?
Er drückt die Rilkesche Erkenntnis aus, dass alles im Fluss ist und der Mensch keine dauerhafte Sicherheit im Dasein finden kann.
Wie wird das Verhältnis zwischen Mensch und Engel beschrieben?
Engel werden als transzendente, „schreckliche“ Wesen dargestellt, deren Übermacht die menschliche Existenz zerstören könnte.
Welche Rolle spielt der Tod in der Elegie?
Der Tod wird als Tor zur metaphysischen Welt und als notwendiger Perspektivwechsel gesehen, um die Ewigkeit zu spüren.
Warum wird Rilkes Sprache in diesem Werk als „zerrissen“ bezeichnet?
Durch Enjambements und Einschübe bildet die Sprache die Unmöglichkeit ab, das Unaussprechliche direkt zu sagen.
- Arbeit zitieren
- M.A. Philosophie, Germanistik Daniela Jakob (Autor:in), 2008, Essay über Rilkes erste Duineser Elegie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180686