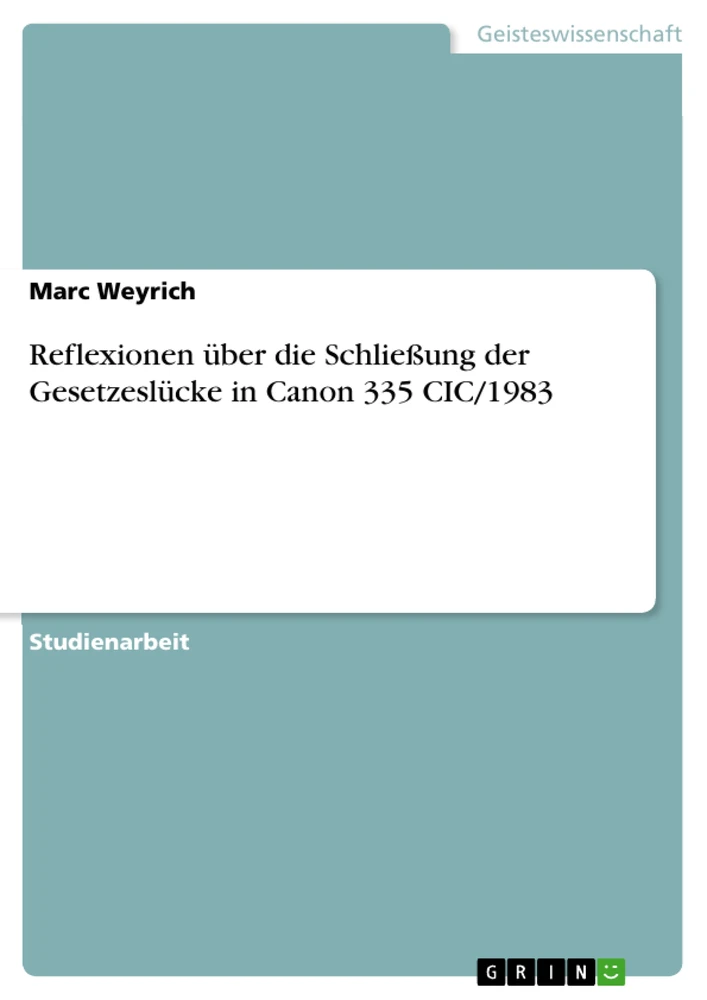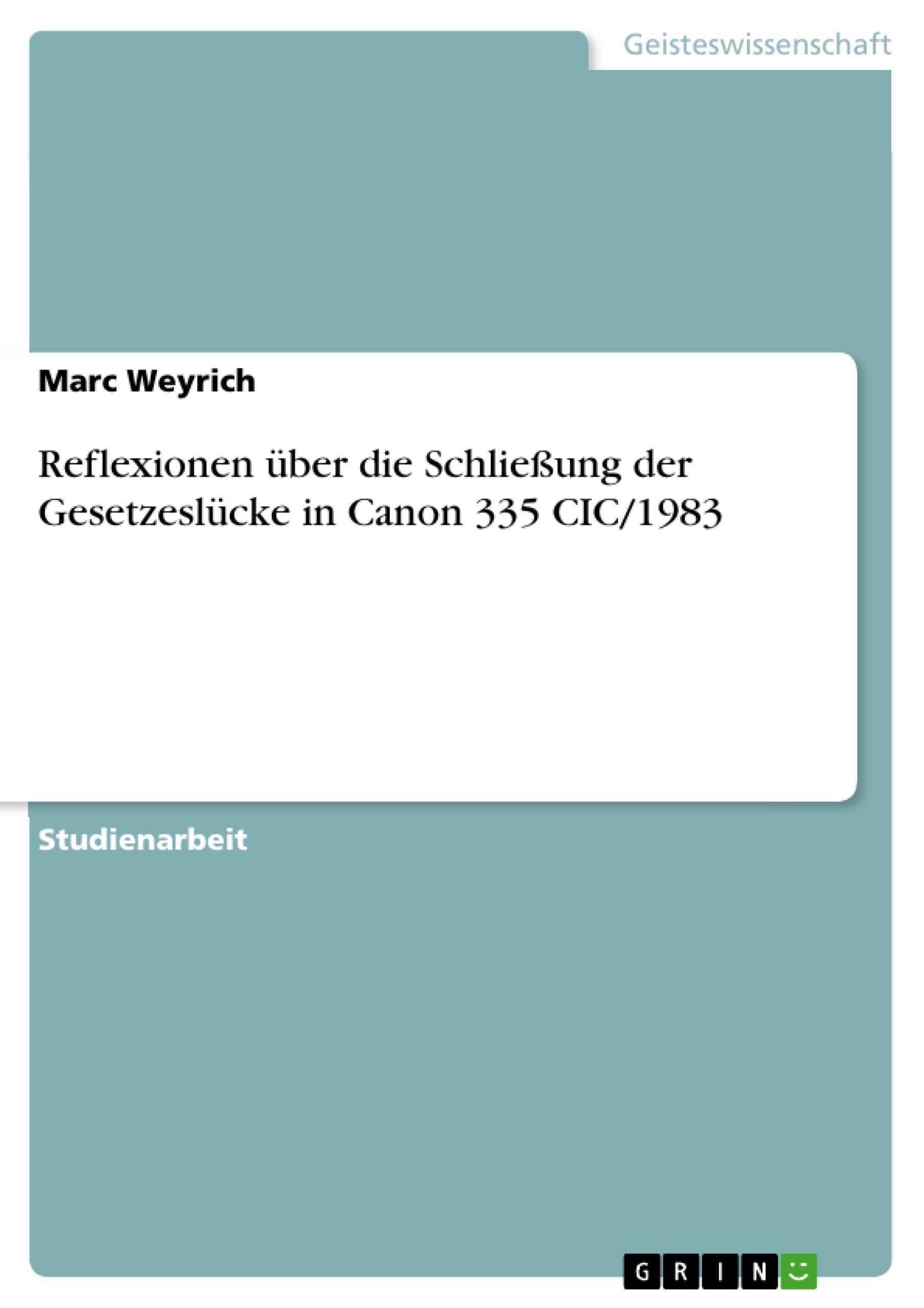"Bei Vakanz oder völliger Behinderung des römischen
Bischofsstuhles darf in der Leitung der Gesamtkirche nichts geändert
werden; es sind aber die besonderen Gesetze zu beachten, die für
diese Fälle erlassen sind", so lautet Canon 335 des CIC/1983.
Hier klafft eine Gesetzeslücke.
Die vorliegende Hausarbeit spürt der Frage nach, was als völlige Behinderung des römischen Bischofsstuhles verstanden werden kann und leuchtet aus, wie nicht nur eine solche festgestellt, sondern auch wie eine Vertretung geregelt sein könnte.
Anders ausgedrückt: Wer hat die Macht über den mächtigsten Mann der Weltkirche zu sagen, dieser sei nun völlig behindert und im Zuge seines Zustandes unfähig die notwendigen Führungsaufgaben wahrzunehmen?
Darüber hinaus: Was sind die speziellen Gesetze, die beachtet werden müssen, in einem solchen Fall?
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Maßnahmen bzw. Nicht-Maßnahmen bei Vakanz und völliger Behinderung
- Can.335 im Lichte des fehlenden Spezialgesetzes
- Gründe für die Vakanz des Heiligen Stuhls unter Berücksichtigung von Can. 332
- Can. 19 - Umgang mit Gesetzeslücken im CIC/1983
- Gesetzesanalogie zur Lösungsfindung: Can. 412 unter Berücksichtigung von Can. 413
- Die Rolle des Kardinal-Camerlengo und der übrigen Kardinäle
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Gesetzeslücke im Can. 335 des CIC/1983 im Zusammenhang mit der völligen Behinderung des Papstes. Sie untersucht die rechtliche Situation in Bezug auf die Amtsführung in einer solchen Situation und sucht nach möglichen Lösungen unter Berücksichtigung der bestehenden kanonischen Regeln und Prinzipien.
- Definition und Anwendung des Begriffs "völlige Behinderung" im Bezug auf den Papst
- Untersuchung der rechtlichen Folgen der "völligen Behinderung" des Papstes
- Analyse der Möglichkeiten, die Amtsführung des Papstes in einer solchen Situation zu gewährleisten
- Kritik des geltenden Rechts und mögliche Lösungen für die Gesetzeslücke
- Bedeutung und Rolle des Kardinal-Camerlengo und des Kardinalskollegiums
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die Bedeutung des Papstes als moralische und ethische Autorität in der katholischen Kirche. Es wird auf die schwierige Situation bei der Behinderung des Papstes Johannes Paul II. und den daraus resultierenden Bedarf an einer Lösung der Gesetzeslücke im Can. 335 hingewiesen.
Im zweiten Kapitel wird die Problematik der "völligen Behinderung" des Papstes im Kontext des Can. 335 näher beleuchtet. Die Frage nach der Definition der "völligen Behinderung", der notwendigen Verfahren und der Entscheidungsgewalt in diesem Zusammenhang wird aufgeworfen.
Kapitel drei untersucht die Möglichkeiten und Einschränkungen der Amtsführung des Papstes während der Vakanz des Heiligen Stuhls, wie sie in der apostolischen Konstitution "Universi Dominici Gregis" festgelegt sind.
Kapitel vier befasst sich mit der Analyse des Can. 335 im Lichte des fehlenden Spezialgesetzes für die "völlige Behinderung" des Papstes. Es wird die Notwendigkeit einer juristischen Lösung des Problems betont.
Kapitel fünf beleuchtet die Gründe für die Vakanz des Heiligen Stuhls und diskutiert die Auswirkungen der "völligen Behinderung" des Papstes im Kontext des Can. 332.
Kapitel sechs widmet sich dem Umgang mit Gesetzeslücken im CIC/1983 anhand des Can. 19. Es werden die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten und die Notwendigkeit einer angemessenen Lösung betrachtet.
Kapitel sieben untersucht die Anwendung der Gesetzesanalogie zur Lösungsfindung der Gesetzeslücke in Can. 335 unter Berücksichtigung von Can. 412 und Can. 413.
Kapitel acht beleuchtet die Rolle des Kardinal-Camerlengo und der übrigen Kardinäle im Kontext der "völligen Behinderung" des Papstes. Es werden ihre Aufgaben und Befugnisse in dieser Situation erläutert.
Schlüsselwörter
Can. 335 CIC/1983, Vakanz, völlige Behinderung, Papst, Heilige Stuhl, Kardinal-Camerlengo, Kardinalskollegium, "Universi Dominici Gregis", Gesetzeslücke, Gesetzesanalogie, kanonisches Recht, Amtsführung, Führung, Kirche, Weltkirche.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt Canon 335 des CIC/1983?
Er besagt, dass bei Vakanz oder völliger Behinderung des römischen Bischofsstuhles in der Leitung der Gesamtkirche nichts geändert werden darf und besondere Gesetze zu beachten sind.
Wo genau liegt die „Gesetzeslücke“ im Canon 335?
Es fehlt ein spezielles Gesetz, das definiert, wie eine „völlige Behinderung“ (z. B. durch schwere Krankheit) festgestellt wird und wer dann die Vertretung übernimmt.
Wer stellt die Amtsunfähigkeit des Papstes fest?
Dies ist eine der zentralen Fragen der Arbeit, da das geltende Recht keine klare Instanz benennt, die über die Behinderung des „mächtigsten Mannes der Weltkirche“ urteilen darf.
Welche Rolle spielt der Kardinal-Camerlengo?
Der Camerlengo verwaltet die Kirche während der Vakanz, doch seine Befugnisse bei einer bloßen Behinderung des Papstes sind rechtlich unklar.
Wie können Gesetzeslücken im Kirchenrecht geschlossen werden?
Die Arbeit zieht Canon 19 heran und nutzt Gesetzesanalogien (z. B. Can. 412/413 zur Behinderung eines Diözesanbischofs) als mögliche Lösungsansätze.
- Quote paper
- Marc Weyrich (Author), 2009, Reflexionen über die Schließung der Gesetzeslücke in Canon 335 CIC/1983, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180899